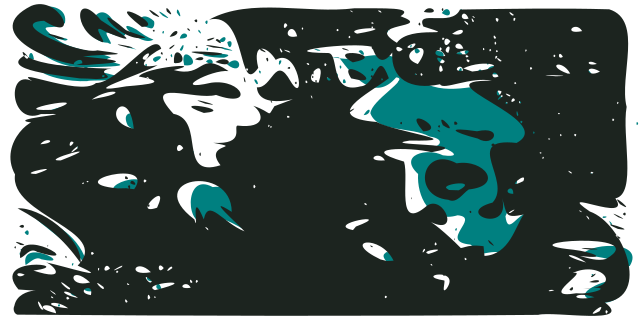von Ulrich Siebgeber
Die Krise der EU steckt in der Krise: ein Schelm, wer sie da herausholt.
*
Ein Glaube stirbt nicht, er diffundiert. Wo er sich sammelt, geschehen seltsame Dinge.
*
Die Freude oder, sagen wir, Erleichterung darüber, nach langer Wüstenwanderung einen Präsidenten zu haben, der der Sprache mächtig ist, so dass es sich auch einmal lohnt, den semantischen Feinheiten einer Rede nachzuspüren.
- Details
- Geschrieben von: Siebgeber Ulrich
- Rubrik: Kultur
von Josef Ludin
Es waren offenbar deutsche Denker des 18. und 19. Jahrhunderts, die Kultur und Zivilisation voneinander getrennt betrachten wollten. In der englischen und französischen Tradition war diese Unterscheidung ungewöhnlicher, und man bevorzugte den Begriff der Zivilisation, meinte damit aber alles, was zu kulturellen Phänomenen gehörte. Zuletzt war Freud einer, der sich in seiner berühmten Schrift, »Das Unbehagen in der Kultur«, von der Unterscheidung lossagen wollte und forderte, man solle die Begriffe synonym benutzen. Tatsache war, dass er von einem anthropologisch geprägten Kulturbegriff ausging, von der Frage nach der Menschwerdung des Menschen in der Abgrenzung vom Tierreich, und davon dass die menschliche Kultur eben Triebverzicht benötige.
- Details
- Geschrieben von: Ludin Josef
- Rubrik: Kultur
von Jörg Büsching
I. Europa dankt ab – wovon?
Europe does not have a sense for the future anymore.
Martin Jacques
1. Von der Euphorie zur Dysphorie
Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion war unstrittig, dass die Legitimität einer Gesellschaftsordnung sich vor allem an deren Fortschrittlichkeit, d. h. dem Grad der technisch-wissenschaftlichen Entwicklung sowie der darauf basierenden Verbesserung der allgemeinen materiellen Lebensbedingungen der Menschen ablesen lasse. Der nach dem Start des ersten von Menschen hergestellten Himmelskörpers, Sputnik 1, so genannte »Wettlauf der Systeme« bezog seine Attraktivität auf beiden Seiten des ideologischen Grabens zwischen West und Ost aus einer materialistischen Weltanschauung. Dieser Umstand wird von heutigen Marktromantikern, die den Zusammenbruch des Ostblocks allzu selbstherrlich als »Sieg des Westens«
- Details
- Geschrieben von: Büsching Jörg
- Rubrik: Kultur
- Episode vom Feind
- Multikulturalismus, Hyperkulturalität und Interkulturelle Kompetenz
- Albert Camus – Der Mythos des Sisyphos
- Der Maulwurf und die Lokomotive. Die Beharrlichkeit der Revolution
- Gesellschaftsdämmerung (2): Unsere Moderne wird vergessen
- Gesellschaftsdämmerung (1): Migrationen
- Altamerikanistik und Asienwissenschaften im Dialog
- Imperial culture and cultural imperialism - The case of India
- Kulturwissenschaftliche Neuorientierungen in der späten Moderne
- Thesen zur Politik der Kultur