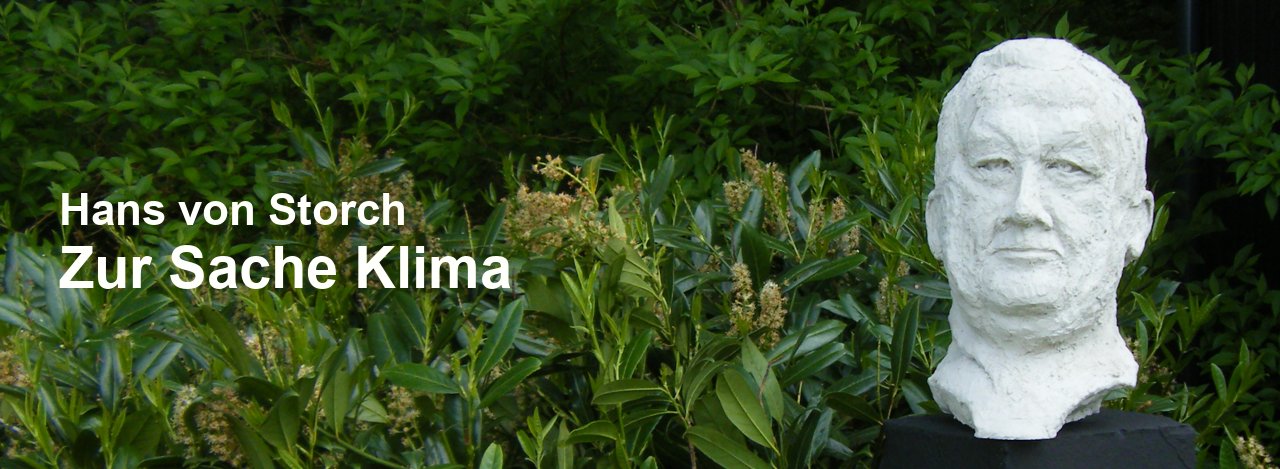 Aufnahme: ©J.Xu
Aufnahme: ©J.Xu
Die Absicht dieser Kolumne geht dahin, ruhiger, als es in der Publizistik gemeinhin geschieht, die Hintergründe von Aufregerthemen in Sachen Klimawandel und Klimaschutz zu erläutern, manchmal auch einfach Grundlagen zu erklären. – Hans von Storch, geb. 1949, ist Professor am Meteorologischen Institut der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften (MIN), Zweitmitglied an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo) der Universität Hamburg sowie Direktor emeritus des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz Forschungszentrum Geesthacht. Er ist Spezialist für Fragen der Klimamodellierung und hat in verschiedenen Arbeitsgruppen des IPCC mitgearbeitet. Zusammen mit Werner Krauß schrieb er das Buch Die Klimafalle: die gefährliche Nähe von Politik und Klimaforschung (2013).
