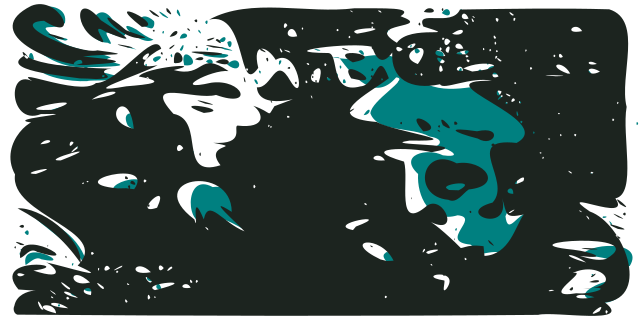von Ulrich Schödlbauer
1.
Man wird den Fortschritt nicht so leicht los, wie man denkt. Die Geschichte schreitet fort, unaufhaltsam, was sollte sie auch sonst. Sie schreitet voran, das scheint bereits eine ernstere Sache. Denn es enthält den Hintergedanken, dass nicht alle in gleicher Front marschieren, dass es Zurückgebliebene gibt – im Denken, in der Kunst, in den Manieren, in den ›Verhältnissen‹. Ganze Länder und Regionen lösen sich aus dem Verbund, sie bleiben zurück. Offenbar sind sie weniger an der Geschichte interessiert als andere. Oder sie glauben bereits zu wissen, wie es ausgeht. Aber das ist nur so dahingedacht. Wer näher hinsieht, findet keine Zurückgebliebenen, dafür Einpeitscher und Hochmütige, Nachgiebige und Gemütsmenschen, die all das empfinden, was ihnen erzählt wird, Leute, die die Richtung zu kennen glauben und ihre Mitmenschen drangsalieren, schließlich diese Mitmenschen selbst, Mitmenschen, die ihr Menschentum aus dem Katalog oder dem Gruppenzauber beziehen. Dazu kommen Verlierer, die den Anschluss suchen, soll heißen, die Mittel erkunden, die ihnen erlauben, erlittene Niederlagen in Siege zu verwandeln. Die einfachste Sicht der Geschichte besitzt ein Mitteleuropäer zwischen seinem zwanzigsten und dreißigsten Lebensjahr: was war, ist Vorgeschichte, was sein wird, Zukunft, von seinesgleichen gestaltet, also dem Stand der Dinge gemäß. So einfach ist das Leben. Oder auch nicht. Kinder wachsen nach, das begrenzt den Ermessensspielraum. Jede Generation wird von der folgenden um die Früchte des Fortschritts betrogen – sie verzehrt, ohne hinzusehen. Gewöhnlich gelten die Früchte als faul und der Verzehr als schmerzhaft. Aber auch Schmerzempfindlichkeit und Schmerzrichtung wechseln. So erstarren beide Seiten rasch in Mißachtung oder Protest und es bedarf vieler Gespräche an imaginären oder realen Kaminen, um das Verhältnis ›im Fluss‹ zu halten, das heißt das definitive Urteil über den jeweils anderen in der Schwebe zu lassen. Die Aktionäre, alte und neue, können nicht erwarten, daß der Gewinn des laufenden Geschäftsjahrs auf ihre Konten überwiesen wird. Währenddessen investiert die Unternehmensleitung. Der Markt, so hört man, wird von Tag zu Tag schwieriger.
2.
In der Physik bezeichnet der Ausdruck ›black box‹ einen undefinierten Zustand. In der Moralphilosophie nimmt man die Vorstellung gelegentlich auf und wendet sie auf das an, was in ihr ›Entscheidung‹ heißt. Dass ich mich entscheide, folgt der Logik eines Verlaufs, der an entscheidender Stelle zeugenlos bleibt. Der Prozess der Entscheidung mit seinen Phasen der Unentschiedenheit, des Abwägens, der wachsenden und abflauenden Entschiedenheit, schließlich des Entschiedenseins, des Seine-Entscheidung-getroffen-Habens lässt sich eindrucksvoll beschreiben, doch der Moment der Entscheidung, das Überschreiten der Schwelle, ist darin nicht oder nur pro forma enthalten. Was in der Entscheidung geschieht, entzieht sich, Schrödingers Katze vergleichbar, der Beobachtung. Das theoretische Dilemma, das sich daraus ergibt, nicht zu wissen, warum eine Entscheidung so oder so ausfällt, gleichgültig darum, wie gut man die Motive und Gründe des Handelnden zu kennen glaubt, besitzt ein gewisses Gegenstück in Theorien kultureller Verläufe. Wie der juristische Prozess der Herstellung eines Urteils dient, so ›dient‹ offenbar der kulturelle Prozess der Herstellung eines Zustandes oder einer kulturellen Verfasstheit, in welcher älteren Zuständen das Urteil gesprochen ist. Wer später kommt, ist weiter. Unabhängig davon, wie viel oder wenig die Akteure darüber wissen, wie es vorher war, verfügen sie jedenfalls über ein Urteil, das die Überzeugung von der Differenz des eigenen und der früheren Zustände einschließt - die Mehrzahl steht hier deshalb, weil hinter jedem Zustand ein früherer auftaucht und im Bewusstsein der Differenz mit ihm verschmilzt.
3.
Generationen, so schien es lange, erkennt man an ihrem Lebensstil, an Glaubenshaltungen und politischen Überzeugungen, also an dem, was der Ausdruck ›Sozialisation‹ so bündig wie vorgreifend zusammenfasst. Weitgehend ausgespart bleibt, worüber man in Gesellschaft zu reden sich geniert und worüber am ehesten die auf lange Zeiträume eingerichtete Kulturforschung Auskunft gibt: Formen der Lebensangst und der Todesfurcht. Am ehesten erscheint ihr nach Jahrgängen und ›Alterskohorten‹ wechselndes kollektives Gesicht in der Kunst. Wer, wie die meisten Bewohner der Warenkultur, mit ihr nichts im Sinn hat, ist bereit und willens, in ihnen Therapiegründe zu sehen – worin die Gesellschaft ihn unterstützt. Als Motivbereiche des politischen Handelns sind sie weit weniger gefragt – Politik ist mutig, Politik ist aufgeklärt, Politik gestaltet ›Zukunft‹. Der etwas lauter gestellte Ton, der niemanden überzeugt, verbannt die Todesmotivik zuverlässig in den Bereich der Obsessionen. Kein Zweifel, dort gehört sie hin, dort verrichtet sie ihr Werk. Die zahllosen Mordgeschichten, die sich ein großer Teil der Bevölkerung allabendlich zuführt, verdichten sich zum Krimi des Lebens, der die Illusion des ›was tun‹ in den Feierabend hinein verlängert. Vielleicht bereitet sich in den primären Motivlagen derer, die sich heute, an welchen Stränden auch immer, darauf vorbereiten, in der Gesellschaft ›Verantwortung zu übernehmen‹, ein erbitterter Widerstand gegen die religiös abgesicherte moderne Geriatrie vor, der die Welt in Erstaunen und vielleicht Schrecken versetzen wird, sobald seine Zeit gekommen ist. Dieser Schrecken ist das Erstaunliche: vorbereitet durch das, was alle schon immer empfunden und ›gedacht‹ haben, ohne es zu durchdenken, heftet er sich an die Kursschwankungen des öffentlichen Bewusstseins. Von Analysten längst vorweggenommen, ist ihr Eintreten, wie immer, die Sensation. Die Zugehörigkeit zu einer Generation verrät sich in der Gleichförmigkeit der Obsessionen.
4.
Zurück im Bauch der Geschichte. Ungefähr ein Jahrzehnt nach dem Aufbegehren gegen das repressive Universum menschlichen Handelns, das damals Gesamtgesellschaft hieß, griff der weiterhin aktive Teil der Protestgeneration, unterstützt von jüngeren Jahrgängen, die noch nicht wussten, welche Lebensläufe die Alterskohorte für sie bereithielt, zu den Brecheisen, um gegen das zu Felde zu ziehen, was damals friedliche Nutzung der Kernenergie hieß. Es war das erste Mal, dass Tod, abseits von Kriegsgegnerschaft, als soziales Unrecht deklariert wurde. Die Hätschelkinder der Revolte, jenseits der magischen Dreißig angekommen, sahen in ihm die jüngste und unheimlichste Gemeinheit der Gesellschaft. Zu Recht, wenn man Lebensgeschichte als Abfolge von Angstzuständen dekliniert: die deutsche Angst, kein Exportschlager, aber ein ›Diskussionsgegenstand‹, eine öffentliche Sache, legte das Risiko auf die Fußmatte der Gesellschaft und bat die robuster konstituierten Zeitgenossen, sich seiner anzunehmen. Wenn der Begriff der Generation einen Sinn hat, so hier: sie war es, die so dachte, nicht ihre Außenseiter. Die Zumutung des Todes, der Tod als Zumutung, der Wunsch nach dem hier und jetzt durch Gewissheit verdoppelten Leben, der Unglaube daran, dass die frisch in die Geschichtsbücher eingewanderte, die eigene Kindheit säumende Vernichtungsorgie wirklich vorbei sei, dass alles seine Richtigkeit habe, erzwang diese Abfolge von Schritten. Damals erwarb der Westen des geteilten Landes ›in der Mitte Europas‹ seine Kultur: die Kultur der Gesellschaft, einen ebenso starren wie eigensinnigen Schematismus, der reflexhaft Veränderung ›einfordert‹ – eine seltsame Vokabel, deren Nachbarschaft zum Einbestellen und Einbestelltwerden auf der Hand liegt und vergessene Obsessionen anzeigt.
5.
Man sollte sich anhalten, nicht nur den Protest zu verstehen, sondern auch die, die auf ihn sehen – mit gemischten Gefühlen. Wer ein wenig älter, ein wenig jünger ist, wer die magischen Daten verpasst hat, er darf sich anschließen, er bleibt ein Leben lang Schüler – ein unwürdiges Leben, ein ausgedehntes second hand-Denken, das, stolz auf seinen erworbenen Realitätssinn, auf die Alt-Achtundsechziger herunterblickt, als befinde sich unter den eigenen Vorfahren ein Neandertaler. Wir haben gelernt und Wir haben das gemacht: realitätshalte Phrasen, in denen sich die seinerzeit schon auf Karriere erpichten vorausgegangenen Jahrgänge mit den Folgejahrgängen treffen. Das elende Wir verbirgt den Makel der unzeitigen Geburt. Es ist der Kern dessen, was die Rede von Gesellschaft seither mitzuteilen nicht aufgehört hat: dass alles veränderbar sei, dass es keine Individuen gebe, dass die entscheidende Grenze nicht zwischen dem Verfügbaren und dem Unverfügbaren, sondern zwischen dem Verhandelbaren und dem Unverhandelbaren verlaufe, wobei das Unverhandelbare in der Überzeugung der Zugehörigkeit zur Zukunftsfraktion fixiert ist, also in der wohlbekannten Mischung aus Konformismus, Feigheit und Unverfrorenheit, die in etwa durch das Wort ›Steuerungskompetenz‹ umrissen wird. Die Kompetenzvokabel, zähestes Relikt aus den stürmischen Jahre, meint, wie bekannt, das, womit einer auftrumpfen kann – das Unheimliche daran, weithin umempfunden, liegt in der Eigenschaft, die Anmaßung von weit gestreuten Gruppen und Grüppchen unsichtbar zu machen, die sich im Menschheitsprojekt zusammenfinden.
6.
Repräsentanten eines knapp fünfunddreißig Jahre alten Staatswesens, errichtet auf den Ruinen eines in Mord- und Feuerstürmen untergangenen Reichs, sahen in atomaren Zerfallszeiten von Jahrtausenden kein nennenswertes sicherheitstechnisches oder -politisches Problem. Unfassbar, könnte man aus sicherer historischer Distanz meinen. Aber sie fanden sich darin bestärkt durch die Haltung der auswärtigen Kollegen, mit denen sie ihre Entschlüsse abstimmten und die auch nichts sahen, es sei denn das Mysterium der Gegenwart, mit dem wir uns alle abfinden müssen. Auch das musste man erst einmal sehen – man hat den Beobachter zweiten Grades, eine Schlichtfigur, aus diesem entsetzten Sehen heraus inthronisiert, im Insignienschmuck aller erdenklichen Art, zwischen denen er es sich dann auch bequem gemacht hat, ein zweiter Kobes vom Rhein. Selbstverständlich konnte, wer wollte, in der Politik der ›Kernkraft‹ den Willen zur Errichtung neuer tausendjähriger Reiche erblicken. Aber der technologische Run, wie das damals hieß, ein entgrenzter Rüstungswettlauf, gespeist aus der Furcht vor Fronteinbrüchen, aus hypertropher Verantwortung, untermischt mit Verratsängsten, und einer Haltung, die im Bundestag nach der Wiedervereinigung sich in der bebend gesprochenen Mahnung »Nie mehr allein!« entlud, liefert doch die bessere Erklärung. Gegen eine tödlich gewordene Obrigkeit hilft nur Beratung. Der Protest, der sich, offenbar gewittergleich, an den Haltezäunen und Polizeischilden ›entlädt‹, schafft die Zonen der Ratlosigkeit, eine tabula rasa der Macht, in denen die Suada des Damit-Umgehens eine Reihe jener Hybridwesen erzeugt, von denen in den Schriften Bruno Latours die Rede ist: Probleme, in den Stand von Akteuren gehoben, die mit am Tisch sitzen, derweil ihre anfangs unkrawattierten menschlichen Repräsentanten noch unverhohlen als nicht machtfähig betrachtet werden – selbst als sie bereits Ministerämter bekleiden und sich in Dienstlimousinen durch die Gegend kutschieren lassen.
7.
Der Staat, den Thomas Hobbes den sterblichen Gott nannte, hat den ›Tod‹ des unsterblichen überlebt. Man nennt das, mit jener Schmallippigkeit, die Intelligenz gern unter Zeitgenossen zur Schau trägt, einen ›bemerkenswerten Vorgang‹. Was daran bemerkenswert ist, wäre Grund für eine lange Erregung, wenn es so etwas im Prozesswesen der Historie gäbe. Stattdessen warten sie alle auf ihre Stunde: der scheintote Gott und der quicklebendige, der beerbte Gott und der andere, dem das Erbe langsam, aber sicher über den Kopf wächst. Das hat Zeit. Der Staat stirbt nicht, er arrangiert sich in Übergängen. Der Preis dafür wurde vor langer Zeit entrichtet. Heute ist der Staat kein Individuum mehr, er existiert als eine Mehrzahl von Staaten, die sich gegenseitig ununterbrochen durchdringen, aufsaugen, addieren und multiplizieren. Zu den Geburtshelfern dieser neuen Identität gehört die Idee des Weltstaats, gehört die Idee der souveränen, durch Zusammenarbeit geeinten Nationen – beide auf unterschiedliche Weise obsolet, rapide alternde Diener einer Wirklichkeit, die sich ihrer im Entstehen bediente. Gewöhnlich versteht man die Dekomposition des souveränen Einzelstaates, die man auf den ›relevanten Feldern‹ – Recht, Wirtschaft, Kultur – diagnostiziert hat, als Bewegung hin zu neuen ›supranationalen staatsähnlichen Gebilden‹. Aber sie repräsentiert nicht bloß eine Bewegung, sondern ebensosehr einen Zustand – die Weise, in der sich Gegenwart organisiert. Gegenwart meint hier nicht die Momentaufnahme, den synchronen Schnitt durch eine ständig im Fluss befindliche ›Welt‹, sondern den Zeit-Raum, in dem sich reale Menschen in ihren realen Handlungen orientieren. Dieser Zeit-Raum besitzt eine gewisse, durch Jahreszahlen und Eckdaten nicht oder kaum zu erfassende Erstreckung. Ein ausschließlich auf Dynamik und Fluchtpunkte in der Zukunft fixiertes Denken konsumiert diese Erstreckung, es verschluckt sie, als gäbe es sie nicht oder nur als eine Art Zielgerade von Entwicklungen. Der Staat der Gegenwart ist nicht in den vielfältigen Dekompositionen zu finden, auch nicht in der Doppelbewegung aus De- und Rekomposition, wie sie der patriotische Autor für ›sein‹ Amerika reklamiert, sondern in seiner Multiplizität. Kein Staat ist vollständig – dieser Satz gilt ebensosehr wie der gegenläufige: Jeder Staat ist vollständig. Beide gelten nicht nebeneinander oder gleichzeitig (die Zeit ist hier nicht gefragt), sondern in einem. Nicht das Staatensystem, sondern das systemische, sich in Überschneidungen, Überlagerungen, Rupturen, Frakturen bezeugende Gebilde, das alle staatlichen Funktionen vereint und staatenweise ausspielt, ist die Wirklichkeit des gegenwärtigen Staates.
8.
Hier entstehen auch diese Aussonderungen, die ein kleiner, jedoch beachtlicher Teil der Bevölkerungen als Sinnbilder der wiederhergestellten, allgegenwärtigen, anonymen Gefahr versteht und gegen die er, ganz im Sinne Hobbes', das Recht auf mechanische Gegenwehr in Anspruch nimmt: metatechnologische Implantate, eingesponnen in einen Kokon sozialtechnologischer Neuerungen, die sie absichern und ihrerseits abgesichert werden müssen. Ihre erste Generation waren, jedenfalls im zivilen Bereich, die AKWs. Sie bekamen den unverminderten Schock ab, der angesichts dessen, was nachkommt, zur latenten, von Fall zu Fall aufflammenden Hysterie verflacht. Wie Technik und Massengesellschaft, so gehören Metatechnologie und Zivilgesellschaft zusammen. Die Zivilgesellschaft erscheint aus diesem Blickwinkel als spontane Antwort der Bevölkerungen auf die Herausforderung der Metatechnologie. Aber sie ist auch ein Teil des Kokons, den die Politik um sie legt. Zivilgesellschaft ist zivile Politik. Ihre Geburt zwischen Pflastersteinen, Wasserwerfern und Schlagstöcken hat den Nimbus des Ungehorsams und des lässig gewaltfreien Widerstands erzeugt, der sie noch immer umgibt. Das nimmt einen wunder, denn es entspricht nicht den Realitäten. Die Zivilgesellschaft ist ein Aspekt gegenwärtiger Herrschaft. Ein gehöriger Aspekt, will dem Betrachter scheinen, der, ein neuer Ödipus auf dem Weg nach Theben, sich dieser Sphinx konfrontiert sieht.
9.
Emblem der Baukunst: der beflügelte Mensch. Aber, liebe Mitbürger und -innen, nur Engeln wachsen die Flügel am Rücken. Menschen tragen ihre, wie jedermann weiß, an den Füßen. Ob und wann sie sie an- oder ablegen, das steht (fast) in ihrem Belieben. Hin und wieder sieht man sie auf barocken Bildern, darunter den Schriftzug ›fastina lente‹ – Eile mit Weile. Was als Parole unter Taubenzüchtern durchgehen könnte, besitzt seinen guten Sinn. Der beflügelte Mensch ist nicht der eilige, eher der schreitende (ein seltsames, dem Hohn überantwortetes Wort von archaischer Anmutung wie ›Gewand‹, ›Gebärde‹ oder ›Haupt‹). Schreiten ist Bewegung in gut dimensionierten, gut umbauten Räumen – ob drinnen oder draußen, tut nichts zur Sache. Man kann es auch lernen, dann ist man ein runSchauspieler, der die Welt zur Bühne seiner Auftritte macht. Im Alltag bevorzugt man den stockenden und den hastenden Gang. Auch er legt etwas nahe, eine Haltung oder besser Nichthaltung, eine Weise des Sich-Durchschlagens, die man Verzicht auf Stolz nennen könnte. Kein Zweifel, damit kommt er Leuten entgegen, die ihr Päckchen zu tragen haben und es ohne weitere Umstände dem Nebenmenschen ins Gesicht knallen, wenn etwas ihre Aufmerksamkeit ablenkt. Er kommt ihnen entgegen und er verengt ihre Perspektive zu der, die gilt, die zählt, die sich durchsetzt. Die kleinen Rempeleien, die knapp vermiedenen Zusammenstöße, die unvollendete anonyme Arschigkeit, das alles ist, bevor es losgeht, gebaut. Es geht auch weiter. Traditionsreiche Städte verengen ihre Bürgersteige willkürlich durch hämisch darübergepinselte Radwege, die wie geschaffen wirken, der Welt eine weitere natürliche Feindschaft zu bescheren. Eine im voraus kompromittierte Verkehrsplanung mixt aus den auseinander strebenden Bedürfnissen von Anwohnern, Kneipenbesitzern, Laufpublikum, Durchgangsverkehr einen Parcours, in dem alles einen Zweck hat, das heißt, viele Nebeneffekte, über die man besser schweigt. Was auch sonst? Die Menge bahnt ihren Weg und setzt ihn bei leichtem Nieselregen fort. Stoßt euch, ihr Leute, nur zu! Nur so kommt ihr zu einem Urteil. Es muss ja kein abschließendes sein.
10.
Ab in den Tempel, der alle Blicke unter der Kuppel eint und tiefe Blicke in die unteren Stockwerke erlaubt, Bahnhofsblicke, am intensivsten werfbar vielleicht am Berliner Hauptbahnhof. Aber Beeilung! Weggerempelt wird man auch hier. Das geht in Ordnung, denn ein leerer Funktionstempel wirft Fragen nach der Rendite auf. Die Ästhetik der aufgeschnittenen Stockwerke demonstriert etwas, sie reproduziert eine Ebene der Sichtbarkeit, die man von den aufgerissenen Fassaden zerbombter Städte oder vom Abriss kennt, sie wiederholt etwas, um das man weiß, ohne hinzusehen, das man auch dann nicht sieht, wenn man es gezeigt bekommt, weil es, nur gesehen, trivial bleibt. Der simulierte Schnitt durch die Funktionsebenen der Gesellschaft versetzt Hinz und Kunz in einen Rausch des Verstehens und in den Stand des Beobachters zweiten Grades. Ungewiss bleibt, ob es sich um den Stand der Gnade oder die Sprosse auf einer Karriereleiter handelt. Man sieht aber nichts, die Sache bleibt Theorie. Für den, der weiß, Theorie zweiten Grades, die kurz ist, jedoch die unendliche Melodie der Romantiker in Alltagsbeobachtung übersetzt. Gäbe es einen Abgrund, dann zeigte sich die Gesellschaft an seiner Stelle. Es gibt aber keinen, es bedarf seiner nicht, der Konstruktivismus überwölbt keine Abgründe, er verschmäht das ex nihilo, er ist, wie er denkt, immer schon bei der Sache. Was er damit meint? Dass Menschen Exkremente ausscheiden, Kinder kriegen, Büffel jagen und Kriege führen, hat sie, verteilt über lange Zeiträume, zu Einsichten geführt, die sich, wie bekannt, von Wahnvorstellungen nur schwer sondern lassen. Der konstruktivistische Wahn... das Glasperlenspiel des radikalen Konstruktivismus besteht darin, mit der Funktion einzusetzen, statt die Einsetzung der Funktion zu sehen – eine Verwechslung, in Grenzen vergleichbar der des Sakralen und Profanen oder, in der Sprache des achtzehnten Jahrhunderts, von Vernunft und Verstand. Man kann die Funktion nicht funktionalistisch erklären, allenfalls ›deuten‹, man setzt ein, man konsekriert und delegiert, man generiert, man analogisiert, man sieht und man weiß, aber man erklärt nichts. Wer weiß, wo's langgeht, hat sich bereits verabschiedet. Wer ihm den Rucksack neidet, ist auch ein Tourist.
11.
Die Soziologie ist saturiert. Das klingt wie: »Der Markt für Seifenartikel ist gesättigt«, und ist auch ähnlich gemeint. Solche Sätze werden in die Welt hinein gesprochen, sie besitzen keinen exklusiven Geltungsbereich, sondern vertrauen auf die Einstimmung von Leuten, denen die eigene Erfahrung ähnliches sagt. Das macht sie nicht weniger ›anschlussfähig‹, im Gegenteil – auch wer die Einstimmung verweigert, wird von ihnen gestreift. Schon manches Spiel wurde vergessen, nachdem es sich durchgesetzt hatte, oder es musste sich radikale Neuordnungen gefallen lassen. Also, zum zweiten Mal: Die Soziologie ist saturiert. Ihre Sprache, ihre Leitvorstellungen haben die Alltagskultur erobert, sie besitzen Herrschaftsfunktion. Dafür nimmt sie Banalisierungen gern in Kauf – zu Recht, denn als Wissenschaft ist sie ›kurz‹ geblieben, die Götter sind fixiert, der Problemdruck ist gering. Sie hofft auf Einfälle, perspektivische Einstreuungen, die es erlauben, das intime Mobiliar, von dem Weber einst so verächtlich redete, ein wenig zu verrücken. Sie ist angekommen, diese Wissenschaft, sie braucht keine Propheten, ihr genügen die Schultern der Vorgänger, auf denen sie steht und die Backen bläst. Währenddessen verblasst ihr Gegenstand, die Gesellschaft. Was Kritiker gelegentlich argwöhnten, aber nur in die Sprache des Ressentiments kleiden konnten, geschieht mit einer Nonchalance, die einem den Atem raubt, hat man sich erst einmal zur Wahrnehmung entschlossen. Der durchgesetzte Funktionalismus erzeugt sein Gegenteil, was immer es sei. Hass, Unglauben, Versagen: im Namen dieser ungöttlichen Dreifaltigkeit geschieht viel, das meiste von dem, worauf sich die Aufmerksamkeit der Menschen fokussiert. Es steht im Mittelpunkt des Beredens, von dem Wissenschaftler oft leichtfertig glauben, es gehorche dem Vorurteil. Aber auch das Vorurteil bleibt ein Konstrukt, dessen man sich ohne Vorurteil annehmen sollte.
12.
Der lange Gang der Sprache ist ein Entwerter. Wörter, die Ansehen und Bedeutsamkeit signalisieren, steigen ab, trivialisieren sich, nehmen ärgerliche, lustige oder obszöne Bedeutungen an. Andere, oft aus anderen Sprachen zugewanderte Wörter treten an ihre Stelle, ohne sie exakt zu ersetzen, und geraten früher oder später in eine analoge Spirale. Wörter, sagt man, sind Indikatoren sozialer Prozesse. Wenn ganze Wortgruppen absinken, vor allem solche, die eng mit den sozialen Fakten, mit habitualisierten Schätzungen und geltenden Werten verbunden sind, dann deshalb, weil die Schichten oder Gruppen absteigen, bedeutungslos werden, in neue Funktionszusammenhänge einrücken oder sich auflösen, über deren Lebensweise und Selbstwertgefühl sie Auskunft geben. – »Na und?« – Beispiel: Stolz. Ausdrücke, die Stolz signalisieren, stehen nicht hoch im Kurs. Ironie und Geringschätzung stigmatisieren ihren Gebrauch. Der unverhüllte Ausdruck von Stolz gilt als roh, als ›unzivilisiert‹, als ›Natur‹, weshalb er sich vermutlich auch im sexuellen Bereich so hartnäckig hält, wo dieses Produkt gefragt ist. Das Geschlechterverhältnis, so könnte man schließen, bringt ihn in jeder Generation neu hervor, die Demütigungen, die es bereithält, treiben ihn in andere Regionen wie die der Nation, der Religion, des Profits. Doch darin steckt, wie in manchem, ein Geheimnis. Der verdeckte Stolz ist der wirksamste, aber er selbst verdeckt etwas anderes. Er deckt eine Stelle, die man gelegentlich als ›Wunde‹ tituliert findet oder als ›verwundbar‹. Das mag zutreffen, erklärt jedoch wenig, vor allem dann, wenn das Schreckenswort ›Selbstwertgefühl‹ alle weitere Überlegung verbietet. Die unsichtbare Wunde der Scham, die, glaubt man ethnologischen Untersuchungen, sich in jedem Wesen herstellt, das, wie immer, ›Mensch‹ genannt wird, lenkt die Blicke des Anderen wie ein Schild die Pfeile des Gegners in alle möglichen Richtungen. Scham ist reine Korrespondenz, sie springt über – falls nicht, wird es unmenschlich. Der Stolz, so könnte man schließen, entsteht, er entspringt als inner- und zwischenmenschlicher Ausdruck des Vertrauens in die Wirksamkeit der Korrespondenz. Damit verschiebt sich die Frage auf die Bedeutung, die das Wort ›Ausdruck‹ an dieser Stelle besitzt. Das sich ausdrückende, das Zeichen setzende Wesen, das Symboltier Mensch ist, wie alle zu wissen glauben, das soziale. Auch der Ausdruck von Stolz gilt innerhalb dieses Wissens als Zeichen der Sozialität oder Soziabilität – einer sehr weit gefassten, auf die leere Beziehung, die beziehungslose Beziehung zwischen Menschen reduzierten ›Gesellschaftsfähigkeit‹. Was leistet dann, rein gesellschaftlich, der Verzicht auf Stolz?
13.
Verzicht auf Stolz ist die Formel für ein Leben im Vortod. Eine Formel... die selten gebraucht wird, weil sie thematisiert, was nicht zur Disposition steht, es sei denn im Gebrüll der Fußballarenen oder auf fahnenseligen Kirchentagen. Auch der Vortod, eine Lebensverfassung des Einzelnen, die jedem Kenner der Literatur wohl vertraut ist, wird selten thematisiert. Die gewöhnlichen Interpreten sehen in ihm ein Motiv, womit man wenig mehr ausdrückt als: das gibt es – in der Literatur, oder besser: in Literatur und Kunst. Damit ist alles gesagt. Der unsichtbare Vortod ist ein Leben in Erwartung des Endes, irgendeines Endes, des Endes von nichts Besonderem, dieses Planeten zum Beispiel, oder, kleiner, privater, dieser Beziehung, dieser Alten, dieser Regierung, dieser Gesellschaft, der ganzen gegenwärtigen Komplexion aus Personen, Autos, Ferienreisen und Sex. »In fünfzig Jahren ist das alles vorbei«: eine Sentenz aus dem Mund von Leuten, die, wissend oder nicht, den Stechlin geben und dabei vorsichtig das pauschal avisierte Ende auf einen Zeitpunkt verlegen, den einer, statistisch gesehen, nicht mehr erlebt. Warum auch? »Darauf kann ich verzichten.« Und er hat recht. Wer vieles miterlebt hat, der redet so. Anderen reicht das lebenslängliche mediale Dabeigewesensein. Nur der verbale Ausdruck verschiebt sich um Nuancen, denn die Verzichtrede wird durch die Medien – ein Euphemismus fürs allgegenwärtige Fernsehen mitsamt seinen publizistischen Satelliten – nicht trainiert, sondern ebenfalls der Geringschätzung überantwortet. Was immer enden wird; man ist entschlossen, keinerlei Aufhebens davon zu machen. Man ist entschlossen...
14.
Blättert man ein paar Generationen zurück, so konnte das Überleben der Gattung den Einzelnen über seine Vergänglichkeit trösten: man reibt sich die Augen, wenn man derlei liest. Auch die Untröstlichkeit ist vergangen, sie ist dem Trost nachgeschwunden, als müsse sie ihn in seinem Jenseits trösten. Untröstlich ist keiner, Trost wird denen gespendet, die nicht ganz bei Trost sind – Tieren, kleinen Kindern und Zurückgebliebenen, was immer letzteres bedeuten mag. Das ist merkwürdig oder sollte es sein; ein Menschheitsaffekt und eine Menschheitsgebärde verlieren sich nicht innerhalb weniger Jahrzehnte aus dem Leben der Menschen, als hätten sie nichts zu besagen oder als sei man jetzt weiter. Dieses Weiter sein ist das Problem. Es gehört wohl zu den neueren Antinomien des Verstandes – oder des Verständigseins, das in den meisten Fällen auf ein Verständigtsein hinausläuft –, dass die Überzeugung, einer irreversiblen Entwicklung, genauer: Konversion zu unterliegen, beständig von der gleich starken Überzeugung durchkreuzt und zeitweilig außer Kraft gesetzt wird, diese ganze Moderne sei nur als eine winzige Delle in einer tieferen und weiter reichenden Menschheitsgeschichte anzusehen und zu verstehen. Naturgemäß gehen die Ansichten darüber, worin ›diese ganze Moderne‹ besteht, weit auseinander. Nimmt man den Trost als Maßstab, so ist die Moderne samt ihren Ex- und Postkonstruktionen die trostlose Zeit – die Zeit, der der Trost abhanden gekommen ist. Statt in Untröstlichkeit zu verfallen, machen die Menschen das Beste daraus. Dieses Beste, das eigentümlichste Produkt einer produktionsintensiven Kultur, bietet den Trost, den kein Trost zu bieten vermag, den Trost nach dem Trost, das Glitzerding, mit dem sich Kinder und Konsumenten trösten. Wer sein Bestes gibt, dem widerfährt nur das Beste. Das Beste ist das trostlose Selbst als Widerfahrnis. Die perfekte Frau existiert nur im Spiegel. Wer ihn häufiger konsultiert, kommuniziert öfter mit dem, was ihm fehlt. Unfassbar, aber ›stark‹: die Verschmelzung.
15.
»Das Stereotype, diese ekelerregende Unmöglichkeit zu sterben.« (Roland Barthes) Warum empfinden theoretische Menschen das Einerlei als Verhängnis? Das Einerlei, jeder weiß es, trägt die Spuren des Glücks, wer daran streift, bekommt soviel ab, wie ihm zuträglich ist. Im Einerlei findet sich die Menschheit, die anthropologische Konstante, das Menschsein, wie es sich ausdrückt: ob als Zahnpastatube oder als Aknepustel, das zu bedenken bleibt jedem selbst überlassen. Das Immergleiche stammt aus der seriellen Einbildungskraft, die sich am Einerlei gesättigt hat. Es kommt nichts Neues dabei heraus. Wie sollte es auch? Das Neue, in dessen Namen einer tätig wird, gibt es nicht, wird es nie geben: es ist im voraus entwertet. Erst der neue Mensch, jeder weiß es und schaudert davor zurück, ist der serielle; der Mensch ist, wie er ist. Die Prozedur des allmorgendlichen sich Erhebens, Waschens, Ankleidens, Frühstückens, die tägliche Komödie der Auferstehung, wie Cioran sie nennt, zieht ihre tödliche – soll heißen: nicht-tödliche – Langeweile aus dem Bewusstsein, mit dem, was kommt, durch zu sein. Die Einklammerung dessen, was kommt, setzt die Vorstellung von einer anderen Zukunft voraus. Diese Vorstellung kann leer sein, sie kann aus lauter revolutionärem Unsinn bestehen, sie kann sich, wie beim Mystiker, der an den Folgen seines Rausches leidet, unverblümt aufs Jenseits richten, das alles macht keinen Unterschied. Wichtig ist nur, dass gerade das nicht zählt, was mit Sicherheit kommt. Manche nennen es eine Hölle – pikantermaßen, denn eine Hölle ohne den Wunsch, in den Himmel entrückt zu werden, ist keine. Auf dem Grund des revolutionären Begehrens, das in der Wirklichkeit keine Angriffsfläche findet, liegt der Wunsch nach Entrückung – das Eingehenwollen ins Bild, ins lebende Bild, dessen Leben dem Tod nahe steht, ist die Rache der verschmähten – und geschmähten – Kunst, die ungerührt das Einerlei bannt.
16.
Ein zu waches Bewusstsein der Ohnmacht, die jeder Macht innewohnt, ein überbordendes Misstrauen in das Beharrungsvermögen jeglicher ›Zustände‹, in die Findigkeit der Alltagsakteure, sich den Gegebenheiten anzupassen, um weiter ihr Spiel zu spielen, in die autopoietischen Fähigkeiten der ›Systeme‹, das realer ist als jeder politischer Wille, zieht sich durch die Äußerungen der totalitären Diktatoren und die von ihnen – direkt oder indirekt – veranlassten Maßnahmen. Jeder Terror reibt sich auf. Die Ohnmacht der Ideologen gegenüber den Wirklichkeiten und ›Mächten‹ treibt sie zum Äußersten. Worin dieses Äußerste besteht, bleibt solange ihr Geheimnis, bis sie es durch die Tat enthüllen. Es soll die Welt verblüffen – wodurch sonst als durch die Kühnheit der Überschreitung, durch die Furchtlosigkeit im Freveln, durch die Gnadenlosigkeit in der Verfolgung von Zielen und Menschen, durch neue Maxima der Gleichgültigkeit gegenüber dem menschlichen Glücksverlangen, also lauter Drohungen an die Adresse derer, die bereits unterwegs sind, ihnen das Handwerk zu legen. Dass die Abgesandten der wirklichen Mächte bereits unterwegs sind, dass sie unaufhaltsam unterwegs sind, gehört zu den mentalen Voraussetzungen der Terreur und ist aus dem Bonapartismus nicht fortzudenken, wieviel weniger aus den weit hemmungsloser sich am religiösen Bewusstsein mästenden Revolutionsregimen des zwanzigsten Jahrhunderts. Das Übergewicht des Irregulären, das reguläre Züge annimmt, um das Gewicht der Macht bis zur völligen Gefügigkeit der Beherrschten zu steigern, ist ohne den religiösen Begriff des Frevels nicht zu verstehen. Ebenso wenig, ist die maßlose Macht erst einmal gebrochen, die Gegenbewegung der Involvierten. Maßlos wie der Frevel ist auch die Sühne, die sich ihrerseits zum Frevel steigern kann. Auch die Sühne muss, wie der Frevel, auf den sie folgt, um der Menschlichkeit willen gebrochen werden – am besten abgebrochen von denen, die sich ihr frenetisch verschrieben haben.
17.
Zu den primären und nur wohl dosiert zu bewältigenden Exerzitien der legitimen Macht gehört auch, die Bürger an der langen Leine laufen zu lassen. Kaum etwas charakterisiert sie daher besser als der Verzicht auf die Todesstrafe, nichts hebt ihre Bedeutung als Widerlager der Gesellschaft deutlicher ins Bewusstsein als die Zahl der Befürworter der Todesstrafe. Der von den Bürgern erzwungene Verzicht auf den Verzicht bezeichnet ein europäischen Eliten noch immer unbegreifliches Übergewicht an Demokratie und erinnert daran, dass auch die legitimste Macht ein illegitimes Moment besitzt. Die legitime Macht begegnet dem dadurch, dass sie ihre Hobbessche Funktion als Garant des Lebens auffällig-unauffällig verstärkt. Die maßlose – und gehässige – Rede von der Biopolitik als einem Grundzug – vielleicht sogar der Grundlage – des modernen Staates spießt diese Wechselbeziehung auf. Nicht ohne Grund – der revolutionspathologisch motivierte Krieg gegen das Bestehende, also jede Form von Legitimität, findet in der humanitären Rechtfertigung des Staates seinen schwierigsten Gegner. Das Wort von der ›Biopolitik‹ soll sie verbal zum Verschwinden bringen; der Gleichung ›legitim = illegitim‹ entspricht die Gleichung ›humanitär = inhuman‹. Für derlei Wortspiele ist der volkshygienisch motivierte Genozid natürlich ein gefundenes Fressen und es macht keinen Unterschied, dass die Hygienerede hier selbst bereits bloße Metapher ist, ein Missbrauch der Sprache wie des Vorstellungsvermögens der Leute, ein Instrument der Propaganda und der ideologischen Selbstberieselung ›überzeugter‹ Mörder. »Leben machen und sterben lassen« – ganz so ist es nicht. Die Bereitstellung einer medizinisch-hygienischen Infrastruktur zählt zu den ›Gemeinschaftsaufgaben‹ wie der Eisenbahn- oder Autobahnbau, die Versorgung mit Wasser, Strom und Information, die ganze Vielzahl täglich in Anspruch genommener Dienste, die das ›Leben‹ in mancherlei Hinsicht angenehm machen und sein Erscheinungsbild – manche meinen: irreversibel – verändern. Sie alle können auch privatisiert werden, sobald private Gesellschaften über genügend logistische und finanzielle Fähigkeiten verfügen. Die Frage, um welcher Ziele oder Werte willen ein solcher Staat seine Bürger in den Tod schickt, bleibt davon völlig unberührt. Das Leben im ›Komfort‹ hat mit dem Gegensatz Leben – Tod so viel oder so wenig zu tun wie der totalisierende Staat mit dem totalitären. Keine Macht ist ganz legitim und jede Macht beunruhigt, das gehört selbst zu den beunruhigend banalen Tatsachen wie die, dass kein Mensch einfach böse ist und die Rede vom ›Unmenschen‹ zwangsläufig auf den zurückschlägt, der sie im Munde führt. Kein Wunder, dass unter eingefleischten Theoretikern der Gesellschaft der Verzicht auf den menschlichen Faktor in der Regel zu den glücklichen Griffen zählt.
18.
Sensibilität, Gespür für das Unterschwellige, Kommende sind Formen der flackernden Intelligenz – einer Intelligenz, die sich ausliefert an das, was vorgeht. An ihr haftet der Geschmack der Moderne, jeder Moderne. Etwas Ignoranz darf dabei sein, ist stets dabei. Moderne ist eine Kategorie, die der Ignoranz auf Seiten derer bedarf, die sie auslegen. ›Ein moderner Ignorant‹ – das klingt wie der Titel einer abgestandenen Boulevard-Komödie, gleich dahinter kommt, bereits etwas schärfer, die ›Arroganz der Moderne‹, gefolgt von den ›mörderischen Tendenzen‹. Die Ignoranz der Moderne ist aggressiv, das kulturelle Vergessen, das sie verlangt, besitzt programmatische Qualität, es ist eine Frage des Willens, es muss durchgesetzt werden. Vor den physischen Sperrzonen stehen die geistigen, die auch dann bleiben, wenn die ersteren weggeräumt sind. Der Ursprung jeder Moderne ist ein kulturelles Tabu. Gleich, ob ›wir‹ uns entschließen, der dritten, vierten oder fünften Moderne, der Moderne danach oder der Moderne davor zu opfern – es wäre nicht schlecht, das Tabu aufzuscheuchen, nach dem es ›uns‹ und unseresgleichen dabei verlangt. Manche versuchen das Thema zu umgehen, sie beginnen bei dem Wort ›Moderne‹ zu fuchteln, als handle es sich um einen eingefressenen Irrtum, der sich mit Stumpf und Stiel ausrotten ließe, sie träumen davon, ein zweites Mal Herkules am Scheideweg spielen zu dürfen und den anderen Weg einzuschlagen. Das ist naiv und verrät einen Willen zum Handlangertum, der zeigt, wie dürftig das intellektuelle Geschäft bisweilen sein kann. Keine Moderne ist bloß ein Irrtum, auch kein ›gnostischer‹, wie mancher mit Voegelin meinte, das ›Wissen‹ der Modernen, ihre spezifischen Weisen, sich im Besitz des Wissens zu wähnen, ihr Wahn, der die Welt verändert, schafft Realitäten, aus denen sich niemand herausziehen kann – eine Tatsache, die durch die spezifische Form des modernen Exils zwar verdunkelt, aber nicht ausradiert werden kann. Wer ins Exil geht, hält nicht die Vergangenheit fest, sondern wechselt in eine andere Gegenwart, in eine andere Dynamik, in eine andere Variante des bitteren Spiels, das Moderne heißt, seit das Wort ›Fortschritt‹ den Leuten auf der Zunge verfault. Die moderne Welt ist die schöne – aus keinem anderen Grund wird sie von ihren ohnmächtigen Verächtern oder ernüchterten Bewohnern als hässlich geschmäht. Wäre sie doch nur schöner: so, wie sie ist, ist sie doch ganz die alte, obwohl sich in ihr alles verschoben hat und weiter verschiebt.