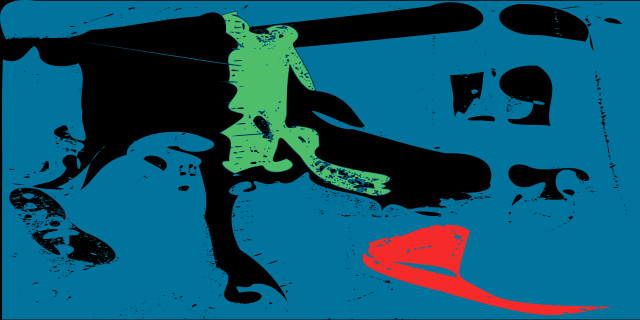von Heinz Theisen
Die Unterscheidung nach West-, Mittel- und Osteuropa ist zu Unrecht aus der Mode gekommen. Mit dem Einheitsbegriff ›Europa‹ werden aber vielfältige kulturhistorisch gewachsene und geografische Unterschiede verwischt.
Die stärkste unterschiedliche Prägung liegt heute darin, dass die ost- und mitteleuropäischen Länder jahrzehntelang von der kommunistischen Utopie beherrscht worden sind. Sie stehen daher utopischen Visionen weitaus ablehnender gegenüber als der nach einer langen Phase des Wohlstandes übermütig werdende Westen. Sie haben keinen Bedarf mehr, Realität und gesunden Menschenverstand wolkigen oder wokigen Phantasien zu opfern.
- Details
- Geschrieben von: Theisen Heinz
- Rubrik: Gesellschaft
von Immo Sennewald
Wenn Menschen massenhaft Feindbilder übernehmen sollen, erreichen Propagandisten einer höheren Moral – egal welcher Religion oder sonstiger Ideologie – dies nur, indem sie einer hinreichend großen Zahl von Individuen Teilhabe an kollektiver Macht, an kollektivem Nutzen versprechen. Die Nazis gaben ihren Mitläufern zahllose Dienstränge und Ehrenzeichen, Kommunisten verhießen das Reich der leistungslosen Anspruchsberechtigung, das Paradies auf Erden statt im Jenseits. Zugleich zeigten sie ihren Anhängern, bei wem sie sich ihre Reichtümer, ihre Wohlfahrt holen konnten. Die Grundimpulse des Erlangens und Vermeidens wurden auf ›Mir nützt, was jenen schadet‹ fokussiert, denkende Individuen verknäuelten sich in besinnungslosem Feldgeschrei – wie die Schafe mit ›Vierbeiner gut – Zweibeiner schlecht‹ – auf Orwells animal farm oder in klammheimlicher Verschwörung zu gewaltbereiten Kollektiven. Es funktioniert immer und überall – zu besichtigen bei Putins Feldzug gegen die Ukraine, bei Extremisten jeglicher Couleur – und es funktioniert vor allem bei Kindern und Heranwachsenden.
- Details
- Geschrieben von: Sennewald Immo
- Rubrik: Gesellschaft
von Lutz Götze
Seit einigen Wochen ist das neueste Sprachmodell von Open AI in Gestalt des ChatbotGPT4 auf dem Markt: Eine künstliche Intelligenz, die nicht nur – wie ihre Vorgänger – Texte erstellen soll, sondern auch Bilder. Die Hoffnungen der Befürworter der Künstlichen Intelligenz waren gewaltig: Ein Chatbot – also eine Maschine, mit der man sich unterhalten kann – könnte Tätigkeiten übernehmen, für die es keine Arbeitskräfte mehr gibt oder die den Menschen entlasten: Roboter in der Industrie und im Gesundheitswesen, Übersetzungen, Schreibarbeiten, Navigationen zu Land, zu Wasser und in der Luft. Aber eben auch Überwachungs- und Bespitzelungssysteme, keineswegs nur in China; obendrein militärische Aktionen (Drohnen). Der Mensch könnte sich, so die steile These, auf individuelle und kreative Tätigkeiten konzentrieren und die Mühsal alltäglicher Routinearbeit überwinden. Eine vollkommen neue Gesellschaft, frei von Fremdbestimmung und Sachzwängen, sei im Entstehen.
- Details
- Geschrieben von: Götze Lutz
- Rubrik: Gesellschaft
- Bequemes Denken
- Der geliehene Planet
- Drei Tonnen CO2
- Ein freier Vollbürger
- Abbild des Lebens. Noch eine weitere Deutung des Fußballs
- Gut geregelt ist halb tot
- Glühende Pflaster
- Eine Generation abendländischen Neolyssenkoismus
- Der Globalismus - ein Riese auf tönernen Füßen
- Von der Trauminsel zum Albtraum: Der Fall Mauritius
- Naturrecht – Ade!
- Von Facebook zu Meta: Geht ein transhumanistischer Traum in Erfüllung?
- Vorbild oder Führung – ein deutsches Dilemma
- Bundestagspräsidentin Özuguz?
- Mittagsläuten für die Ungarn
- Was sagt der Osten dazu?
- Gewissheit in der Wissenschaft und Ungewissheit in der Klimaforschung
- Wenn Goliath sich als David tarnt
- Nachhaltigkeit – die kleine Schwester des Wärmetods
- Plädoyer für eine neue pluralistische Wohnungspolitik
- Das Gewaltmonopol liegt beim Staat
- ERISTISCHE DIALEKTIK oder Eine Anleitung zur Rechthaberei
- Mordtaten aus Wahn oder Ideologie?
- Wir nennen es Demokratie
- Das Lockdown-Syndrom
- Die Angst vor der Triage
- Von Menschen und Seuchen
- Ausgangssperre fürs Gehirn. Kleine Typologie der Verwirrung
- Predigten in Zeiten pandemischer Ungewissheit
- Platz der Direktive – Berliner Luft statt Erfurter Puffbohne?
- Ich glaube an meine eigene Wahrheit. Ich habe Recht.
- Ein entschärfter Begriff des Politischen
- Von Visionen und Denkverboten
- Fachkräftemangel und Volksbildung in Berlin
- Digitalisierung oder Werteorientierung
- Demographischer Wandel: Der große Übergang (5)
- Demographischer Wandel: Der große Übergang (4)
- Demographischer Wandel: Der große Übergang (3)
- Eine Schule für alle, eine Schule der Emanzipation. Eine Rede über alte und neue Bildungsziele
- Demographischer Wandel: Der große Übergang (2)
- Demographischer Wandel: Der große Übergang (1)
- Grundeinkommen oder Erwerbstätigenkonto?
- Die Rechte und die Linke unter dem Aspekt von Fragen und Spielen
- Im Lande östlich des Flusses der bunten und singenden Vögel – Uruguay
- Flüchtlinge schützen – Einwanderung begrenzen
- ›Flüchtlingskrise‹ – auch eine Argumentationskrise
- Ist dies schon Tollheit, hat es doch Methode!
- Reale Dystopien vs. Konkrete Utopie
- Glanz und Elend der Demokratie - Rede zum Internationalen Tag der Demokratie
- Zumutungen eines Weggenossen. Leo Kofler, das Jahr 1968 und die Perspektiven eines sozialistischen Humanismus*
- »Hic Rhodos, hic salta!« – Georg Lukács und der Sprung ins Reich der Freiheit
- Viktor Agartz und die alternative Elitenbildung
- Rudi Dutschke und die Theorie der antiautoritären Revolte