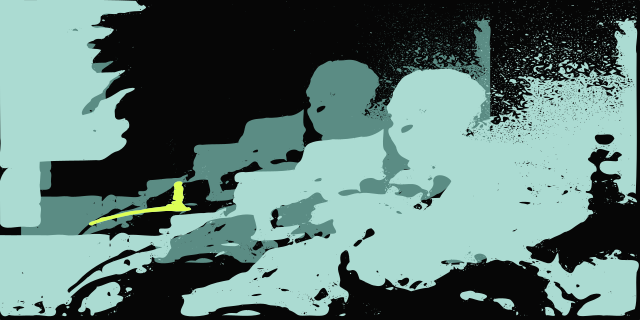von Peter Brandt
Das Grundgesetz im Licht der deutschen Demokratie- und Verfassungsgeschichte
Am 23. Mai 2024 beging die Bundesrepublik Deutschland das 75-jährige Jubiläum des Grundgesetzes und damit ihrer Staatsgründung. Aus der Szene der sog. Reichsbürger kann man hören, das Grundgesetz sei gar keine richtige Verfassung. Sofern das auf den Namen bezogen wird, ist es mindestens irreführend. Die älteste gültige (wenn auch mehrfach ergänzte und geänderte) Verfassung Europas, die norwegische von 1814, heißt ›Grunnloven‹ = Grundgesetz. Allerdings wurde in Westdeutschland 1948/49 der Ausdruck ›Grundgesetz‹ bewusst gewählt, um etwas gegenüber einer Vollverfassung Niederrangigeres zu bezeichnen. Sofern man bei unserem Grundgesetz darüber hinaus ein Legitimitätsproblem sehen könnte, liegt es an dessen Entstehungsgeschichte (siehe weiter unten).
Teil 2 von: Die Verschwörung
von Boris Blaha
Die Diskussion, wie mit den Kriegsverbrechern umzugehen sei, begann schon während des Krieges. Die politische Führung der Weimarer Republik war nach dem Ersten Weltkrieg weder in der Lage, die Hauptverantwortlichen des Krieges auszuliefern, noch selbst vor Gericht zu stellen und abzuurteilen. Eine politische Fähigkeit zur Selbstreinigung konnte man den Deutschen nicht unterstellen. Das noch größere Problem: Verbrecher ist eine Rechtsposition. Auch der Verbrecher befindet sich an einem definierten Ort innerhalb einer rechtlich geordneten, zivilisierten Welt. Roosevelt, Churchill und Stalin wollten zunächst kein großes Aufheben um die Sache machen und plädierten für schnelle Lösungen bis hin zu Massenexekutionen.
von Boris Blaha
Im August 1945 – nicht einmal vier Monate nach der Kapitulation des Dritten Reiches – schickte der damals schon berühmte Pariser Philosoph Alexandre Kojève ein Memorandum an den Chef der provisorischen Regierung Frankreichs, Charles de Gaulle. Kaum war das auf tausend Jahre angelegte germanische Reich nach nur wenigen Jahren in einer gigantischen Katastrophe zerplatzt, empfahl Kojève seinem General die Errichtung eines neuen lateinischen Reiches, bestehend aus den katholischen Ländern Spanien, Italien und Frankreich, das mit der Grande Nation als primus inter pares das germanische Reich in die Rolle des unterworfenen Knechts zwingen sollte.