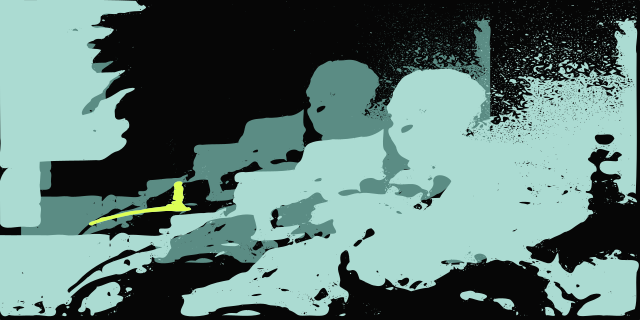von Iris Berndt
Eine Reise in das heutige Kaliningrad
Der 300. Geburtstag Immanuel Kants ist Anlass, die Bedeutung des Philosophen für selbstverständlich scheinende Gewissheiten unseres Denkens, unserer wissenschaftlichen Methodik und unseren Begriff von menschlicher Freiheit intensiver als sonst zu reflektieren. Auch der Kategorische Imperativ Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde wird in Erinnerung gerufen. Der Volksmund hat diesen Anspruch in dem Sprichwort vereinfacht: Was Du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem Andern zu!
von Helmut Roewer
So, wie ich mir meine Leser vorstelle, werden sie einen Moment stutzen und zögern, ob sie die Löschtaste drücken sollen, um dann doch, von Neugierde übermannt bzw. überweibt, weiterzulesen. Ich räume gerne ein, dass ich mir in den letzten vier Jahren – die Zeiten waren danach – ab und an einschlägige Gedanken gemacht habe. Dabei wäre es wohl geblieben, wenn gestern Abend nicht die Büchersammlung mit den Amerika-Sachen ihren inneren Zusammenhang verloren und mit Donnergetöse ins Arbeitszimmer gestürzt wäre.
von Ulrich Schödlbauer
In einer jüngst gehaltenen Brüsseler Ansprache skizziert der Historiker und bekennende ›Hesperianer‹ David Engels seine Antwort auf die Frage, ob (und warum) ›wir‹ ›unsere Zivilisation‹ anderen vorziehen sollten. Die deutsche Fassung, nachzulesen im Sandwirt, ist insofern bedenkenswert, als sie an gewissen Stellen den Ausdruck ›western civilisation‹ durch den etwas anders konnotierten des ›Abendlandes‹ ersetzt. Das dürfte nicht ohne Absicht des Spenglerianers Engels geschehen sein. Es macht also Sinn – um dem Anglizismus an dieser Stelle die Ehre zu geben –, sich auf der Spur der deutschen Terminologie zu bewegen, und sei es nur deshalb, weil sonst die ganze Fragestellung (ob und warum wir alle nun Patrioten des Westens sein sollten) seltsam flach daherkommt. Western patriotism ist bekanntlich immer dann in Europa angesagt, wenn der amerikanische Freund sich der Loyalität – und Zahlungswilligkeit – seiner europäischen Verbündeten versichern möchte. Ansonsten genügt den USA der US-Patriotismus ebenso wie den Europafreunden in Großbritannien der britische.