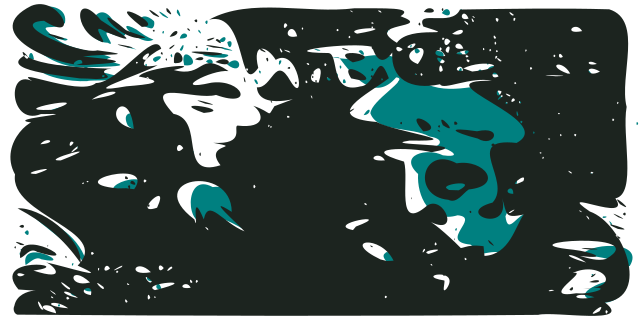von Dietrich Harth
Vorbemerkungen
Zu den forschungspolitisch wirksamsten Initiativen an deutschen Universitäten gehören seit Jahren die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beratend und finanziell geförderten interdisziplinären Projekte, die sogenannten ›Sonderforschungsbereiche‹, abgekürzt: SFB. Die Einrichtung eines SFB an einer Universität setzt die Bereitschaft der Professoren voraus, mindestens 4 Jahre lang zusammen mit jungen NachwuchswissenschaftlerInnen in interdisziplinärer Weise ein für die Neuorientierung mehrerer Einzelfächer und Fakultäten wichtiges, vor allem auch neues Forschungsthema zu behandeln. Ist das Thema erst einmal gefunden, beginnt eine mehrere Jahre dauernde Diskussion zwischen den beteiligten Fächern.
Eine Planungsgruppe wird gegründet und schließlich ein umfangreicher, sehr detaillierter Antrag verfasst, den die DFG an eine Gutachterkommission weitergibt, in der wissenschaftliche Experten anderer Universitäten zusammenarbeiten, um den Antrag zu evaluieren, um ihn entweder abzulehnen oder zu befürworten. Wird der Antrag in den ersten Gutachtergesprächen befürwortet, dann besucht die Kommission die antragstellende Universität, um die Antragsteller und potentiellen Mitarbeiter im geplanten SFB vor Ort zu prüfen.
Kurz, die mehrere Jahre erfordernde Vorbereitungszeit, das Verlangen der DFG nach einer außerordentlich gut begründeten Antragstellung und die strengen Prüfungen durch die Gutachter stellen eine Herausforderung dar und verlangen nicht nur einen erheblichen Aufwand an Planungs- und Diskussionszeit, sondern setzen auch die Bereitschaft aller Beteiligten voraus, sich auf neue Formen der Zusammenarbeit (Teamwork) einzulassen. Geistes- und Kulturwissenschaftler haben selten Erfahrungen mit solchen gruppenbezogenen Interaktionsformen gemacht und begeben sich daher bereits während der Planungszeit in einen bis dahin ungewohnten Lernprozeß, in dessen Verlauf sie Gelegenheit haben, die für jeden Wissenschaftler verbindlichen Tugenden des Zweifelns, des Zuhörenkönnens und der Selbstkritik weiter auszubilden. Bereits in der Vorphase des SFB macht sich also ein Effekt bemerkbar, der durchaus schon zum Prozeß der Neuorientierung gehört und viel mit dem Zugewinn an Sozialkompetenz in der wissenschaftlichen Kommunikation zu tun hat.
Es ist von großer Bedeutung für den allgemeinwissenschaftlichen Wandel, daß das SFB-Modell, wenn es gut funktioniert, auch den geistigen Wettbewerb fördert. Andere, weniger aufwendig angelegte Forschungsinitiativen und Innovationsansätze haben sich von diesem Modell anregen lassen, eigene interdisziplinäre Projekte zu entwickeln, die - finden sie die Zustimmung einer Gutachtergruppe - von anderen namhaften, die Wissenschaften fördernden Stiftungen finanziell unterstützt werden.
Die beiden Sonderforschungsbereiche, die ich im folgenden als Beispiele heranziehen werde, sind in verschiedenen Universitäten beheimatet, haben aber längst über die lokalen Grenzen hinaus Einfluß auf die Entwicklung der kulturwissenschaftlichen Grundlagenforschung genommen. Es handelt sich um den SFB Erinnerungskulturen (http://www.uni-giessen.de/erinnerungskulturen/home/index.html) an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und um den SFB Ritualdynamik (http://www.ritualdynamik.uni-hd.de/) an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Beide werden von der DFG gefördert, nicht um die theoretische Vielstimmigkeit zu reduzieren, sondern um diese nach Ton- und Spielarten zu differenzieren, sie auch, wenn es gelingt, zu erweitern und bestenfalls neu zu orchestrieren. Um die theoretischen Orientierungen dieser Sonderforschungsbereiche zu kennzeichnen, benutze ich die Begriffe »Ritualistik« und »Mnemonik«. Das sind Wortbildungen nach Art von Semiotik oder Rhetorik, und mit eben dieser Gestalt verbinden sich auch Fragen wie die nach der inter- bzw. transdisziplinären Anwendbarkeit der mit ihrer Hilfe zu definierenden Theoriefelder und Verfahrensweisen. Denn das Erinnern und das Rituelle bezeichnen, so lautet die hier zugrunde gelegte These, universelle Spielarten kultureller Symbolisierung und sind daher nicht in die Grenzen eines einzigen Spezialfaches einzuschließen. Es ist ja kein Geheimnis: Über Ritualisierungen und Erinnerungsprozesse machen auch die Verhaltenswissenschaften (Ethologie), die medizinischen Wissenschaften und die Neurobiologie Aussagen. Die Besonderheit der geistes- und kulturwissenschaftlichen Fragestellungen aber zeigt sich schon darin, daß die Bedeutungsgeschichte der lateinischen Stammwörter rituale et memoria zur Binnenstruktur dieser Fragestellungen gehören. Was ihre Geschichte, linguistische Assimilation und terminologische Reformulierung betrifft, so sehe ich in ihnen sogenannte »Traditionsbegriffe«, die ihre Polyvalenz nicht nur ihrem Alter, sondern auch einem weit verbreiteten bildungssprachlichen Gebrauch verdanken.
Umbau der Geisteswissenschaften
Beginnen will ich nach diesen Vorbemerkungen mit einem politisch relevanten Eindruck, der, wie ich zugeben muß, einem etwas pauschalen Blick auf die institutionalisierten, über längere Zeiträume subventionierten Forschungsvorhaben an deutschen Universitäten zu verdanken ist. Ich meine die Vorhaben, die auf einen behutsamen Umbau der Geisteswissenschaften zielen, eine bewußte Veränderung, die zwar an ältere kulturwissenschaftliche Traditionen anknüpft, aber diesen nicht einfach nachfolgen möchte. Wissenschaftspolitisch bedeutsam ist nicht nur dieser Umbau, politisch wirksam sind auch bestimmte Themenkonzentrationen innerhalb der von verschiedenen Stiftungen subventionierten Projekte und – davon ausstrahlend – der beteiligten Hochschulen. Denn diese Projekte sind darauf angelegt, die herkömmlichen forschungs- und hochschulpolitischen Organisationsparameter zu verändern. So sehr sich auch die Initiativen im einzelnen – ich beziehe mich hier nicht nur auf Sonderforschungsbereiche – in der Materialauswahl, der Personen- und Fächerzusammensetzung unterscheiden, eine nicht geringe Zahl von ihnen teilt sich dennoch in einige konzeptionelle Dominanten. Und auf diese möchte ich hier als Nächstes den Blick richten, um Mutmaßungen über einige allgemeine wissenschaftspolitische Trends anstellen zu können.
Zu den erwähnten Dominanten gehören – ich nenne einige der bekannten Schlagwörter – »Theatralität« oder »Inszenierung«, »Performance« oder »Performativität«, »Gedächtnis und Erinnerung«, »Symbolik« oder »Symbolisierung« und nicht zuletzt »Ritual« und »Ritualisierung«. Diese Aufzählung oberflächlich zu ordnen, ist nicht schwierig: Inszenierung, Performance und Ritual sind handlungsbeschreibende Ausdrücke, die beobachtbaren Phänomenen gelten und auf institutionelle Verfestigungen verweisen; Gedächtnis, Erinnerung und Symbolik sind, konventionell gesprochen, Bezeichnungen für mentale, der unmittelbaren Beobachtung entzogene Prozesse. Nur »Theatralität« erscheint auf den ersten Blick als eine alles umgreifende Genrebezeichnung, die nicht nur zu den Konstruktionen symbolischen Handelns auf der Bühne und während ritueller Inszenierungen, sondern auch zur Metaphorik der Gedächtniskunst (im Sinne des theatrum memoriae) paßt. Ein Zufall ist das nicht, da »Theatralität«, so altehrwürdig dieses Wort auch klingen mag, im Kontext wissenschaftlicher Neuorientierungen auf Aspekte der Medialität und elektronischen Virtualisierung anspielt, die auf allen Ebenen der kulturellen Systeme die Art und Weise öffentlicher Präsentation und Wahrnehmung verändert haben. Eine These, die ich sofort näher erläutern möchte, zumal sie etwas von dem Zeitgeist beschwört, der sich in der Formel von der »späten Moderne« verbirgt.
Zum Ausgangspunkt nehme ich einen Satz, der in dem Mitte der 90er Jahre als Rundschreiben kursierenden DFG-Schwerpunktprogramm »Theatralität« mit dem nicht gerade bescheidenen Untertitel »Theater als kulturelles Modell in den Kulturwissenschaften« nachzulesen ist. Dort heißt es: »Unsere Gegenwartskultur konstituiert und formuliert sich zunehmend nicht mehr in Werken, sondern in theatralen Prozessen der Inszenierung und Darstellung, die häufig erst durch die Medien zu kulturellen Ereignissen werden.« Eine revolutionäre Einsicht ist das nicht, umso wichtiger aber ist ihre Bedeutung für das neue forschungspolitische Programm, das damals im Jahre 1995 sogar den Anspruch eines »Pilotprojekts« erheben konnte. Geplant war ein Programm, das sich nur im Zusammenwirken verschiedener Disziplinen, also interdisziplinär, realisieren läßt. Denn es geht, wie der oben zitierte Satz andeutet und das Rundschreiben des weiteren ausführlich darstellt, nicht etwa um Theatergeschichte, sondern um einen Modus kultureller Produktion, Wahrnehmung und Konsumtion, der, aus der Perspektive theatralischer, also dramaturgischer Inszenierungsprozesse betrachtet, als dynamisches und zugleich energetisches Potential zu begreifen ist. Ich darf es noch einmal in einfacherer Form sagen: Kultur soll demnach nicht als Monument begriffen werden, sondern in ihrer Veränderlichkeit als Prozeß, als ein ständiges Werden. Eine solche Betrachtungsweise implizert eine Perspektive, die selbstverständlich auch die Mobilität der Herstellenden und Handelnden, also der Produzenten und Konsumenten sowie der Vermittler einschließt.
Was das forschungspolitisch bedeutet, liegt auf der Hand: Soll das Programm der Neuorientierung Erfolg haben, so sind nachhaltige Kooperationsvereinbarungen zwischen den historisch-philologischen Disziplinen (zum Beispiel: Literatur-, Sprach- und Geschichtswissenschaften) den empirisch operierenden Erfahrungswissenschaften (zum Beispiel: Soziologie und Ethnologie) geradezu zwingend. Das ist angesichts der in den Universitäten verbreiteten Lagermentalität eine ziemliche Herausforderung - aber das ist ein eigenes, hier nicht weiter zu vertiefendes Thema. Wenden wir uns lieber noch einmal dem zitierten Satz, und zwar jener Stelle zu, an der es heißt, unsere gegenwärtige Kultur konstituiere sich »nicht mehr« in Werken, sondern in Prozessen. Was bedeuten diese zwei Wörtchen »nicht mehr«? Heißt es: früher war alles anders, war Kultur einfach da, unzerstörbar und monumental wie ein Gebirgsstock? Das doch wohl nicht. Aufgrund der ausführlichen Teile des Schwerpunktprogramms ist vielmehr anzunehmen, daß diese verkürzte Aussage den mit Kultur (ich übersetze den Begriff Kultur gern mit »Gefüge symbolischer Ordnungen«), also den mit der Analyse des Gefüges symbolischer Ordnungen vertrauten Wissenschaften einen Perspektivenwechsel nahelegt, der morgen schon wieder eine andere Wendung, einen neuen »turn«, nehmen kann. Das Programm erscheint mir daher wie der Zukunftsentwurf kulturwissenschaftlicher Arbeit ohne eindeutiges Ziel, ein Tummelplatz für methodologische Revisionen und analytische Erprobungen konventioneller Theorien, kurz: eine Aufforderung, sich in kreativer Freiheit zu üben.
Die typische Gutachterfrage an eine interdisziplinär zusammengesetzte Forschergruppe »Und welcher Theorie folgen sie denn nun?« geht angesichts des Versuchsstadiums solcher Neuorientierungen an der Sache vorbei. Jede Einheitstheorie würde die vom institutionalisierten Zweifel befeuerte fächerübergreifende Gruppenkommunikation stören, ja vielleicht zerstören. Was diese Kommunikationen wie ein Perpetuum mobile vorantreibt, ist die stille Überzeugung, daß der Wissenschaft nichts heilig sein darf, sie selber eingeschlossen. Natürlich läuft das auf eine selbstkritische Dauerreflexion innerhalb der Wissenschaften hinaus, mit der diese ihren eigenen Autoritätsanspruch in Fragen des Wissens unterminieren müssen. Eine Paradoxie, aus der es keinen billigen Ausweg gibt. Denn in dieser Paradoxie spiegelt sich das Verhältnis des wissenschaftlich produzierten Wissens zur reflexiv gewordenen Moderne, die Soziologen als 'späte' oder 'zweite' Moderne bezeichnen, und die ein fundamentaler »Strukturbruch« mit den heroischen Errungenschaften der ersten Moderne, nicht zuletzt mit dem Vertrauen in die Glücksversprechen der etablierten Wissenschaften charakterisiert. Auch dafür ist übrigens ein Sonderforschungsbereich zuständig: der Münchner SFB mit dem Titel Reflexive Modernisierung (http://www.sfb536.mwn.de), dessen Forschungsprogramm allerdings nicht jenem allmählichen Übergang von der Tradition zur Moderne gilt, den die historischen Disziplinen zu rekonstruieren suchen, sondern den Unsicherheiten, die eine kaum gebremste, von den Wissenschaften angestoßene und geförderte Modernisierungs- und Risikodynamik erzeugt.
Nun sind die wissenschaftlichen Perspektivenwechsel, von denen hier die Rede ist, zwar willkürlich, aber sie sind das doch nur in dem Maß, in dem die Veränderungen der gelebten Erfahrungswelt auf sie zurückwirken. Davon geht der Münchner SFB ausdrücklich aus. Die ihm angeschlossenen Forscher suchen nach dem Sinn dieser, oder schlichter: nach Antworten auf diese Veränderungen und begreifen sie insofern als Fragenkomplexe. Eben das ist aber auch im zitierten Entwurf des Theatralitäts-Projekts der Fall, denn es würde wenig Mühe kosten, den Beweis für die mediale Konstitution kultureller Akteure, Objekte und Praktiken in den OECD-Gesellschaften anzutreten.
Warum aber soll das Theater (so ist kritisch zu fragen) den Kulturwissenschaften, wie es im zitierten Programm heißt, zum »Modell« dienen, warum nicht eine modernere Konstruktion wie zum Beispiel die Organisationsstrukturen des Kulturmanagements oder der Agenturen der medialen Massenkultur? Darauf gibt das Schwerpunktprogramm mehrere Antworten, von denen die folgenden für unser Thema besonders interessant sind: Erstens ist die Vorstellung der Welt als Bühne (theatrum mundi) eine sehr alte Leitidee in der europäischen Kulturtradition, und zweitens ist das Konzept der auf einer Bühne interagierenden Rollenträger längst als Modell für soziologische und psychologische Handlungsanalysen in Gebrauch; man könnte in diesem Zusammenhang auch auf das »Drama« in seiner Funktion als Metapher für die methodische Konstitution komplexer Handlungsprozesse in Fremdkulturen hinweisen, eine Variante, die nicht zuletzt in den Ritualtheorien ethnologischer Experten eine Schlüsselrolle inne hat (Turner; Geertz). Das Theatermodell vereint also Altes und Neues, es eignet sich als ›renoviertes‹ für die Analyse gegenwärtiger Praktiken und als 'restauriertes' für die Rekonstruktion vergangener kultureller Prozesse im Licht gegenwärtiger Erfahrungen.
Wissenschaft und Begriffsbildung
Unser Interesse gilt im folgenden vor allem der Art der Konzeptualisierung, die sich – wie ich meine – an den hier erwähnten Beispielen besonders gut studieren läßt und die sich auch am Beispiel zahlreicher anderer interdisziplinärer Projekte aufdecken ließe. Vergegenwärtigen wir uns kurz, worum es im Rahmen der von mir so genannten forschungspolitischen Neuorientierung geht und warum es sich lohnt, dieser Entwicklung nachzuspüren.
Beginnen will ich mit einer Trivialität: Die Wissenschaften sind Teil der soziokulturellen Welt, die sie erforschen. Diese Einbettung können sie niemals, auch nicht via reflexionis völlig abstreifen, auch dann nicht, wenn ihre spezifische Neugier den Lebenswelten fremder Kulturen gilt. Gleichwohl bilden die Wissenschaften – ähnlich wie ein Staat im Staate – innerhalb der Kulturwelt, deren Teil sie sind, eine eigene Sphäre. Darauf sind sie angewiesen und bedürfen daher auch eigener Rechtsschutzgarantien, einer gewissen wirtschaftlichen Autonomie sowie einer Charta wissenschaftsethischer Grundsätze, wollen sie jene kritische und selbstkritische Distanz zur Allgemeinkultur herstellen, die Bestandteil der von ihnen erhobenen Erkenntnis- und Wahrhaftigkeitsansprüche ist. Was daraus entsteht, sind »Expertenkulturen«, eine Bezeichnung, deren Gegenbegriff »Laienkultur« bereits die erwähnte Distanznahme kenntlich macht. Für die wissenschaftlichen Expertenkulturen gelten in unserer spätmodernen Welt besondere Auflagen:
- Sie sollten möglichst international, also global sowie dezentral, d.h. nicht nur ortsgebunden handeln;
- sie sollten Wissen nicht nur akkumulieren, sondern dessen permanente Revidierbarkeit in ihre hauseigenen Grundregeln einschreiben, was einer Anerkennung von Kontingenz entspricht;
- sie sollten offen sein für theoretische und methodologische Grenzüberschreitungen und sich an überpersönlichen, kontextunabhängigen Rationalitätsprinzipien orientieren,
- sie sollten ihre institutionelle Abhängigkeit einem ständigen Reflexionsprozeß unterziehen, und
- sie sind gehalten, sich im edlen Wettstreit der Wissenschaftskulturen vor der Öffentlichkeit als exzellente Produktivkräfte zu präsentieren.
Dieser Katalog enthält, wie könnte es anders sein, die idealtypisch vereinfachten Merkmale westlicher, will sagen europäisch geprägter Wissenschafts- und Expertenkulturen. Das festzustellen, ist nun keineswegs trivial, bedenken wir die kultur- und geschichtsabhängige normative Valenz jener Schlüsselbegriffe, die dem Prozeß forschungspolitischer Neuorientierungen als Wegweiser dienen: Theatralität, Ritualdynamik, Symbolische Kommunikation, Institutionenwandel, Erinnerungskulturen usf. Aus dieser Liste greife ich das Wort »Ritual« heraus, das als wegweisender Term im Mittelpunkt des Heidelberger SFB steht: Das von einem lateinischen Adjektiv abgeleitete Wort »Ritual« hat in seiner Fassung als Einheitsbegriff, der eine heterogene Klasse besonders gestalteter Praktiken zusammenfaßt, keine Äquivalente z.B. in den asiatischen Sprachen (zu schweigen von den Sprachen der frühen Hochkulturen). Obwohl der Anteil dieser Fremdkulturen den der eigenkulturellen Phänomene auf der Agenda des Heidelberger Forschungsverbunds bei weitem übersteigt, hält dieser mit guten Gründen am Ritualbegriff fest, wofür allerdings auch ganz praktische Dinge wie die Eingrenzung eines Forschungsfeldes und die gruppeninterne Verständigung sprechen.
Religionswissenschaftliche und ethnologische Definitionsversuche aus der Geschichte der mit diesen Disziplinen identischen Expertenkulturen haben den semantischen und operationalen Gehalt des Ritualbegriffs zunächst in einer Weise normiert, die, ganz im Sinn ihrer ontologischen Neigungen, das Zeitübergreifende kollektiver Kulthandlungen in den Mittelpunkt gerückt hat. »Ritual« verhielt sich dementsprechend zum »Mythos« wie die Dauer zum Wandel, und die offensichtliche Korrelation dieser beiden Konzepte schien ihre Funktion als zweifacher Mechanimus zur Erschließung außereuropäischer, nicht zuletzt sogenannter ›primitiver‹ Kulturen voll und ganz zu rechtfertigen. Ein wichtiges Motiv in diesem Normierungsvorgang bildete die Auffassung des Rituals als eines Skripts, d.h. als eines schriftlich kodifizierten Anweisungs- und Regelkatalogs, verfaßt für die Performance immer wiederkehrender Opfer- und Kulthandlungen. Hier deutet sich nicht nur der bekannte ideologische Gegensatz zwischen schriftlosen (in diesem Fall: mythischen) und schriftbesitzenden (in diesem Fall: rituellen) Kultursphären an, vielmehr zeigt sich darin auch die große Nähe des damals gebräuchlichen Begriffs zur christlichen Messe; »Rituale« heißt heute noch das Textbuch der katholischen Liturgie.
Dieser hier skizzierte Hintergrund bildet die Kontrastfolie für die Konzeptualisierung eines wissenschaftlichen Ritualbegriffs, der heute, in der Verbindung mit dem Begriff der »Dynamik«, seine alte Herkunft hinter sich lassen will (der Heidelberger SFB hat den Titel Ritualdynamik). Doch so einfach ist das nicht. Denn es ist da eine merkwürdige Klebrigkeit alter Gebrauchsweisen festzustellen, eine – so könnte man auch sagen – den Wörtern und Begriffen eingeritzte Gedächtnisspur, die sich nicht tilgen läßt, ja die, wie ich meine, auch gar nicht getilgt werden soll. Denn sie verleiht den im Rahmen der Expertenkulturen kritisch rekonstruierten Traditionsbegriffen – ob Theater, Ritual oder Memoria bzw. Gedächtnis – eine Plastizität, die es den Wissenschaftlern erleichtert, die unter diese Begriffe subsumierten Phänomene im Licht jenes Liberalismus zu studieren, der mit den inzwischen (von der UNESCO) zum internationalen Standard erhobenen Werten der kulturellen Pluralität und Diversität übereinstimmt.
Man kann sich fragen, warum halten die Geistes- und Kulturwissenschaftler an diesen Traditionsbegriffen, an diesen antiquierten Sprachspielelementen fest? Warum erfinden sie nicht wie Physiker und Chemiker eine Kunstsprache, welche die von der Tradition über die Phänomene ausgebreitete Patina zerstört? Zugegeben – das ist eine rhetorische Frage, also eine Frage, die bereits einen Teil der Antwort enthält. Soll heißen: die erwähnten Kultur-Phänomene stehen nicht so weit außerhalb, daß man wie in den Naturwissenschaften die Beobachter- von der Mitspielerrolle trennen könnte. Der Kulturwissenschaftler ist immer dazu verdammt mitzuspielen, und sei es nur in der fiktiven Rolle dessen, der sich in den Andern versetzt. Das schaffen Verhaltensforscher und Vivisekteure nicht, oder sollten es unter allen Umständen vermeiden. Ich will es noch einmal von der Seite der Konzeptualisierung aus zu erklären versuchen. Wenn ich von »Traditionsbegriffen« spreche, beziehe ich mich auf die Tatsache, daß die mehrfach erwähnten Schlüsselwörter in den Programmen wissenschaftlicher Neuorientierungen aus eben dem Objektbereich stammen, den es zu untersuchen gilt; mitspielen heißt eben auch: der Sprache der Andern mächtig sein oder sie zumindest verstehen können. Vor wenigen Jahren noch nannte man das, wenn es gelang, den »gutartigen hermeneutischen Zirkel«; heute ist diese Metapher nicht nur vergessen, sie wird auch, nach der Aufwertung des »misreading«, des kontrollierten Mißverstehens, der mystischen Verschmelzung zwischen Interpret und Interpretandum verdächtigt.
Expertenkulturen
An dieser Stelle muß ich nun, wie mir scheint, doch noch einmal einen Schritt zurück gehen, um nicht selber mißverstanden zu werden. »Traditionsbegriffe«, sagte ich, sind selber Teil des zu erforschenden Objektbereichs. Ihre Plastizität, von der ich sprach, hat, wie ich vermute, auch etwas mit dem Widerstand zu tun, den sie einer monothetischen Terminologisierung entgegenbringen. Sie sind traditionsgesättigt und verweisen, ähnlich wie Embleme, auf vieldeutige Text- und Bildzusammenhänge. Wer Formen des Erinnerns, das Leben als theatralisches Rollenspiel oder den Ritualismus des Alltags untersucht, hängt demnach, nimmt man den Begriff der Tradition beim Wort, weiter am Faden des Herkommens und könnte sich als Statthalter jenes kulturellen Gedächtnisses brüsten, das nur den exklusiven Kanon der sog. Großen Tradition anerkennt. Doch das Gegenteil ist der Fall: Die forschungspolitischen Neuorientierungen konterkarieren, wenn ich sie recht verstehe, genau diese Haltung. Und sie tun es – wohlgemerkt – ohne die Traditionsbegriffe fallen zu lassen. Aber sie wiederholen die in diesen wie in eine Kapsel eingeschlossene alte Begriffssemantik nicht in der zwanghaften Weise des Traditionalisten, sie suchen vielmehr die alte Semantik kritisch zu rekonstruieren. »Die Rede von der Theatralisierung unserer heutigen Lebenswelt«, heißt es in dem oben zitierten Schwerpunktprogramm, »zielt [im Unterschied zum barocken Weltmodell des theatrum mundi] auf Prozesse der Inszenierung von Wirklichkeit durch einzelne und gesellschaftliche Gruppen, vor allem auf Prozesse ihrer Selbstinszenierung. Als Teil der Inszenierung gilt dabei nur, was in/mit ihr zur Erscheinung gebracht und von anderen wahrgenommen wird, sowie das Ensemble von Techniken und Praktiken, das eingesetzt wurde, um es zur Erscheinung zu bringen. Damit wird nicht nur die barocke Unterscheidung zwischen Sein und Schein hinfällig, vielmehr wird auch die für unsere [gegenwärtige] Kultur so typische und traditionell als gültig anerkannte Entgegensetzung der positiv besetzten Begriffe Wahrheit, Wirklichkeit, Authentizität mit den negativ besetzten Schein, Simulation, Simulakrum funktionslos.«
Dieses Beispiel einer kritischen Reformulierung ist nicht nur wegen der Einführung so beredter Oppositionspaare wie Schein vs. Sein, positiv vs. negativ, gegenwärtige vs. vergangene Kultur interessant. Es stellt auch mit dem Hinweis auf die dem Scheinbild, dem Simulakrum, geltende mediale Theatralisierung all jene Ideen von Wahrhaftigkeit und Treue in Frage, die im Gedächtnisdiskurs der Tradition eine so große Rolle gespielt haben. Es geht mir an dieser Stelle aber nicht um die Diskussion einer These, sondern, wie schon gesagt, um das Strategische in der Konzeptualisierung des intendierten Perspektivenwechsels. Kurz, die Strategie entspricht einer polarisierenden Distanznahme vom Vergangenen und einer gleichzeitigen semantischen Umbesetzung der traditionellen Schlüsselbegriffe. Nebenbei: Für meinen Geschmack verfallen die Argumente in den Gründungstexten der Neuorientierungen manchmal allzusehr einer prätentiösen Modernitätsrhetorik. Auffallend ist zum Beispiel die häufige Wiederholung der historiographischen Bewegungsmetaphorik von »Kontinuität und Bruch«, die nur noch von der des Oppositionspaares »Moderne vs. Tradition« überboten wird. Ich will mit diesem Einwand die Bedeutung der Gründungstexte der Sonderforschungsbereiche nicht übertreiben und unterschätze auch nicht die taktische Funktion solcher Prospekte. Doch steckt in den zitierten Formulierungen (andere Beispiele ließen sich anschließen) eine – wie ich schon sagte – »forschungspolitische« Symptomatik, die durchaus das Nachdenken über langfristige Entwicklung der Kultur- und Geisteswissenschaften herausfordert.
Die Brüche in der Kontinuität und die Ablösung der Tradition durch die Moderne (so lauten die Formeln) bleiben nicht auf die Merkmalszuschreibungen zu den von den Wissenschaften in den Blick genommenen Objektbereiche beschränkt. Sie gelten vielmehr auch für die Wissenschaften selbst; ihre Einbettung in die soziokulturelle Welt verlangt diese Schlußfolgerung. Und vergegenwärtigt man sich noch einmal die Forderungen, an denen sich die wissenschaftlichen Expertenkulturen heutzutage messen lassen müssen, nämlich an einer Mischung aus Universalismus und Skeptizismus, die jeden normativen Traditionalismus ausschließt, so wird noch einmal deutlich, in welchem Umfang die wissenschaftlichen Versuche der Neuorientierung als Antworten auf eine von traditionsgestützten Wertobligationen sich abkoppelnde Erfahrungswelt zu verstehen sind. Es geht – wie ich hinzufügen muß – nicht um die Behauptung, Traditionen überhaupt seien völlig überflüssig geworden. Natürlich halten wir an vielem fest und nennen es »Tradition«. Aber es ist die Auflösung ihrer normativen Verbindlichkeit für bestimmte Situationen der Lebensführung, die es nahelegt, auch den Begriff der Tradition kritisch in Distanz zu bringen. Ich erspare den Lesern hier einen Überblick über solche Revisionsversuche, wie sie in vielen akademischen Disziplinen – in der Theologie, der Geschichtswissenschaft, der Philosophie und der Kulturanthropologie – vorgelegt worden sind.
Nur eines möchte ich in diesem Zusammenhang noch erwähnen, etwas, das ganz unmittelbar den Funktionswandel der Gedächtnis- und Ritualdiskurse sowohl in den Wissenschaften als auch im Alltag der Gegenwart betrifft. Ich spiele an auf die vieldiskutierte These von der »Erfindung« bzw. der »Invention« von Traditionen, eine These, hinter der Einsicht in die Selektivität und Unzuverlässigkeit des Erinnerns steht. Der Begriff der »Invention« ist hier dem der »Erfindung« vorzuziehen, da die Semantik von inventio zwischen Findung und Erfindung changiert und uns auf die Notwendigkeit hinweist, zwischen Gedächtnisgebrauch und Gedächtnismißbrauch zu unterscheiden. Die kritische Überprüfung dieser Differenz ist vor allem dort äußerst dringend, wo das Gedenken bestimmter Ereignisse im Dienst von Erinnerungspolitiken steht und als öffentliches Ritual inszeniert wird. Wenn heute Traditionen über Ritualisierungen, versteht sich unter Beteiligung der Medienindustrie, im öffentlichen Raum sichtbar gemacht werden, so folgt die entsprechende Invention in der Regel dem Gesetz der Vertauschung, dem Gesetz der Permutation. Das selektiv und fragmentarisch überlieferte Vergangene wird, da es unter der Einwirkung gewaltsamer Veränderungen (Aufstände, Kriege, Naturkatastrophen etc.) zerbrochen ist, entweder dem Vergessen überantwortet oder neu zusammengesetzt und häufig zum austauschbaren Element im Kontext von Restauration und gelegentlicher, meist mit wiederkehrenden Jubiläumsdaten zusammenfallender Ritualisierung. Was dann zu sehen ist, gleicht sehr oft einem Trugbild, einem Simulakrum. Die geschichtswissenschaftlichen Handwerker, die Denkmalschützer und Restauratoren, haben in solchen Fällen den status corruptionis weggewischt und eine geschönte Teilreplika erfunden, in der das Gedächtnis der Zerstörung keinen Platz hat – gibt es eine passendere Allegorie für den Abgrund zwischen Gedächtnis und historischer Rekonstruktion?
Wie wir sagen können, daß Traditionen er-funden und Geschichte gemacht wird, so können wir auch davon reden, daß die Erinnerungen etwas auf Kosten des vergessenen Anderen ins Bewußtsein heben. Auch hier ist eine konstruierende Invention am Werk, und das gilt in besonderem Maß für das organisierte Gedenken im öffentlichen Raum. Mit dem Gedenken eines datierbaren Ereignisses am bestimmten Ort wird die Zeitlichkeit des Vergangenen objektiv versinnlicht und es entsteht, was die Geschichtsschreibung als »lieu de mémoire« (Pierre Nora) oder Mnemotop bezeichnet. Das erinnert nicht zufällig an die locus-imago-Methode der klassischen Mnemotechnik, nach der in abgezirkelten Räumen bildhafte, möglichst komplexe Figuren als Stellvertreter für Begriffe oder Lehrsätze verteilt wurden. Dieses Prinzip ist auch dort noch lebendig, wo eine Gemeinde, eine Stadt, ein Staat den öffentlichen Raum mit Denk- und Mahnmälern möbliert, die historische Gründungsdaten – Siege oder Niederlagen, Triumph oder Schuld – symbolisieren. Die Regel ist, daß solchen Mnemotopen die Spur der Gewalt eingeschrieben ist, daß ihre sinnliche Symbolik aber die damit verbundenen Verletzungen und offenen Wunden überdeckt. Erinnerung und Gedächtnis werden durch die Präsenz räumlich verorteter, die sinnliche Wahrnehmung fokussierender Bilder und Monumente daran gehindert, den versinnbildlichten historischen Prozeß narrativ zu entfalten, ihn auf diese Weise zu verzeitlichen und ins historische Gedächtnis aufzuheben.
Kulturkomparatistik und die Rätsel der Zeit
Diese Beobachtung führt uns auf eine Ebene, auf der, so scheint mir, ein intensiver Dialog – und davon handeln meine abschließenden Überlegungen – zwischen Ritual- und Erinnerungsforschung einerseits und der Kulturkomparatistik andererseits Früchte tragen kann. Das zwischen dem Department für Asienstudien an der Universität München und dem Institut für Altamerikanistik und Ethnologie an der Universität Bonn vereinbarte Forschungsprojekt »Schrift, Ritual und kulturelles Gedächtnis – das Alte China und Mesoamerika im Vergleich« hat diesen Weg eingeschlagen und versucht eine Brücke zwischen Ritual- und Gedächtnisforschung zu schlagen. Die Wahl geschichtlich weit zurückliegender Kulturphänomene berührt natürlich auch solche Fragen, wie die nach den begrifflichen und methodischen Voraussetzungen historischer Rekonstruktionen. Ohne diese hier im einzelnen diskutieren zu wollen, möchte ich daher kurz auf das mit den Erinnerungsprozessen verbundene große Problem der Zeiterfahrung zu sprechen kommen.
Betrachten wir die Begriffe Gedächtnis und Erinnerung in Verbindung mit der Erfahrung von Zeit, so zeigen sich wichtige Unterschiede, die gleichwohl (nach dem heutigen Stand des Wissens) erst aus beiden mit diesen Begriffen belegten Propositionen ein Ganzes machen. Das Erinnern gilt den partikularen Ereignissen, also dem, was in das Bewußtsein ›ein-fällt‹, ein jähes Geschehen wie es das französische Verb »souvenir« andeutet. In der wissenschaftlich fundierten historischen Erinnerung stehen daher auf der Agenda des spezifischen Vergewisserungskatalogs die Individualnamen der in die Ereignisse verstrickten Akteure (d. h. der historischen Subjekte) und die Bestimmung kalendarischer Daten (der Ereignisse). Kollektives und individuelles Erinnern sind nicht weniger ereignisbezogen, arbeiten aber im Gegensatz zum historischen Erinnern, das dem Gebot narrativer Kontrollen unterworfen ist, in der Regel frei von solchen Kontrollen und haben eine starke Affinität zur Legendenbildung. Legenden aber sind auf eine merkwürdige Art zeit-los, zumindest solange sie selbst in der Zeit nachhaltig weiter existieren. Und das tun sie vor allem dann, wenn eine Gemeinschaft sie ihren kommunitären Ritualpraktiken – z.B. anläßlich politischer oder religiöser Feste – als Traditionsnarrativ einverleibt.
Der Gedächtnisbegriff hinwiederum bezeichnet keineswegs nur den Container partikularer Ereigniserinnerungen (man darf sich hier der zahllosen räumlichen Gedächtnismetaphern erinnern), er steht vielmehr für die kognitive Organisation des Erinnerten, denn Gedächtnis und Gedanke sind ebenso Zwillinge wie Andenken und Gedenken. Insofern ist dem Gedächtnisbegriff nicht nur die Bedeutung ›Orientierung im Fluß der Zeit‹ sondern auch die Funktion des »historischen Bewußtseins« zuzuschreiben. Mit anderen Worten: Das Gedächtnis stiftet zeitliche Kontinuität. Es umfaßt somit die Fähigkeit, die Gegenwart auf dem Umweg über die Vergangenheit auf die Zukunft vorzubereiten, freilich in einem pro-visorischen Sinn. Wenn ich z. B. die Vergangenheit als einen »Friedhof gebrochener Versprechen« (Ricœur) begreife, werde ich eine andere Zukunftsvision zum Leitstern meines gegenwärtigen Handelns machen, als wenn ich mich dem Club derer anschließe, die mit der Formel »Alles ist gut!« auf den Lippen in antiquarischer Bewunderung vor dem Alten in die Knie sinken. Daher die zentrale Rolle der Kritik im Prozeß geschichtswissenschaftlicher Retrospektionen. Sie kann im Verein mit der methodologischen Skepsis verhindern, daß das kollektive Gedächtnis in bloßes Wiederkäuen und in obskurantistische Kontinuitätsfantasien verfällt.
Der Schritt von der Diskussion des Gedächtnisses als Organon zeitlicher Orientierung zur Forderung nach wissenschaftlicher Kritik als Korrektiv zwanghaften Gedächtnismachens erscheint mir notwendig, um die Funktionen des Rituellen im Rahmen der Gedächtnisdiskurse und der Konstruktion von Zeit richtig einschätzen zu können. Keine Kultur ohne Zeit-Konstruktionen, keine Zeit-Konstruktion ohne Ritualisierungen: Die religiösen Kalender sind zugleich Ritualkalender, entstanden aus Kämpfen um den Sieg über konkurrierende Lehren und die legitime Macht der jeweiligen Doktrin. Vergessen wir nicht, daß der gregorianische Kalender, der das okzidentale historische Gedächtnis beherrscht, auf ein Exekutionsritual (die Kreuzigung des Jesus von Nazaret) zurückgeht, das seinerseits auf rituelle Weise zum Beginn einer neuen Zeitrechnung geführt hat. Doch wir brauchen nicht nach Äonen zu rechnen, um den engen Konnex zwischen temporalem Gedächtnis und rituellen Zeitkonstrukten zu bemerken. Denn jeden Tag werden wir auf diesen Zusammenhang gestoßen, wenn wir die »kleinen Pietäten« (Goffman), die Mikrorituale des Grüßens und des Verabschiedens vollziehen, in deren sinnbildlicher Gestik Erinnerung und Erwartung zusammenfließen. Folgt nicht auch die wöchentliche Zeiteinteilung mit ihrer Sonntagsbesinnungspause ritualisierten Sequenzen? Und was ist mit dem Jahresablauf, ist dessen Ordnung, der den Verlauf skandierende Wechsel von Alltag und Festtag, nicht auch das Produkt einer, wenn auch weitgehend vergessenen Ritualkultur?
Der ethnologische Ritualexperte (Rappaport) macht uns darauf aufmerksam, daß die zeitkonstruierende Leistung des Rituellen nicht mit der Zeitstruktur zu verrechnen ist, die sie erzeugt. Die rituelle Konstruktion der Zeit vollzieht sich vielmehr in einer anderen als der willkürlichen Zeitrechnung (womit nicht nur die Uhrzeit, sondern jede Art der Zeitmessung gemeint ist). Sie vollzieht sich in den Intervallen, in einer »time out of time«, die nicht nur eine objektive liturgische Ordnung repräsentiert, sondern die auch die individuelle Zeiterfahrung in ungewöhnlicher Weise erweitern kann. »An den Orten des Gebets wußte ich,« schreibt ein zeitgenössischer Pilger über seine Erfahrungen in Mekka, »daß ich [der] Vergangenheit [meines eigenen Todes] entgegenging und sie mir – was auf dasselbe hinausläuft – entgegenkam. An den anderen Orten folgte sie mir und holte mich stets ein, um mich alsbald in eine Art ironische Unentschlossenheit zu entlassen, die sowohl mit dem Provisorischen als auch dem Definitiven zusammenhing. Ich entdeckte meine Existenz von neuem« (Abdellah Hammoudi). Beispiele liefern aber nicht nur die rituell induzierten religiösen Ekstasen, sondern auch jene zivilisatorisch konstruierten Natur- und Lebenszyklen, deren rhythmische Zeitmodulationen und Takteinteilungen ohne die für diesen Zweck erfundenen Riten gar nicht denkbar sind. Es ist, als würde die Zeit während des rituellen Vollzugs in einem ganz anderen Sinn als dem des auf einer Linie ins Ziel fliegenden Pfeils zum Gegenstand einer simultan mehrere Dimensionen umfassenden Betrachtung und Erfahrung.
Diese kurzen Bemerkungen wären allzu einseitig, würde das Nachdenken über die eigenartigen Verbindungen zwischen erinnerter und rituell konstruierter Zeit nicht auch die Differenzen in den Zeitanschauungen verschiedener Kulturen reflektieren. Doch mehr als ein Hinweis und eine Vermutung sind an dieser Stelle nicht möglich. Der französische Philosoph und Sinologe François Jullien hat sich in seinen vergleichenden Studien über die klassischen Denkmodelle der antiken Literaturen Europas und Chinas auch mit den Zeitbegriffen des einen wie des anderen Kulturraums auseinandergesetzt. In den klassischen konfuzianischen Schriften, vor allem im Buch der Wandlungen, glaubt er die Spuren einer Zeitauffassung zu entdecken, die sich in hohem Maß von den zeitphilosophischen Thesen europäischer Autoren unterscheidet. Dieser Unterschied liege keineswegs in einer oft behaupteten Abwesenheit abstrakter Zeitbegriffe. Die chinesische Tradition hat vielmehr, so Jullien, die Vorstellung eines – wie man auch mit G. E. Lessing sagen könnte – »fruchtbaren Augenblicks« entwickelt, der eine innere Verwandtschaft mit der rituellen Wiederkehr des Jahreszeitenwechsels besessen habe. Den ›günstigen Moment‹ abzuwarten, um an ihm das Handeln auszurichten, sei stets ein Zeichen der Weisheit gewesen. Die langfristige, in meßbaren Zeiträumen sich bewegende Planung, wie sie dem europäischen Denkmodell eigen ist, blieb nach Jullien diesem Weisheitsstreben weitgehend fremd.
Folgt man dieser These, so liegt es nahe, das chinesische Modell einer rituell konstruierten Zeit des günstigen oder fruchtbaren Handlungsaugenblicks als Hypothese dem Studium auch anderer außereuropäischer Zeitvorstellungen zugrunde zu legen. Meine Vermutung ist, daß diese Hypothese, wird sie ernst genommen, auch zu einem anderen Begriff des Erinnerns führen muß, da im okzidentalen Gedächtniskonzept die Vorstellung von einer das Vergangene verschlingenden und vernichtenden Zeit mitschwingt, der nur mit Hilfe einer Historisierung dessen, was einst gewesen ist, widerstanden werden kann.
Literatur
Assmann, J.: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1992.
Beck, U., A. Giddens, S. Lash: Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse, Frankfurt a. M. 1996.
Bell, C.: Ritual Theory, Ritual Practice, New York/Oxford 1992.
Böhme, H., K. R. Scherpe: Einführung. In: Dies. (Hg.): Literatur und Kulturwissenschaft. Positionen, Theorien, Modelle, Reinbek bei Hamburg 1996, 7-24.
Bourdieu, P.: Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns, Frankfurt a. M. 1998.
d’Aquili, E. G, C. D. Laughlin et al.: The Spectrum of Ritual: A Biogenetic Structural Analysis, New York 1979.
Draaisma, D.: Die Metaphernmaschine. Eine Geschichte des Gedächtnisses, Darmstadt 1999.
Dücker, B., D. Harth, M. Steinicke, J. Ulmer: Literaturpreisverleihungen: ritualisierte Konsekrationspraktiken im kulturellen Feld. In: Forum Ritualdynamik Nr. 11, Heidelberg 2005 (http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/5490).
[Fischer-Lichte, E.:]Theatralität – Theater als kulturelles Modell in den Kulturwissenschaften (Typoskript 1995).
Geertz, C.: Local Knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropology, London 1993.
Goffman, E.: Das Individuum im öffentlichen Austausch, übers. v. R. u. R. Wiggershaus, Frankfurt a. M. 1974.
Hammoudi, A.: Steinigung des Satans. Erlebnisse eines Ethnologen auf der Pilgerreise nach Mekka. In: Lettre 68 (2005), 18-23.
Harth, D.: Das Gedächtnis der Kulturwissenschaften, Dresden 1998.
Harth, D.: Akademische Rituale. In: IABLIS. Jahrbuch für europäische Prozesse 2 (2003), 241-246.
Harth, D. und G. J. Schenk (Hg.): Ritualdynamik. Kulturübergreifende Studien zur Theorie und Geschichte rituellen Handelns, Heidelberg 2004.
Harth, D.: Rituale – Texte – Diskurse. Eine formtheoretische Betrachtung. In: Text und Ritual. Kulturwissenschaftliche Essays und Analysen von Sesostris bis Dada (Hermeia 8), hg. von B. Dücker u. H. Roeder, Heidelberg 2005, 19-48.
Hobsbawm, E. J. & Terence Ranger (Hg.): The Invention of Tradition, Cambridge 1992.
Jullien, F.: Du »temps«. Éléments d’une philosophie du vivre, Paris 2001.
Köpping, K.-P. und U. Rao (Hg.): Im Rausch des Rituals. Gestaltung und Transformation der Wirklichkeit in körperlicher Performanz, Münster 2000.
Levine, R.: A Geography of Time, New York 1997.
Moore, S. F., B. G. Myerhoff: Secular Ritual: Form and Meaning: In: Dies. (Hg.): Secular Ritual, Assen/Amsterdam 1977, 3-24.
Rappaport, R. A.: Ritual and Religion in the Making of Humanity (Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology 110), Cambridge 1999.
Ricœur, P.: Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern – Vergessen – Verzeihen (Essener Kulturwissenschaftliche Vorträge 2), Göttingen 1998.
Turner, V.: From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play, New York 1982.
Weinrich, H.: Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens, München 1997.
[Deutsche Fassung eines auf Chinesisch veröffentlichten Vortrags; erschienen in: Xiaobing Wang-Riese/Dilmurat Omar (Hrsg.): Writing, Ritual & Cultural Memory, Beijing 2007, S. 3-20.]