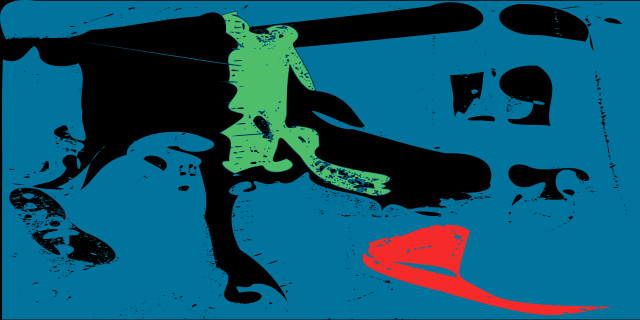Wissenschaft und Begriffsbildung
Unser Interesse gilt im folgenden vor allem der Art der Konzeptualisierung, die sich – wie ich meine – an den hier erwähnten Beispielen besonders gut studieren läßt und die sich auch am Beispiel zahlreicher anderer interdisziplinärer Projekte aufdecken ließe. Vergegenwärtigen wir uns kurz, worum es im Rahmen der von mir so genannten forschungspolitischen Neuorientierung geht und warum es sich lohnt, dieser Entwicklung nachzuspüren.
Beginnen will ich mit einer Trivialität: Die Wissenschaften sind Teil der soziokulturellen Welt, die sie erforschen. Diese Einbettung können sie niemals, auch nicht via reflexionis völlig abstreifen, auch dann nicht, wenn ihre spezifische Neugier den Lebenswelten fremder Kulturen gilt. Gleichwohl bilden die Wissenschaften – ähnlich wie ein Staat im Staate – innerhalb der Kulturwelt, deren Teil sie sind, eine eigene Sphäre. Darauf sind sie angewiesen und bedürfen daher auch eigener Rechtsschutzgarantien, einer gewissen wirtschaftlichen Autonomie sowie einer Charta wissenschaftsethischer Grundsätze, wollen sie jene kritische und selbstkritische Distanz zur Allgemeinkultur herstellen, die Bestandteil der von ihnen erhobenen Erkenntnis- und Wahrhaftigkeitsansprüche ist. Was daraus entsteht, sind »Expertenkulturen«, eine Bezeichnung, deren Gegenbegriff »Laienkultur« bereits die erwähnte Distanznahme kenntlich macht. Für die wissenschaftlichen Expertenkulturen gelten in unserer spätmodernen Welt besondere Auflagen:
- Sie sollten möglichst international, also global sowie dezentral, d.h. nicht nur ortsgebunden handeln;
- sie sollten Wissen nicht nur akkumulieren, sondern dessen permanente Revidierbarkeit in ihre hauseigenen Grundregeln einschreiben, was einer Anerkennung von Kontingenz entspricht;
- sie sollten offen sein für theoretische und methodologische Grenzüberschreitungen und sich an überpersönlichen, kontextunabhängigen Rationalitätsprinzipien orientieren,
- sie sollten ihre institutionelle Abhängigkeit einem ständigen Reflexionsprozeß unterziehen, und
- sie sind gehalten, sich im edlen Wettstreit der Wissenschaftskulturen vor der Öffentlichkeit als exzellente Produktivkräfte zu präsentieren.
Dieser Katalog enthält, wie könnte es anders sein, die idealtypisch vereinfachten Merkmale westlicher, will sagen europäisch geprägter Wissenschafts- und Expertenkulturen. Das festzustellen, ist nun keineswegs trivial, bedenken wir die kultur- und geschichtsabhängige normative Valenz jener Schlüsselbegriffe, die dem Prozeß forschungspolitischer Neuorientierungen als Wegweiser dienen: Theatralität, Ritualdynamik, Symbolische Kommunikation, Institutionenwandel, Erinnerungskulturen usf. Aus dieser Liste greife ich das Wort »Ritual« heraus, das als wegweisender Term im Mittelpunkt des Heidelberger SFB steht: Das von einem lateinischen Adjektiv abgeleitete Wort »Ritual« hat in seiner Fassung als Einheitsbegriff, der eine heterogene Klasse besonders gestalteter Praktiken zusammenfaßt, keine Äquivalente z.B. in den asiatischen Sprachen (zu schweigen von den Sprachen der frühen Hochkulturen). Obwohl der Anteil dieser Fremdkulturen den der eigenkulturellen Phänomene auf der Agenda des Heidelberger Forschungsverbunds bei weitem übersteigt, hält dieser mit guten Gründen am Ritualbegriff fest, wofür allerdings auch ganz praktische Dinge wie die Eingrenzung eines Forschungsfeldes und die gruppeninterne Verständigung sprechen.
Religionswissenschaftliche und ethnologische Definitionsversuche aus der Geschichte der mit diesen Disziplinen identischen Expertenkulturen haben den semantischen und operationalen Gehalt des Ritualbegriffs zunächst in einer Weise normiert, die, ganz im Sinn ihrer ontologischen Neigungen, das Zeitübergreifende kollektiver Kulthandlungen in den Mittelpunkt gerückt hat. »Ritual« verhielt sich dementsprechend zum »Mythos« wie die Dauer zum Wandel, und die offensichtliche Korrelation dieser beiden Konzepte schien ihre Funktion als zweifacher Mechanimus zur Erschließung außereuropäischer, nicht zuletzt sogenannter ›primitiver‹ Kulturen voll und ganz zu rechtfertigen. Ein wichtiges Motiv in diesem Normierungsvorgang bildete die Auffassung des Rituals als eines Skripts, d.h. als eines schriftlich kodifizierten Anweisungs- und Regelkatalogs, verfaßt für die Performance immer wiederkehrender Opfer- und Kulthandlungen. Hier deutet sich nicht nur der bekannte ideologische Gegensatz zwischen schriftlosen (in diesem Fall: mythischen) und schriftbesitzenden (in diesem Fall: rituellen) Kultursphären an, vielmehr zeigt sich darin auch die große Nähe des damals gebräuchlichen Begriffs zur christlichen Messe; »Rituale« heißt heute noch das Textbuch der katholischen Liturgie.
Dieser hier skizzierte Hintergrund bildet die Kontrastfolie für die Konzeptualisierung eines wissenschaftlichen Ritualbegriffs, der heute, in der Verbindung mit dem Begriff der »Dynamik«, seine alte Herkunft hinter sich lassen will (der Heidelberger SFB hat den Titel Ritualdynamik). Doch so einfach ist das nicht. Denn es ist da eine merkwürdige Klebrigkeit alter Gebrauchsweisen festzustellen, eine – so könnte man auch sagen – den Wörtern und Begriffen eingeritzte Gedächtnisspur, die sich nicht tilgen läßt, ja die, wie ich meine, auch gar nicht getilgt werden soll. Denn sie verleiht den im Rahmen der Expertenkulturen kritisch rekonstruierten Traditionsbegriffen – ob Theater, Ritual oder Memoria bzw. Gedächtnis – eine Plastizität, die es den Wissenschaftlern erleichtert, die unter diese Begriffe subsumierten Phänomene im Licht jenes Liberalismus zu studieren, der mit den inzwischen (von der UNESCO) zum internationalen Standard erhobenen Werten der kulturellen Pluralität und Diversität übereinstimmt.
Man kann sich fragen, warum halten die Geistes- und Kulturwissenschaftler an diesen Traditionsbegriffen, an diesen antiquierten Sprachspielelementen fest? Warum erfinden sie nicht wie Physiker und Chemiker eine Kunstsprache, welche die von der Tradition über die Phänomene ausgebreitete Patina zerstört? Zugegeben – das ist eine rhetorische Frage, also eine Frage, die bereits einen Teil der Antwort enthält. Soll heißen: die erwähnten Kultur-Phänomene stehen nicht so weit außerhalb, daß man wie in den Naturwissenschaften die Beobachter- von der Mitspielerrolle trennen könnte. Der Kulturwissenschaftler ist immer dazu verdammt mitzuspielen, und sei es nur in der fiktiven Rolle dessen, der sich in den Andern versetzt. Das schaffen Verhaltensforscher und Vivisekteure nicht, oder sollten es unter allen Umständen vermeiden. Ich will es noch einmal von der Seite der Konzeptualisierung aus zu erklären versuchen. Wenn ich von »Traditionsbegriffen« spreche, beziehe ich mich auf die Tatsache, daß die mehrfach erwähnten Schlüsselwörter in den Programmen wissenschaftlicher Neuorientierungen aus eben dem Objektbereich stammen, den es zu untersuchen gilt; mitspielen heißt eben auch: der Sprache der Andern mächtig sein oder sie zumindest verstehen können. Vor wenigen Jahren noch nannte man das, wenn es gelang, den »gutartigen hermeneutischen Zirkel«; heute ist diese Metapher nicht nur vergessen, sie wird auch, nach der Aufwertung des »misreading«, des kontrollierten Mißverstehens, der mystischen Verschmelzung zwischen Interpret und Interpretandum verdächtigt.