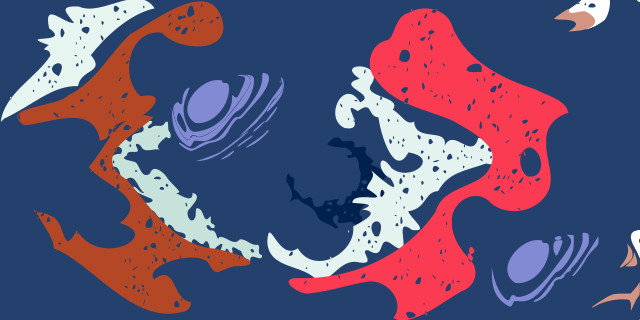von Ulrich Schödlbauer
Die Frage, ob Kunst politisch ist, muss Historikern unverständlich erscheinen. Bereits die ältesten Herrschaftszeichen bezeugen einen unauflöslichen Zusammenhang von Macht und Pomp. Sie sind dazu bestimmt, ›Eindruck zu machen‹. Macht zeigt sich, Macht prägt sich ein. Selbst dort, wo sie sich aus Gründen der Zweckmäßigkeit verborgen hält, spricht sie durch Zeichen, die den Dekor wahren, zu denen, die sie einschüchtern oder hinter sich scharen will. Aufdringlich oder unauffällig darf der Augenschein bekunden, was jeder weiß oder in seinem eigenen Interesse wissen sollte: Hier spielt die Musik. Macht will erkannt werden. Ein probates Steigerungsmittel der Wahrnehmung sind Künste, die ›verherrlichen‹, wo sonst nur krude Gewalt sichtbar würde. Mit den Regierungsformen wechseln Symbol- und Performanzregister.
1
Wo immer Militärkapellen aufspielen, rote Teppiche entrollt, unter Blitzlichtgewittern Wagentüren aufgerissen, Kleider-, Sitz- und Sprechordnungen zelebriert werden, greifen Mechanismen der Versinnlichung und der Versinnbildlichung, soll heißen der ›ästhetischen‹ Kommunikation von Herrschaft. Es zeigt sich, wer das Sagen hat. Das repräsentative Nebeneinander hierarchischer, sakraler und ästhetischer Momente erzeugt beim Betrachter ein In- und Miteinander, ein, im Wortsinn, ›Durch-einander‹ der Wahrnehmungsebenen, in dem ein Element das andere reflektiert, verstärkt und nicht selten karikiert, gelegentlich auch konterkariert. Dies alles dient der Steigerung von Prägnanz, also der Erzeugung einer herausgehobenen Wahrnehmung mit gedächtnis- und bewusstseinsprägender Funktion. Im Vergleich zu Serenissimus-Inszenierungen vergangener Epochen mögen solche Auftritte schlicht wirken. Rechnet man allerdings die technisch-organisatorischen Aufwände ein, so ist die Tendenz eher steigend.
Das Bild der Macht in der medialen Öffentlichkeit tendiert zur Lückenlosigkeit – unter kunstvoller Einbeziehung des ›Privaten‹. Auch hier ist die Vorgeschichte lang. In Europa sind es die barocken Hofkünstler, die der ästhetisch durchgeformten Herrscher-Existenz die passenden Ausstattungsstücke lieferten. Die auf den ersten Blick seltsam anmutende Allianz zwischen dem ›Schöpfer‹ des Gesamtkunstwerks, Richard Wagner, und dem königlichen Imitator des Sonnenkönigs, Ludwig II., findet ihre Pointe vielleicht gerade darin, dass sich hier zwei Formen ästhetischer Repräsentation durchdringen: das an alle Sinne appellierende Bühnenwerk und das Person gewordene Abbild herrscherlicher Selbstinszenierung ›mit allen Sinnen‹ huldigen einem Publikum, dem halluzinierten ›Geschichtsvolk‹ als aufmerksamem Konsumenten der Idee der Macht. In diesem Sinne wäre Linderhof ein gebauter Dialog zwischen zwei Macht-Bildern: dem einer kommenden und dem einer, die geht.
2
Selten dienen Großinszenierungen im öffentlichen Raum der bloßen Repräsentation. In politisch aufgewühlten Zeiten fällt ihnen die Aufgabe zu, Anhänger zu mobilisieren und Gegner, auch potenzielle, einzuschüchtern. Wer Tausende ›auf die Beine bringt‹, der vollzieht eine für jedermann erkennbare Drohgebärde. Er formuliert einen Machtanspruch, der in genehmigten, sich in juristisch einwandfreien Formen vollziehenden Demonstrationen domestiziert, aber nicht aufgehoben erscheint. Die immer möglichen ›Zwischenfälle‹ zeigen einen Rest an wechselseitigem Misstrauen zwischen Ordnungsmacht und Gegenmacht, der bleibt. Bei solchen Gelegenheiten feiert die Masse sich selbst: angefangen beim einfachen Selbstgenuss, der Lust am Beisammensein und Zusammenstehen, im rhythmischen Gleichklang, im ekstatischen Ausbruch Einzelner ›vor aller Augen‹ und schließlich im stets erhofften kollektiven Wandlungserlebnis, in dem ein Verlangen die Masse ›beseelt‹ und gelegentlich zu unvorhergesehenen Taten treibt. Dieses Verlangen wiederum, der ›Wille der Massen‹, wie es in ideologisierter Sprache heißt, dient den politischen Massenbewegungen des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts als legitimierende Basis künftiger oder auf Dauer gestellter ›revolutionärer‹ Herrschaft. Offenkundig tendiert demokratisches Herrschaftsverlangen dazu, den ›demos‹ in beiderlei Gestalt zu inkorporieren: als abstraktes Wahlvolk und als von einem Willen beseelte Masse. Das Erlebnis der Masse ist eine Herrschaftsressource, organisierte ›unpolitische‹ Massenereignisse wie Sport- und Popveranstaltungen dienen nicht zuletzt dazu, ihren Gebrauch zu neutralisieren. Gleichzeitig tragen sie ihren Erlebnissinn in sich selbst – darin, obwohl äußerlich ungleich machtvoller, vergleichbar einem Violinkonzert im kleinen Konzertsaal einer ehemaligen barocken Residenz.
3
Mit der Epoche inszenierter Massenereignisse gerät die Kunst in ein Spannungsfeld, das sie nicht ignorieren kann. Die heftigen Reaktionen progressiver Kunstbewegungen wie Expressionismus, Formalismus und Futurismus auf das Zusammenspiel revolutionärer Technik- und Massenerfahrungen werden von dem starken Verdacht geleitet, die Kunst, wie man sie kannte, sei angesichts dieser historisch neuen Dimensionen des ästhetischen Weltverhältnisses am Ende. Auch hier geht es um Politik. Seit der Renaissance steht und fällt der Anspruch der Kunst auf repräsentative Weltdeutung mit der Behauptung, sie verfüge über die Mittel, zwanglos zu bezwingen, also Herrschaft und Freiheit, zumindest des Gemüts, miteinander zu versöhnen. Lange vor der Aufklärung nimmt sie damit die Position ein, die dort zunächst arglos, später in aller Skepsis und mit allerlei Salvationen angesichts einer widerspenstigen Realität, der Vernunft eingeräumt wird – bis hin zu Hegels auch philosophisch zweideutigem, von Heine virtuos im Fortschritts-Sinn ausgelegten Diktum: Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig. Schillers Briefe über ästhetische Erziehung bezeugen, dass auch im Zeitalter der Vernunft die Funktion der Kunst als ›Intermedium‹, als Vermittler zwischen dem Gesetzgeber – also der Vernunft – und dem Einzelnen mitnichten am Ende ist, jedenfalls nicht, solange der Einzelne die Vernunft nicht in dem Maße inkorporiert hat, das erforderlich wäre, um die Angelegenheiten der Allgemeinheit nach ihren Maßgaben zu regeln. In mancher Hinsicht erinnert Schillers ästhetisches Erziehungsprogramm an idealtypische Organisationsmodelle der heutigen netzbasierten Zivilgesellschaft: ein selbstregulierendes System fluktuierender Zusammenschlüsse und spontan, also ›von unten‹ sich formierender Entscheidungsprozesse entspricht erstaunlich genau seiner Definition von Anmut als Freiheit in der Erscheinung. Die reale Leitfigur dieser Anmut aber ist wie selbstverständlich lange Zeit die Kunst – von Schiller bis Warhol oder Beuys.
4
In der europäischen Tradition gilt die Bühne als Ort, an dem die öffentlichen Dinge straffrei verhandelt werden, auch wenn oft genug die Zensur ein gewichtiges Wort dabei mitspricht. Wie weit eine gewisse Interpretation der attischen Tragödie ursächlich an diesem Verständnis beteiligt ist, sei hier nicht erörtert. Brechts Antiaristotelismus, soweit er sich nicht einer Schimäre verdankt, bestreitet nicht den politischen Charakter des älteren Theaters, sondern seine Unparteilichkeit – nach der Parole: Das herrschende Theater ist das Theater der Herrschenden. Die Instanz dieser verborgenen Parteilichkeit ist das Schicksal. Wer Veränderung will, muss folglich das Schicksal von der Bühne verbannen. Mutter Courage hat, ebenso wie die Galileis und Shen-Tes, nur ein Leben und daher nichts zu verschenken, schon gar nicht an katastrophensüchtige Theaterbesucher. Das Theater Brechts gilt weniger dem sozialen Engagement als dem straffreien Experiment, bei dem, nach dem Unveränderlichen, die Veränderung auf dem Prüfstand steht: Was ist not-wendig? Welche Kosten fallen an? Wie veränderlich ist die Veränderung? Diese Aufgabe erben seine abtrünnigen Adepten und das postdramatische Theater spielt es ihnen nach. Warum sollte, wer die Bühne verändert, nicht auch die Welt verändern? Auch andersherum lässt sich fragen: Warum sollte, wer auf der Bühne das Unabänderliche (ανάγκη) negiert, nicht die Botschaft der Negation in die Welt tragen? Eine Art von Pascalscher Wette beseelt das Theater der Veränderung. Hilft es nichts, so schadet es nichts. Im anderen Fall ist der Gewinn immens.
Wenn auf der Bühne Gesten, Sprechakte, Handlungstypen auf ihre ›Veränderbarkeit‹ hin überprüft werden, dann geht es in erster Linie um Verfügbarkeit. Die entscheidenden Fragen lauten: Welche Arsenale stehen zur Verfügung? Welche Teile davon werden de facto benützt, welche bleiben ungenutzt? Welche Wirkungen können erzielt werden, wenn das Ungenutzte zum Einsatz kommt? Wobei immer die Doppelwirkung auf der Bühne und bei den Zuschauern bedacht werden muss, die den Vorteil haben, protestieren und der Veranstaltung fernbleiben zu können. Die Illusion, falls sie aufkommen sollte, der totalen Verfügbarkeit wird durch dieses Zusammenspielwirksam begrenzt. Was dabei ungewollt mit an den Tag kommt, ist der den menschlichen Dingen innewohnende Faktor Beliebigkeit. Gäbe es keine Zuschauer, dann ... ja dann wäre das Bühnengeschehen per se beliebig – gäbe es nur das Urteil der Zuschauer, dann wäre es erzwungen und unabänderlich, es sei denn, die Zuschauer selbst änderten sich.
Hier greift die Schwellenerfahrung der ästhetischen Moderne. Die Zuschauer ändern sich, sie haben sich schon verändert, sie ändern sich wirklich, aber wie sie sich ändern, entzieht sich dem Einfluss des Theaters. Eher drängt es das Theaterwesen selbst ins Abseits des gesellschaftlichen Bewusstseins. Betrachtet man den Vorgang mit den Augen der Theatermacher, dann ist der Wandel daher gleichermaßen zwingend und kontingent. Das erklärt, warum aus dem Theater der Revolution, also der für notwendig gehaltenen Veränderung, binnen einer Generation ein Theater der Beliebigkeit(en) werden konnte. Die Beliebigkeit tritt nicht zu Tage, solange das politische Glaubensbekenntnis intakt ist: Wer schon weiß, was er begreifen soll, bei dem liegt die Beliebigkeit im Begreifen, nicht im Begriffenen oder zu Begreifenden, das vor ihm liegt. Offenbar wird sie, sobald der Glauben an das Kampfziel diffundiert. Wo sich die Choreographie des Abfalls ähnelt, steht dahinter nicht die alte Notwendigkeit, sondern die Beliebigkeit der Gattung selbst, der fatale Wurf, dessen Urheber ›Natur‹ zu nennen einem Rückfall in alte Sinnstiftungsrituale gleichkäme.
5
Thesen über poetische Gerechtigkeit
- Der Grundgedanke der poetischen Gerechtigkeit ist einfach: Die Guten sie gen, die Bösen haben das Nachsehen. So sah es das 17. Jahrhundert, in dem der Begriff aufkam, so sieht es der Normalzuschauer heutiger Fernsehkrimis noch heute. Siegen die Guten, beruhigt sich das Gemüt, siegen die Bösen, bleibt ein Stachel zurück: So soll, so darf es nicht bleiben. Ein solcher Schluss muss umgeschrieben werden, ob auf dem Papier oder in der Wirklichkeit, bleibt dabei erst einmal außer Betracht, wenngleich nicht völlig.
Natürlich geht es ums wirkliche Leben, um die Verhältnisse, wie sie sind und wie sie, nach dem Maßstab normativer Gerechtigkeit, nicht bleiben dürfen, es sei denn, sie bewegen sich sittlich in zustimmungsfähigen Bahnen. Der Theatersieg des Guten vermittelt keineswegs das fatale Bild einer Welt, in der es nichts zu verändern gibt. Er ist eine Art vorgezogener Friedensschluss mit der Welt, der den Kämpfer nicht davon entbindet, sich im realen Feld mit alter Verve auf den verbliebenen Gegner zu werfen. Den Grund liefert die elementare Logik der Mimesis: Siegen die Bösen, so siegt das Böse. Wer kann, der mag darin eine Anwendung des Satzes aus der Poetik des Aristoteles sehen, die Dichter seien, anders als die Historiker, mit dem Allgemeinen befasst. Der Schluss vom Bühnen-Bösewicht auf das Böse im Menschen verdankt sich der Theaterkonstellation – er bedeutet Kultur.
Wer ist böse? Wer mir etwas wegnimmt, wer mir schadet, wer mich aufhält - er muss weg. Der Bösewicht muss beiseite geschafft werden, er ist Objekt meiner ungebremsten Aggression. Wenn der Böse im Einzelnen wirksam gedacht wird, liegt darin eine Differenzierung: vielleicht kann man den vordergründigen Bösewicht von der Herrschaft des Bösen befreien, ihn zur Einsicht bewegen, weniger böse machen. Der Böse aber muss erkannt werden, er lässt sich nicht als Person unter Personen dingfest machen. Man braucht also Kriterien, man braucht das Böse als Kriterium, um den Bösen am Werk zu sehen. Angenommen, man versteht die Bühne als moralische Anstalt, also als einen Ort der Aufklärung, dann liegt nichts näher, als den Bösen zugunsten des Bösen zu quittieren. In diesem Schritt liegt der Übergang von der Religion zur Kultur: die religiöse Dimension scheint weiterhin durch, aber sie herrscht nicht unumschränkt. - Mit dem Konzept der poetischen Gerechtigkeit hält das Naturrecht Einzug in die ›schöne‹ Literatur. Was Gott oder die Natur als Recht gesetzt hat, darf auch in ihr nicht ungerächt verletzt werden. La Mesnardière schreibt: Il faut d’ailleurs considérer que le héros infortuné, qui paraît dans la tragédie, nedoit pas être malheureux à cause qu’il est sujet à quelques imperfections, mais pour avoir fait une faute qui mérite d’être punie... Wo die irdische Gerichtsbarkeit versagt, tritt die göttliche Vorsehung auf den Plan.
Vordergründig ist die rächende Nemesis einer mit antiken Bildern vollgesogenen Literatur das ausführende Organ der Vorsehung. Näher betrachtet handelt es sich jedoch um eine Mittler-Instanz: sie vermittelt zwischen Welt-Ordnung und Welt-Unordnung, sie stellt die Ordnung wieder her, aber um den Preis neuer Unordnung und neuer Geschichten, so dass Böses fortwährend Böses gebiert. Die poetische Gerechtigkeit setzt also ›dramaturgische‹ Schnitte: Wenn alles hier, an dieser Stelle endete, wäre alles gut. Jeder Romanschluss spielt Weltende, jedes Bühnenstück Jüngstes Gericht. Das verbleibende Unrecht schreit zum Himmel. Was dort geschieht, bleibt verhüllt. Doch es gibt Hypothesen. - Wie das Naturrecht, so gehört auch die poetische Gerechtigkeit zum Inventar politischer, genauer metapolitischer Begriffe. Der verletzte Ordnungssinn verlangt, dass ›die Rechnung beglichen wird‹. Wo das nicht geschieht, ist die Geschichte für ihn nicht zu Ende. Etwas fehlt, solange das Verbrechen ungeahndet bleibt. Zwischen Bühne und Zuschauer spinnt sich unsichtbar, aber im ›Mitfiebern‹ mitanwesend, die Sorge um das gemeine Wesen, um den Zusammenhalt der Gesellschaft und, soweit diese Differenz bereits gemacht wird, den des Staates. Die Verantwortung für das Ganze (πόλις) etabliert ein festes Urteilskriterium gegenüber dem allzu freien Spiel der Einbildungskraft. Der Autor weiß oder ahnt, was das Publikum von ihm verlangt und er muss diesem Anspruch genügen, soll sein Werk Erfolg haben.
Doch auch das Publikum muss sich dem Bühnen-Anspruch stellen und seine Leidenschaft für sex and crime für die Dauer einer Lektüre oder einer Aufführung bändigen. Über den Bösewichtern der Literatur steht in unsichtbaren Lettern: ›So geht’s nicht.‹ Das scheint trivial zu sein, aber so sicher, wie über jeder mimetischen Tat stehen könnte: ›Gerade so geht’s‹, so sicher ruft jede Mimesis den Unwillen all derer herauf, die sich auf diesem Wege bloßgestellt sehen, und sei es im Verborgenen. Ein gutes Publikum muss nicht gut sein, es muss nur wissen, was gut ist. Auch übermäßige Härte des Geschicks kann gegen das Gebot der Gerechtigkeit verstoßen und so die Darstellung moralisch entwerten.
Aus diesem Gedanken heraus entwickelte der Jurist und Literaturkritiker Thomas Rymer (1641-1713) seine viel beachtete Kritik an Shakespeares Othello. Die spätere Shakespeare-Idolatrie hat seine Argumente verlacht, die political correctness hat sie neu erfunden. Leicht abzutun ist das nicht. Das Begehren nach Ausgewogenheit mag einer an offene Schlüsse und Bühnengreuel ohne Ende gewöhnten Kritik platt oder rätselhaft klingen, aber es kommt nicht von ungefähr. Der ›gerechte‹ Schluss greift stärker in den Motivhaushalt des Einzelnen ein als der offene oder böse. Die für die Dauer eines Theaterabends hergestellte Republik der Guten appelliert an das bessere, in der Verantwortung stehende Selbst, der Einzelne kann sich verweigern, jedoch nur um den Preis der Isolation. Jeder ist sich selbst der nächste Banause. - Ästhetisch scheint das Thema erledigt, aber das scheint nur so. Bei allem Hohn, der rituell über political correctness als Stichwortgeber der Kunst ausgegossen wurde, sollte nicht übersehen werden, dass jede Art von Entgegensetzung strukturelle Abhängigkeiten schafft. In dieser Hinsicht ähnelt die politische Korrektheit sehr jenem Stock mit zwei Enden, als den Dostojewskis Verteidiger in Die Brüder Karamasow die Psychologie bezeichnet. Es muss etwas geschehen: wo immer die Parole – sichtbar oder unsichtbar – über einem Gedicht, einem Roman, einem Theaterstück oder einem Kinofilm prangt, ist die Idee der poetischen Gerechtigkeit nicht weit. Wo kein Gott mehr eingreift, ist Regie gefragt. Das gute Ende, sofern sie es verweigert, wird gleichsam über den Rand den Werks hinaus ins wirkliche Dasein verschoben. Das Publikum bleibt aufgefordert, das Werk zu vollenden, das mit einer himmelschreienden Ungerechtigkeit schließt.
Die säkulare Gestalt der Vorsehung ist das weltumspannende Wir: Wir, die Guten, müssen gegen den Missstand angehen, der uns aus diesem unbefriedigenden Schluss entgegenkommt. Eine Pointe wird dabei leicht übersehen. Das Publikum wird hier in die Position des endlichen Gottes verschoben, dem die Aufgabe zufällt, die Bestie in ihrer jeweils aktuellen Gestalt zu zähmen. Die Kunst versetzt also das Publikum in die Rolle des Staates, wie ihn Thomas Hobbes konzipiert hat. Es hat die Aufgabe zu lösen, die sonst unlösbar erscheint: Wie überwinde ich das Unüberwindliche, das Übergewicht der Interessen, die verhindern, dass das Gute Raum greift und der Mensch dem Menschen ein ›Gott‹ wird?
Doch auch das beste Publikum ist für die Dauer der Vorstellung zur Passivität verurteilt, danach läuft es auseinander. Das weltumspannende Wir ist ein hypothetisches Organ. Verschleiert wird das durch zivilgesellschaftliche Aktivitäten mit semi-öffentlichem Charakter, in denen der Affekt sich – wie in der jüngsten Flüchtlingskrise zu beobachten – ästhetischen Auslauf verschafft, während das wirksame Handeln denen vorbehalten bleibt, die sich zur Kunst rein instrumentell verhalten: Nützt’s nichts, so schadet’s nichts. Kunst macht derweil, was sie immer tat: schöne Gedanken. - So wie es schwerlich eine vollständig nicht-mimetische Kunst geben kann, so ist kaum eine darstellende Kunst vorstellbar, die nicht auf die eine oder andere Weise mit dem Motiv der ästhetischen Gerechtigkeit spielt. Das Schema von Ordnung/Unordnung bewegt quer durch die Kulturen, es zu aktivieren bedarf nur geringer symbolischer Anstöße. Der Konflikt, der dadurch in die Kunst hineinkommt, wird in ihr zwangsläufig zum plot, zum handlungstreibenden Mit- und Gegeneinander der Parteien. Das Abstractum im Spiel ist die ›Handlung‹: jene aristotelische Größe, der das Wort ›Tathergang‹ nur scheinbar einen gesicherten kriminalistischen Boden einzieht. Es ist die Tat, welche Fragen aufwirft, Fragen, die beantwortet werden müssen, wenn sie dem Urteil der Betrachter transparent sein soll.
›Handlung nennen wir denjenigen Teil des Geschehens, der, neben der Tat und ihren unmittelbaren Folgen, erklärt, wie und warum es zur Tat kam.‹ So könnte eine Definition lauten, die ästhetische Mimesis konsequent dem Schematismus der ›poetischen‹ Gerechtigkeit unterwirft. Sie macht, nebenbei, verständlich, warum ein weitgehend literaturabstinentes, latent oder offen kunstfeindliches Publikum sich Abend für Abend von öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten mit Polizeifilmen abfüllen lässt und, falls es das Bedürfnis nach Unterhaltungslektüre anwandelt, vorwiegend zum Kriminalroman greift. Fehlt die Tat, so fehlt das Opfer, fehlt das Opfer, will kein rechtes Interesse aufkommen, die Sache weiter zu verfolgen, stockt das Verfolgungsinteresse, stockt das Bedürfnis generell, sich weiter zu befassen.
Die naheliegende Möglichkeit, diesem feststehenden Konsumverhalten ein Schnippchen zu schlagen, bietet in der Tat der offene Schluss, der wie ein ausgestreckter Finger auf den wirklichen gesellschaftlichen Missstand deutet und in der Realität Abhilfe fordert. Man versteht, warum sich für diese Art von ›Ästhetik‹ (d.h. Ausbeutung eines elementaren Wahrnehmungsschemas) das Epitheton ›politisch‹ eingebürgert hat, man versteht aber auch, dass dem bereits eine verengende Auslegung des Politischen zu Grunde liegt. Politisch (in diesem Sinn) ist nicht das Vertrauen in die Institutionen des Staates und der ›communitas‹, im Zweifelsfall Abhilfe zu schaffen, sondern das Misstrauen in diese Institutionen und der Wunsch, sie im stets gegebenen, durch künstlerische Darbietungen ›bewusst gemachten‹ Zweifelsfall zu zerschlagen – die Option der Revolte – oder durch die eschatologisch-imaginäre Gemeinschaft der Guten – das alltags-postmoderne ›Was tun‹ – zu ersetzen.
Das ästhetische Massenverhalten entspricht einer alltäglichen Abstimmung über die beiden Modelle. Die Resultate sind – relativ – eindeutig und sie bestätigen die Auffassung, dass sich hier zwei Politikvarianten gegenüberstehen: eine, die in den Institutionen des Rechtsstaats und seiner Organe die beste Gewähr für die Einlösung der Gerechtigkeitsforderung sieht, und eine, die die zivilgesellschaftliche Aktion im Zentrum eines unbedingt gesetzten, aber natürlich manipulierbaren Gerechtigkeitsempfindens zu verankern sucht.
Wie sicher die Sendeanstalten sich sind, über das massentaugliche Modell zu verfügen, zeigt die allabendliche Aufladung des Genres mit gerade anliegenden gesellschaftlichen Themen, häufig mit gesellschaftspolitischem Hintergrund. Der Krimi wird zum Knigge: zur durchgespielten Anleitung, mit Konfliktsituationen ›umzugehen‹, ohne das Gesicht zu verlieren oder ›hässlich‹ zu wirken. Gerade dieser Zug beweist, dass die Nachfolge des ›klassischen‹ höfischen Dramas hier zu suchen ist: das Publikum soll über ›Manieren‹ gebändigt und zu bestimmten Formen der Konfliktauslegung und -austragung hin gelenkt werden, während die ›Bösen‹ sich diesen Formen verweigern. Ein Aspekt dieses Modells ist das Motiv der allgegenwärtigen Korruption, das den systemimmanenten Abfall vom System brandmarkt und damit den naiven Glauben an die Integrität der Systemvertreter durch den ›kritischen Blick‹ auf die Verhältnisse ersetzt. Hier lassen sich fließende Übergänge zum konkurrierenden Modell konstruieren – eine Art Küstenschifffahrt für den Normalgeschmack, der sich sträubt, die offenen Gewässer der gesellschaftlichen Negation anzusteuern.
6
Wie politisch ist die Kunst? Eine vorläufige Antwort lautet: Sie ist politischer, als mancher ihr unterstellt, und sie ist weniger politisch, als mancher von ihr verlangt. Fest scheint zu stehen: Im Spannungsfeld der Massen erfährt die Kunst eine Bedeutungseinbuße, von der sie sich nicht mehr erholt. Wenn Einmütigkeit als Grundlage gewaltfreier Herrschaft, besser noch: herrschaftsfreien Zusammenlebens nicht mehr im gemeinsamen Kunsterlebnis und nicht auf dem Grünen Hügel, sondern auf öffentlichen Plätzen erfahrbar wird, bröckelt auch das Bündnis zwischen den politisierten ›Gebildeten‹ und der Kunst. Es verschwindet in dem Maße, in dem zur Repräsentation der Freiheit weder die Beichte ›sub rosa‹ noch die mimetische Expression auf einer Bretterbühne benötigt wird. Beobachten lässt sich dieser Vorgang in wechselnden Schüben. Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs changiert die Kunst oder das, was in der allgemeinen Wahrnehmung von ihr übrig blieb, zwischen Kommerz und Wahn, es sei denn, sie zieht es vor, sich den wechselnden neuen Gewalten anzuschließen, oder sie wird per Dekret zur Botmäßigkeit gezwungen.
Die Freiheit der Kunst endet an der Propagandafront, also dort, wo das Verhältnis zu ihr sich auf Hörensagen und Tinnef beschränkt. Überzeugt werden muss nicht der Gebildete, sondern die Masse. Die Gebildeten geben sich erst dort überzeugt, wo sie ein überzeugendes Massenkonzept wahrnehmen oder wahrzunehmen behaupten. Sich selbst sehen sie eher in der Rolle des Vorkosters, auch wenn das selten explizit so gesagt wird. Das sprechendste Symbol dieser ›postmodernen‹ Masse ist nicht die Barrikade, das Requisit des Klassenkampfes, sondern die Lichterkette, das Licht in der Dunkelheit, das die lange Nacht der Tyrannei besiegt. Die Vorstellung einer innigen Verbindung von Kunst und Barrikade im neunzehnten Jahrhundert beruht auf einem Missverständnis, genauer gesprochen: einer Projektion, die durch die Propagandaformel vom genuin progressiven Charakter großer Kunst einen Schein von Plausibilität gewinnt.
7
Das Dreieck aus Kunst, Publikum und halluzinierter ›Masse‹ wirkt unvollständig, solange die Künstler als Faktor ausgeblendet bleiben. Ihr realer oder unterstellter, angesichts der realgesellschaftlichen Wirkfaktoren eher bizarrer Wunsch, die Vielen zu bewegen, ist nur in Grenzen egalitär. Er ist das Perpetuum mobile, das dem Dreieck Leben verleiht. Dieser Wunsch existiert unabhängig vom Bedürfnis einzelner Künstler, sich öffentlich auszuzeichnen oder in der Gesellschaft eine Rolle zu spielen. Dort, wo er fehlt oder zu fehlen scheint, wird er durch Supposition künstlich ›eingespielt‹: von den Distributoren – Verlagen, Theatern, Filmverleihen –, von der Kritik und notfalls durch wissenschaftliche Nachbereitung. Die bewegte Masse ist das funktionale Äquivalent jener älteren ›Unsterblichkeit‹, die der Renaissancekünstler vermöge eines Ruhms gewinnt, der ihn den Herrschenden zwar nicht in der Gegenwart, aber vor der Nachwelt gleichstellt.
Die Gleichstellung des Künstlers mit den Vielen macht auf andere Weise unsterblich – mittels Partizipation an der Unbetroffenheit der Masse durch die endliche Existenz des Einzelnen. Politisch daran ist die Behandlung der Lücke, die sich zwischen der individuellen Wirkabsicht und der Unerreichbarkeit der Vielen auftut. Die Arbeit daran, ›vernommen‹ zu werden, ist harte Überzeugungsarbeit. Sie lässt sich nur mit Hilfe eigener starker (oder lautstark vertretener) Überzeugungen bewältigen. Diese müssen, um ihre Funktion zu erfüllen, der Aufgabe strukturell gewachsen sein. In der Praxis leistet das ein Okkupationsmodell, das die Befreiung vom Besatzungsregime des schlechten Geschmacks – ›falscher‹ Seh-, Lese-, Hörgewohnheiten – mit dem Ende politischer Unfreiheit zusammendenkt.
Auf diese wenig erstaunliche, allerdings selten ganz überzeugende Weise wird aus jedem Künstler, der (noch) nicht völlig im Kommerz aufgegangen ist, ein Vorkämpfer einer besseren Menschheit. Die damit verbundene Erwartung ist eine besondere Form der Naherwartung, die eo ipso mit jeder Widerstandshandlung, mit jeder Revolte, mit jedem Massenereignis mitfiebert, um es ebenso rasch wieder fallen zu lassen, wenn die öffentliche Aufmerksamkeit erlahmt oder das geplante eigene ›Projekt‹ dazu sich nicht verwirklichen lässt. Was wie Solidarität aussieht, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine besondere Form der Gleichgültigkeit, bei der ein Ereignis grundsätzlich so gut wie ein anderes zum Vehikel der Erzeugung von Aufmerksamkeit taugt.
8
Als der westdeutsche Filmregisseur Hans-Jürgen Syberberg in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts seine Idee des ›demokratischen‹ Films formulierte, lag er programmatisch auf einer Linie mit einer kleinen Gruppe von Filmemachern, die damals den ›Neuen deutschen Film‹ formierte. Anders als das Theater, in dessen Räumen der Demos nur durch ein verwickeltes System von Repräsentanzen hindurch in Erscheinung tritt, galt der Film – jedenfalls vor der flächendeckenden Installation des Fernsehens und den Tagen des Internet – lange Zeit als das moderne Massenmedium und durfte sich in dieser Rolle der Aufmerksamkeit von Politik und Propaganda sicher sein. Nicht ohne Grund verrechnen Eingeweihte ideologisch hoch verstrahlte Propagandafilme wie Sergej Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin und Leni Riefenstahls Triumph des Willens als Meisterwerke der Menschenbeeinflussung und als Höhepunkte der Filmgeschichte. Der ›demokratische‹ Nachkriegsfilm lehnt sich an italienische und französische Muster an, aber als Faszinosum, als Vor- und Gegenbild ist die ›Traumfabrik‹ Hollywood, in der Kommerz und Mythenproduktion zur unauflöslichen Einheit verschmolzen sind, allgegenwärtig. Wer neben Hollywood bestehen will, muss vor der kollektiven Macht seiner Bilder bestehen und der Konkurrenz an den Kinokassen standhalten.
Der ›neue deutsche Film‹ der Fassbinder, Schlöndorf, Syberberg, Wenders soll damals, gleichsam als Konterbande, dem Kommerzkino Paroli bieten – ideologisch, ästhetisch und, nicht zu vergessen, im national-kulturellen Interesse. Dazu ist er auf Förderung angewiesen, die aus staatlichen bzw. halbstaatlichen Töpfen fließt. Gleichzeitig bleibt ihm aufgetragen, den kommerziellen Erfolg zu suchen und die Startinvestitionen ökonomisch zu rechtfertigen. Syberberg hat – wie andere neben und nach ihm – erkannt, dass diese Konstruktion ein Dilemma birgt: die Verbindung von politischer, ›ästhetischer‹ und ökonomischer Steuerung verwischt Selektionskriterien und befördert (wie auf anderen Feldern administrativer Investitionslenkung auch) Fehlentscheidungen, die sich leicht zu mehr oder wenigen fatalen Trends summieren.
Am Ende läuft das Modell auf ein verschleiertes Kommerzdiktat hinaus. Syberberg plädiert daher für eine Neuauflage des bürgerlichen Erfolgsmodells Theater. Analog zu öffentlichen Bühnen sollen öffentliche Filmtheater eingerichtet werden, in denen der Kunstfilm seine adäquate, vom Kommerz abgekoppelte Darbietungsstätte erhält. Die Filme sind da, es fehlen die Häuser und ihre Organisationen sie vorzuführen. Und es war immer in Zeiten der Not, der Identitätssuche, wenn in Deutschland die Forderung und Sehnsucht nach einem Nationaltheater aufkam. In gewisser Weise nimmt das staatliche Fernsehen, das in jenen Jahren Gestalt gewinnt, diesen Impuls auf. Doch abgesehen von der technisch unzulänglichen Darbietungsform erweist sich das Verdikt der Einschaltquoten rasch als ähnlich fatal für die Kunst wie das Diktat der Kassen.
9
Was ist das für ein Kino, das den Kontakt zu den Massen gleichermaßen sucht wie fürchtet? Man könnte, ideologiegeschichtlich argumentierend, von elitärem Egalitarismus sprechen und träfe damit eine ganze Intellektuellenkultur, deren öffentliche Wirksamkeit in jenen Jahren einem Höhepunkt zusteuerte. Dass Syberberg nicht zum Umfeld der Frankfurter Schule um Adorno und Horkheimer gehört, macht den Fall verwickelter, aber auch einfacher. Syberbergs ›Demos‹ ist das Filmpublikum und die Geschichte des Films gerät in seiner Darstellung zur ästhetisch-politischen Selbstoffenbarung dieses Publikums.
Hitler. Ein Film aus Deutschland, der Titel seines bekanntesten Films (1977), benennt wohl nicht nur einen Film über Hitler sowie die Tatsache, dass dieser Film in Deutschland entstand, sondern suggeriert auch, dass dieses Leben in filmischen Kategorien und für ›den Film‹ oder die Leinwand geführt wurde – so als habe das Dritte Reich der Nationalsozialisten mehr mit der kurzen Geschichte des Kinos und seinen darstellungstechnischen und massenkommunikativen Aspekten zu tun als mit der politischen Geschichte Deutschlands und Europas. Die Kommunikation des ›Führers‹ mit den Massen sucht (und braucht) das Aufzeichnungsmedium, das die ewige Wiederkehr des Gleichen garantiert, nicht etwa, weil beide Seiten ›ihren Nietzsche‹ gelesen hätten, sondern weil diese Form kollektiver Ekstase sich erst in der archivfähigen Reproduktion vollendet – als Nummernfolge vor dem Hintergrund eines als ›Weltgeschichte‹ interpretierten Ewigkeitsphantasmas. Dieses Medium ist der Film, die Filmkonserve, an deren Zustandekommen das direkte Geschehen und das vom Rundfunk ›ausgestrahlte‹ Tondokument als Teilaspekte der angestrebten künstlerischen Gesamtwirkung des Weltspektakels einen gewissen Anteil besitzen. Film und Filmwirkung gehen ineinander über. Entsprechend mischt der Film Dokumente aus der Geschichte des Films und der Filmgeschichte des Dritten Reiches.
Was kann, was soll ein solcher Film leisten? In gewisser Weise kehrt in ihm das Gerechtigkeitsaxiom des Thomas Rymer als Kino-Regel wieder: zugelassen wird nur soviel ›Schicksal‹, wie Motive im Spiel sind. Wo alle Motive im Spiel sind, wird die Kamera zum einzigen legitimen Selektor, der darüber entscheidet, was vom Aufstieg und Fall des Dritten Reiches in die Annalen des Films gelangt. In dieser Hinsicht ist auch Syberbergs Film nur ›ein Film‹ unter anderen. Er bedarf daher weiterer Selektoren und er findet sie: einerseits im Bayreuther ›Gesamtkunstwerk‹, andererseits in der Ästhetik der ›Bewusstmachung‹, die schon Thomas Mann für seinen Roman Joseph und seine Brüder reklamierte und die im medialen Jahrzehnt 1967 – 1977 in progressiven Kunstkreisen Westeuropas relativ unumschränkte Geltung beansprucht.
In die Sprache der Filmanalyse übersetzt heißt das: die Handlung – ein relativ unbedarftes Wort für eine verwickelte Sache – bewegt sich in der Spur des Gralsmythos als Vorlauf des Hitlerschen Weltspektakels, die Bildsprache des Films ersetzt die Hauptakteure dieses Spektakels, allen voran den großen Kommunikator, durch Marionetten, offensichtlich, um sie ›befragbar‹ zu machen – natürlich auch, um die Suggestivität des historischen Materials zu brechen. Aber wenn hier ein Rest Verfremdung à la Brecht im Spiel ist, so unterläuft die dadurch gewonnene Intimität des ›Spiels‹ die Distanz unterkühlter Betrachtung. Ich habe den ästhetischen Skandal versucht, Brechts Lehre vom epischen Theater mit der Musik-Ästhetik Richard Wagners zu kombinieren, im Film das epische System als anti-aristotelisches Kino mit den Gesetzen eines neuen Mythos zu verbinden. Eingeweihte wissen, was das heißt.
Syberbergs Form der Bewusstmachung verlegt das Objekt in die Psyche des Betrachters und überlässt es dort seinem Schicksal – besser gesagt, beider Schicksal. Der didaktische Kunstgriff erzeugt eine radikal antididaktische Kunst, die den Film Hitler im Zuschauer zu Ende bringt: als seine beschwiegene Anwesenheit im lebendigen Heute und im Schaudern, das sie bezeugt. Und nachdem wir keinen Hitler haben im Käfig zum Ausstellen, und zum Anspucken, zum Treten oder Handküssen, für ein paar Mark für jeden von uns, je nach seinem Gusto, wie seinerzeit die Lola Montez für einen Dollar im amerikanischen Zirkus berührt werden durfte, schlage ich vor, jeder spielt sich selbst, spielt hier vor allen anderen seinen Hitler. (Filmszene)
10
Man kann nicht sagen, das deutsche Publikum habe sich dieser doppelten Zumutung nicht gewachsen gezeigt. Wie der Filmemacher monierte, bekam es sie kaum zu Gesicht. Das hatte, neben eher banalen Querelen, sicher politische Gründe. Doch so zu argumentieren setzt voraus, dass politische Kunst unter politischen Gesichtspunkten bewertet und verworfen werden darf und soll: so dass selbst die Ablehnung der Ablehnung, wo sie erfolgt, sich politisch legitimiert. Natürlich waren es stets politische Gründe, sobald die Ahnung einer Zensur am Horizont einer ausgefallenen ›Rezeption‹ aufscheint.
Wo die rechtlich verbürgte Freiheit der Kunst die staatliche Zensur verbietet, greifen gesellschaftliche Mechanismen, die – manchmal geräuschlos, manchmal spektakulär – dafür sorgen, dass die Bäume von Dissidenz und Kritik nicht in den Himmel wachsen. Was den Fall Syberberg so kurios erscheinen lässt, ist der Umstand, dass hier ein Werk dem öffentlichen Verdikt verfiel, das ansonsten wohlgelittene Komponenten zu einem Projekt bündelte, das im Kern nicht politisch, sondern ästhetisch motiviert war: politisch nur insofern, als die Wirkbedingungen des Massenmediums Film den öffentlichen Raum tangieren, der stets einer gewissen politischen Kontrolle unterliegt.
Dass dabei auch für den politischen Verstand etwas abfallen kann, bleibt generell unbestritten. Ein Grund könnte darin liegen, dass im gleichen Jahr der nicht mehr ganz so neue deutsche Film unter dem Druck der RAF-Ereignisse eine radikale Wendung vollzog (5. September 1977: Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer, 13. Oktober Entführung der Lufthansa-Maschine »Landshut«, Nacht vom 17. zum 18. Oktober 1977: die Selbstmorde von Stammheim, 19. Oktober: Fund der Leiche von Hanns-Martin Schleyer in Mülhausen, 5. November 1977: Syberbergs Filmpremiere in London): weg von der Ästhetik der Bewusstmachung – die das Involviertsein des Zuschauers ausbeutet – und hin zu einer nun wirklich ›politischen‹ Freund-Feind-Orientierung, als deren erstes Dokument vermutlich der von seinem Arrangeur Alexander Kluge so genannte ›Omnibusfilm‹ von 1978, Deutschland im Herbst, gelten kann. Wer im Omnibus der Gruppensolidarität reist, reist jedenfalls nicht allein: Gesinnung, soeben noch eine Hohn und Spott herausfordernde Instanz, schweißt zusammen und bestimmt, wer dazugehört und wer nicht.
11
›Kunst‹ als Wagenburg, als Gemeinschaftsprojekt eines ideologisch verschwisterten, im beruflichen Alltag nur locker assoziierten, aber bei bestimmten Anlässen durch das Gefühl einer diffusen Bedrohung aus dem staatlich-gesellschaftlichen Raum zusammengedrängten Macher-Clans, einer ›Ethnie‹, wie der importierte sozialwissenschaftliche Terminus lautet, zielt vor allem auf das Kunstprivileg: die gesetzlich garantierte, über die bloße Freiheit der Meinungsäußerung deutlich hinausgehende Freiheit der Kunst. In den liberalen Gesellschaften des Westens wird sie als hohes Gut gehandelt: als Lackmus-Test an der Grenze zwischen Kultur und Barbarei. Entsprechend bemisst sich die mobilisierbare öffentliche Empörung, sobald der Eindruck entsteht, sie sei in Gefahr.
Wie jedes Privileg wird auch dieses zu einer Quelle von Korruption, sobald Gruppie rungen auftreten, die diesen Eindruck systematisch zu erzeugen wissen – vor allem dann, wenn sie ausreichend gut vernetzt sind, um sich der Aufmerksamkeit der Medien sicher zu sein. Wie jede Korruption hat auch diese zwei Gesichter, je nachdem, ob das Bedürfnis der Gruppe, sich öffentlich zu profilieren, oder das Interesse der Medien am Spektakel obenan steht. Gegenüber dem unmaskierten privaten Geltungsdrang, der sein Skandalbedürfnis aus intimen Beichten und Verdächtigungen bestreitet, besitzt der reklamierte politische – besser: semi-politische – Verfolgtenstatus den Vorteil, dass die Motive der Akteure für das Publikum nicht erkennbar werden. Es darf also spekuliert werden: nichts dient der Verweildauer einer Sache in der Öffentlichkeit besser als kontroverse Meinungsspektren, die es den einschlägigen Instanzen erlauben, sich zu Wort zu melden und die Kuh ›Publicity‹ bei dieser Gelegenheit gleichfalls zu melken.
Bei alledem steht außer Frage, dass in vielen Ländern politische Verfolgung von Künstlern und Literaten eine reale Dimension besitzt. Kein Zweifel auch, dass Kunst in vielen Fällen als Vehikel dient, um politische Ideen zu kommunizieren, deren direkte Verbreitung unter die Zensur fällt. Kein Zweifel aber auch, dass die in den Ländern der Sekurität öffentlich geübte Solidarität der Künstler und Szenen eine (selbst-)legitimatorische Funktion erfüllt, wofern sie nicht gleich zum Spielball fremder – vor allem: kunstfremder – Interessen dient: Seht her, es geht um dieselbe Sache – hier wie dort. Eine Kunstwahrnehmung, die der Logik des Spendenaufrufs folgt, mag den Gesetzen der Mediengesellschaft konform sein, die Logik der Kunst allerdings ist daraus längst entwichen. Für manche wäre das leicht zu verkraften, solange das Menschheitsziel stimmt. Leider ist über den Aufklärungsgehalt einer Kunst und ihrer Parolen nichts entschieden, die nur darin Kunst sein will, dass sie das Kunstprivileg zweckmäßig plündert.
12
Ergeben die aus tausenden hochgereckter Handys aufgenommenen und ›ins Netz gestellten‹ Videos von Massenkundgebungen und Gemetzeln, einzeln oder zusammengenommen, Kunst? Die Frage kann all denen nicht schmecken, deren Existenz, ökonomisch und ideell, auf der Produktion von Kunstwerken und ihrem Vertrieb beruht. Dennoch kann sie nicht zum Verschwinden gebracht werden. Kurrente Vorstellungen vom Netz als Kunstwerk, als materiellem Prozess und Spiegel kollektiver Bewusstwerdung der einen Menschheit, formulieren in Bezug auf die Wirklichkeit dieses Mediums bestimmte Erwartungen neu, die bereits der amerikanischen wie der russischen Revolution inhärent waren.
Auch Bretons programmatischer Surrealismus spekulierte auf das Ende des Kunstwerks und die Transformation des in der Kunst wirksamen ästhetischen Impetus in eine kollektive Bewusstseinsdynamik. Neben dem Netz als integrativem ›Hypermedium‹ bestimmt der Stand der Aufnahme- und Bearbeitungstechniken den Grad der Realisierbarkeit. Technik, einst der schwierige, weil schwer – und nur von wenigen – zu beherrschende Teil der Kunst, ist, jedenfalls im Bereich der visuellen Medien, zum Jedermannsartikel geworden, dessen Beherrschbarkeit allenfalls in Grenzbereichen Probleme aufwirft.
Die Zurückbettung der Kunst ins – technisch versierte – ›Leben‹, seine Abenteuer und Kämpfe, zusammen mit dem augenblicklich erfüllten Bedürfnis, den Augenblick festzuhalten, als gewönne er durch diese Art von artifizieller Fortdauer einen Extrawert, verspricht einen egalitären Zugewinn gegenüber früheren Formen der Kunstproduktion. Man kann diesen Effekt ›politisch‹ interpretieren und zweifellos ist vieles davon politisch gemeint. Doch das gilt weniger dem Effekt der Dauer als dem der zeitnahen Kommunikation über beliebige Distanzen hinweg. Die praktisch-künstlerische Reflexion aufs Medium als Träger ästhetischer Sensationen spielt darin eine nachgeordnete Rolle. Es bedarf einer Blasiertheit, die mit den Obsessionen der Künstler durch ist, um aus der Verfügbarkeit der Produktions- und Distributionsmittel auf die Verfügbarkeit der Kunst zu schließen, als käme es weniger auf ihren weisen Gebrauch an als auf ihren ›instantanen‹ Einsatz zu leicht zu verstehenden Zwecken.
Erstdruck (mit leichten Abweichungen sowie Anmerkungen) in: Werner Daum, Wolfgang Kruse, Eva Ochs, Arthur Schlegelmilch (Hg.), Politische Bewegung und symbolische Ordnung. Hagener Studien zur Politischen Kulturgeschichte, Festschrift für Peter Brandt, Bonn 2014, S. 59-75