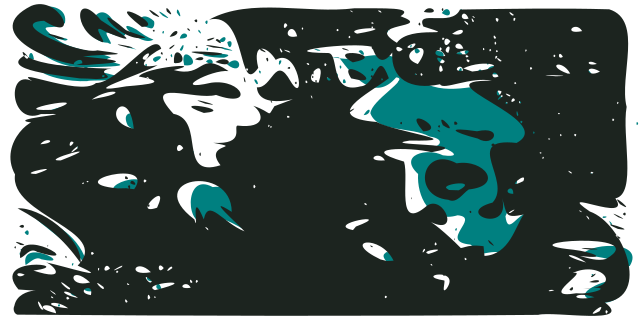von Dietrich Harth
Vorbemerkungen
Zu den forschungspolitisch wirksamsten Initiativen an deutschen Universitäten gehören seit Jahren die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beratend und finanziell geförderten interdisziplinären Projekte, die sogenannten ›Sonderforschungsbereiche‹, abgekürzt: SFB. Die Einrichtung eines SFB an einer Universität setzt die Bereitschaft der Professoren voraus, mindestens 4 Jahre lang zusammen mit jungen NachwuchswissenschaftlerInnen in interdisziplinärer Weise ein für die Neuorientierung mehrerer Einzelfächer und Fakultäten wichtiges, vor allem auch neues Forschungsthema zu behandeln. Ist das Thema erst einmal gefunden, beginnt eine mehrere Jahre dauernde Diskussion zwischen den beteiligten Fächern.
Eine Planungsgruppe wird gegründet und schließlich ein umfangreicher, sehr detaillierter Antrag verfasst, den die DFG an eine Gutachterkommission weitergibt, in der wissenschaftliche Experten anderer Universitäten zusammenarbeiten, um den Antrag zu evaluieren, um ihn entweder abzulehnen oder zu befürworten. Wird der Antrag in den ersten Gutachtergesprächen befürwortet, dann besucht die Kommission die antragstellende Universität, um die Antragsteller und potentiellen Mitarbeiter im geplanten SFB vor Ort zu prüfen.
Kurz, die mehrere Jahre erfordernde Vorbereitungszeit, das Verlangen der DFG nach einer außerordentlich gut begründeten Antragstellung und die strengen Prüfungen durch die Gutachter stellen eine Herausforderung dar und verlangen nicht nur einen erheblichen Aufwand an Planungs- und Diskussionszeit, sondern setzen auch die Bereitschaft aller Beteiligten voraus, sich auf neue Formen der Zusammenarbeit (Teamwork) einzulassen. Geistes- und Kulturwissenschaftler haben selten Erfahrungen mit solchen gruppenbezogenen Interaktionsformen gemacht und begeben sich daher bereits während der Planungszeit in einen bis dahin ungewohnten Lernprozeß, in dessen Verlauf sie Gelegenheit haben, die für jeden Wissenschaftler verbindlichen Tugenden des Zweifelns, des Zuhörenkönnens und der Selbstkritik weiter auszubilden. Bereits in der Vorphase des SFB macht sich also ein Effekt bemerkbar, der durchaus schon zum Prozeß der Neuorientierung gehört und viel mit dem Zugewinn an Sozialkompetenz in der wissenschaftlichen Kommunikation zu tun hat.
Es ist von großer Bedeutung für den allgemeinwissenschaftlichen Wandel, daß das SFB-Modell, wenn es gut funktioniert, auch den geistigen Wettbewerb fördert. Andere, weniger aufwendig angelegte Forschungsinitiativen und Innovationsansätze haben sich von diesem Modell anregen lassen, eigene interdisziplinäre Projekte zu entwickeln, die - finden sie die Zustimmung einer Gutachtergruppe - von anderen namhaften, die Wissenschaften fördernden Stiftungen finanziell unterstützt werden.
Die beiden Sonderforschungsbereiche, die ich im folgenden als Beispiele heranziehen werde, sind in verschiedenen Universitäten beheimatet, haben aber längst über die lokalen Grenzen hinaus Einfluß auf die Entwicklung der kulturwissenschaftlichen Grundlagenforschung genommen. Es handelt sich um den SFB Erinnerungskulturen (http://www.uni-giessen.de/erinnerungskulturen/home/index.html) an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und um den SFB Ritualdynamik (http://www.ritualdynamik.uni-hd.de/) an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Beide werden von der DFG gefördert, nicht um die theoretische Vielstimmigkeit zu reduzieren, sondern um diese nach Ton- und Spielarten zu differenzieren, sie auch, wenn es gelingt, zu erweitern und bestenfalls neu zu orchestrieren. Um die theoretischen Orientierungen dieser Sonderforschungsbereiche zu kennzeichnen, benutze ich die Begriffe »Ritualistik« und »Mnemonik«. Das sind Wortbildungen nach Art von Semiotik oder Rhetorik, und mit eben dieser Gestalt verbinden sich auch Fragen wie die nach der inter- bzw. transdisziplinären Anwendbarkeit der mit ihrer Hilfe zu definierenden Theoriefelder und Verfahrensweisen. Denn das Erinnern und das Rituelle bezeichnen, so lautet die hier zugrunde gelegte These, universelle Spielarten kultureller Symbolisierung und sind daher nicht in die Grenzen eines einzigen Spezialfaches einzuschließen. Es ist ja kein Geheimnis: Über Ritualisierungen und Erinnerungsprozesse machen auch die Verhaltenswissenschaften (Ethologie), die medizinischen Wissenschaften und die Neurobiologie Aussagen. Die Besonderheit der geistes- und kulturwissenschaftlichen Fragestellungen aber zeigt sich schon darin, daß die Bedeutungsgeschichte der lateinischen Stammwörter rituale et memoria zur Binnenstruktur dieser Fragestellungen gehören. Was ihre Geschichte, linguistische Assimilation und terminologische Reformulierung betrifft, so sehe ich in ihnen sogenannte »Traditionsbegriffe«, die ihre Polyvalenz nicht nur ihrem Alter, sondern auch einem weit verbreiteten bildungssprachlichen Gebrauch verdanken.
Umbau der Geisteswissenschaften
Beginnen will ich nach diesen Vorbemerkungen mit einem politisch relevanten Eindruck, der, wie ich zugeben muß, einem etwas pauschalen Blick auf die institutionalisierten, über längere Zeiträume subventionierten Forschungsvorhaben an deutschen Universitäten zu verdanken ist. Ich meine die Vorhaben, die auf einen behutsamen Umbau der Geisteswissenschaften zielen, eine bewußte Veränderung, die zwar an ältere kulturwissenschaftliche Traditionen anknüpft, aber diesen nicht einfach nachfolgen möchte. Wissenschaftspolitisch bedeutsam ist nicht nur dieser Umbau, politisch wirksam sind auch bestimmte Themenkonzentrationen innerhalb der von verschiedenen Stiftungen subventionierten Projekte und – davon ausstrahlend – der beteiligten Hochschulen. Denn diese Projekte sind darauf angelegt, die herkömmlichen forschungs- und hochschulpolitischen Organisationsparameter zu verändern. So sehr sich auch die Initiativen im einzelnen – ich beziehe mich hier nicht nur auf Sonderforschungsbereiche – in der Materialauswahl, der Personen- und Fächerzusammensetzung unterscheiden, eine nicht geringe Zahl von ihnen teilt sich dennoch in einige konzeptionelle Dominanten. Und auf diese möchte ich hier als Nächstes den Blick richten, um Mutmaßungen über einige allgemeine wissenschaftspolitische Trends anstellen zu können.
Zu den erwähnten Dominanten gehören – ich nenne einige der bekannten Schlagwörter – »Theatralität« oder »Inszenierung«, »Performance« oder »Performativität«, »Gedächtnis und Erinnerung«, »Symbolik« oder »Symbolisierung« und nicht zuletzt »Ritual« und »Ritualisierung«. Diese Aufzählung oberflächlich zu ordnen, ist nicht schwierig: Inszenierung, Performance und Ritual sind handlungsbeschreibende Ausdrücke, die beobachtbaren Phänomenen gelten und auf institutionelle Verfestigungen verweisen; Gedächtnis, Erinnerung und Symbolik sind, konventionell gesprochen, Bezeichnungen für mentale, der unmittelbaren Beobachtung entzogene Prozesse. Nur »Theatralität« erscheint auf den ersten Blick als eine alles umgreifende Genrebezeichnung, die nicht nur zu den Konstruktionen symbolischen Handelns auf der Bühne und während ritueller Inszenierungen, sondern auch zur Metaphorik der Gedächtniskunst (im Sinne des theatrum memoriae) paßt. Ein Zufall ist das nicht, da »Theatralität«, so altehrwürdig dieses Wort auch klingen mag, im Kontext wissenschaftlicher Neuorientierungen auf Aspekte der Medialität und elektronischen Virtualisierung anspielt, die auf allen Ebenen der kulturellen Systeme die Art und Weise öffentlicher Präsentation und Wahrnehmung verändert haben. Eine These, die ich sofort näher erläutern möchte, zumal sie etwas von dem Zeitgeist beschwört, der sich in der Formel von der »späten Moderne« verbirgt.
Zum Ausgangspunkt nehme ich einen Satz, der in dem Mitte der 90er Jahre als Rundschreiben kursierenden DFG-Schwerpunktprogramm »Theatralität« mit dem nicht gerade bescheidenen Untertitel »Theater als kulturelles Modell in den Kulturwissenschaften« nachzulesen ist. Dort heißt es: »Unsere Gegenwartskultur konstituiert und formuliert sich zunehmend nicht mehr in Werken, sondern in theatralen Prozessen der Inszenierung und Darstellung, die häufig erst durch die Medien zu kulturellen Ereignissen werden.« Eine revolutionäre Einsicht ist das nicht, umso wichtiger aber ist ihre Bedeutung für das neue forschungspolitische Programm, das damals im Jahre 1995 sogar den Anspruch eines »Pilotprojekts« erheben konnte. Geplant war ein Programm, das sich nur im Zusammenwirken verschiedener Disziplinen, also interdisziplinär, realisieren läßt. Denn es geht, wie der oben zitierte Satz andeutet und das Rundschreiben des weiteren ausführlich darstellt, nicht etwa um Theatergeschichte, sondern um einen Modus kultureller Produktion, Wahrnehmung und Konsumtion, der, aus der Perspektive theatralischer, also dramaturgischer Inszenierungsprozesse betrachtet, als dynamisches und zugleich energetisches Potential zu begreifen ist. Ich darf es noch einmal in einfacherer Form sagen: Kultur soll demnach nicht als Monument begriffen werden, sondern in ihrer Veränderlichkeit als Prozeß, als ein ständiges Werden. Eine solche Betrachtungsweise implizert eine Perspektive, die selbstverständlich auch die Mobilität der Herstellenden und Handelnden, also der Produzenten und Konsumenten sowie der Vermittler einschließt.
Was das forschungspolitisch bedeutet, liegt auf der Hand: Soll das Programm der Neuorientierung Erfolg haben, so sind nachhaltige Kooperationsvereinbarungen zwischen den historisch-philologischen Disziplinen (zum Beispiel: Literatur-, Sprach- und Geschichtswissenschaften) den empirisch operierenden Erfahrungswissenschaften (zum Beispiel: Soziologie und Ethnologie) geradezu zwingend. Das ist angesichts der in den Universitäten verbreiteten Lagermentalität eine ziemliche Herausforderung - aber das ist ein eigenes, hier nicht weiter zu vertiefendes Thema. Wenden wir uns lieber noch einmal dem zitierten Satz, und zwar jener Stelle zu, an der es heißt, unsere gegenwärtige Kultur konstituiere sich »nicht mehr« in Werken, sondern in Prozessen. Was bedeuten diese zwei Wörtchen »nicht mehr«? Heißt es: früher war alles anders, war Kultur einfach da, unzerstörbar und monumental wie ein Gebirgsstock? Das doch wohl nicht. Aufgrund der ausführlichen Teile des Schwerpunktprogramms ist vielmehr anzunehmen, daß diese verkürzte Aussage den mit Kultur (ich übersetze den Begriff Kultur gern mit »Gefüge symbolischer Ordnungen«), also den mit der Analyse des Gefüges symbolischer Ordnungen vertrauten Wissenschaften einen Perspektivenwechsel nahelegt, der morgen schon wieder eine andere Wendung, einen neuen »turn«, nehmen kann. Das Programm erscheint mir daher wie der Zukunftsentwurf kulturwissenschaftlicher Arbeit ohne eindeutiges Ziel, ein Tummelplatz für methodologische Revisionen und analytische Erprobungen konventioneller Theorien, kurz: eine Aufforderung, sich in kreativer Freiheit zu üben.
Die typische Gutachterfrage an eine interdisziplinär zusammengesetzte Forschergruppe »Und welcher Theorie folgen sie denn nun?« geht angesichts des Versuchsstadiums solcher Neuorientierungen an der Sache vorbei. Jede Einheitstheorie würde die vom institutionalisierten Zweifel befeuerte fächerübergreifende Gruppenkommunikation stören, ja vielleicht zerstören. Was diese Kommunikationen wie ein Perpetuum mobile vorantreibt, ist die stille Überzeugung, daß der Wissenschaft nichts heilig sein darf, sie selber eingeschlossen. Natürlich läuft das auf eine selbstkritische Dauerreflexion innerhalb der Wissenschaften hinaus, mit der diese ihren eigenen Autoritätsanspruch in Fragen des Wissens unterminieren müssen. Eine Paradoxie, aus der es keinen billigen Ausweg gibt. Denn in dieser Paradoxie spiegelt sich das Verhältnis des wissenschaftlich produzierten Wissens zur reflexiv gewordenen Moderne, die Soziologen als 'späte' oder 'zweite' Moderne bezeichnen, und die ein fundamentaler »Strukturbruch« mit den heroischen Errungenschaften der ersten Moderne, nicht zuletzt mit dem Vertrauen in die Glücksversprechen der etablierten Wissenschaften charakterisiert. Auch dafür ist übrigens ein Sonderforschungsbereich zuständig: der Münchner SFB mit dem Titel Reflexive Modernisierung (http://www.sfb536.mwn.de), dessen Forschungsprogramm allerdings nicht jenem allmählichen Übergang von der Tradition zur Moderne gilt, den die historischen Disziplinen zu rekonstruieren suchen, sondern den Unsicherheiten, die eine kaum gebremste, von den Wissenschaften angestoßene und geförderte Modernisierungs- und Risikodynamik erzeugt.
Nun sind die wissenschaftlichen Perspektivenwechsel, von denen hier die Rede ist, zwar willkürlich, aber sie sind das doch nur in dem Maß, in dem die Veränderungen der gelebten Erfahrungswelt auf sie zurückwirken. Davon geht der Münchner SFB ausdrücklich aus. Die ihm angeschlossenen Forscher suchen nach dem Sinn dieser, oder schlichter: nach Antworten auf diese Veränderungen und begreifen sie insofern als Fragenkomplexe. Eben das ist aber auch im zitierten Entwurf des Theatralitäts-Projekts der Fall, denn es würde wenig Mühe kosten, den Beweis für die mediale Konstitution kultureller Akteure, Objekte und Praktiken in den OECD-Gesellschaften anzutreten.
Warum aber soll das Theater (so ist kritisch zu fragen) den Kulturwissenschaften, wie es im zitierten Programm heißt, zum »Modell« dienen, warum nicht eine modernere Konstruktion wie zum Beispiel die Organisationsstrukturen des Kulturmanagements oder der Agenturen der medialen Massenkultur? Darauf gibt das Schwerpunktprogramm mehrere Antworten, von denen die folgenden für unser Thema besonders interessant sind: Erstens ist die Vorstellung der Welt als Bühne (theatrum mundi) eine sehr alte Leitidee in der europäischen Kulturtradition, und zweitens ist das Konzept der auf einer Bühne interagierenden Rollenträger längst als Modell für soziologische und psychologische Handlungsanalysen in Gebrauch; man könnte in diesem Zusammenhang auch auf das »Drama« in seiner Funktion als Metapher für die methodische Konstitution komplexer Handlungsprozesse in Fremdkulturen hinweisen, eine Variante, die nicht zuletzt in den Ritualtheorien ethnologischer Experten eine Schlüsselrolle inne hat (Turner; Geertz). Das Theatermodell vereint also Altes und Neues, es eignet sich als ›renoviertes‹ für die Analyse gegenwärtiger Praktiken und als 'restauriertes' für die Rekonstruktion vergangener kultureller Prozesse im Licht gegenwärtiger Erfahrungen.