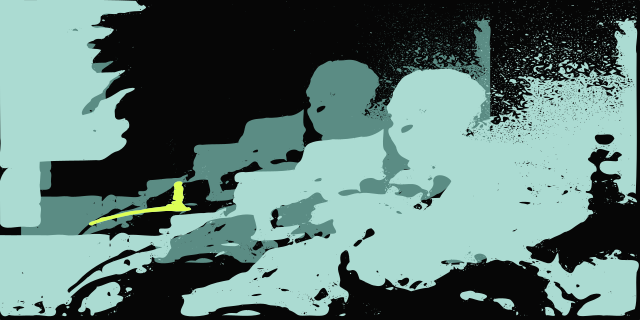Ulrich Schödlbauers Essay über Bevölkerungsentwicklung, Alterungs- und Migrationswirkungen, über kulturelle Ursachen der niedrigen Geburtenraten und ihre politisch-sozialen Konsequenzen erschien erstmals 2006 in Iablis unter dem Titel Bevölkerung. Über das generative Verhalten der Deutschen. Seit der Flüchtlingskrise 2015 sind die Probleme sichtbarer – und drängender – geworden, während die öffentliche Diskussion darüber weithin in Sündenbockrituale entgleist. Es erscheint daher, gerade angesichts des Wahljahrs, sinnvoll, die immer noch aktuellen Thesen erneut in die Debatte einzuspeisen. Der Essay erscheint, leicht gekürzt, in Abständen von wenigen Tagen, in einer Folge von Einzelbeiträgen.
– Die Redaktion –
von Ulrich Schödlbauer
1. Eine andere Welt
Wissenschaftliches über den bevorstehenden Bevölkerungsrückgang in Deutschland erfuhr ich zum ersten Mal im Verlauf einer Tagung von Geisteswissenschaftlern Anfang der achtziger Jahre. Der Vortragende, ein Statistiker, erläuterte anhand der Populationskurven von Hasen diverse Regulationsmechanismen der Natur: steigt die Zahl der Hasen, so steigt entsprechend die Zahl der natürlichen Feinde, die ihr Wachstum begrenzen, et vice versa. Auch in Fällen, in denen die natürlichen Feinde ausfallen, geht das Wachstum keineswegs ins Ungemessene, sondern regelt sich anhand bekannter Faktoren wie Hunger und Sozialverhalten in bestimmten Größenordungen ein. Das war damals, im Hinblick auf globale Überpopulations- und Verwüstungsszenerien, eine spannende, beinahe schon beruhigende Aussage. Zwischen 2020 und 2040, so der Vortragende, werde sich die Bevölkerung der Bundesrepublik (die damals noch nicht die ›alte‹ hieß und knapp über sechzig Millionen Einwohner zählte) bei ca. vierzig Millionen einpegeln – in einer Größenordnung also, bei der sich Fuchs und Hase, falls sie Wert darauf legten, beruhigt Gute Nacht sagen könnten –, in etwa vergleichbar der Zahl der Menschen, die vor Krieg, Flucht, Vertreibung und Einwanderung auf ihrem Territorium lebte. Diese Entwicklung, so der Vortragende, sei nicht mehr aufzuhalten – abnehmende Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter, realistische Annahmen über Kinder und Kindeskinder etc. –, sie sei ein Faktum, mit dem man sich abzufinden habe. Allerdings hätten Ökonomie, Politik und Gesellschaft viel Zeit, sich darauf einzustellen, insofern stünden die Chancen gut, dass es gelingen werde, die kommenden Verwerfungen abzufedern. Andererseits solle man das Problem nicht kleinreden: noch niemals habe ein hochkomplexes System wie die Bundesrepublik unter vergleichbaren experimentellen Bedingungen agiert. Die Diskussion verlief ruhig, man kann auch sagen: sie fiel aus.
2. Der demographische Faktor
Nach den Vorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes von 2003 wird die deutsche Bevölkerung im Jahre 2050 zwischen 67 und 81 Millionen Menschen betragen. Die prognostische Unsicherheit von 14 Millionen Menschen verdankt sich unterschiedlichen Annahmen über die Höhe der Zuwanderung und den Anstieg der Lebenserwartung. Als mittlere Bevölkerungsprognose nennt das Amt 75 Millionen bei einem jährlichen Wanderungssaldo von mindestens 200 000 und einer mittleren Lebenserwartung im Jahre 2050 von 81 bzw. 87 Jahren. Das sind sieben Millionen mehr als im Jahr 1950 (68 Millionen) und sieben Millionen weniger als im Jahr 2003 (›über‹ 82 Millionen). Die Differenz zwischen der Zahl der Neugeborenen und der Sterbefälle (das sogenannte Geburtendefizit) betrug im Jahr 2000 72 000 und steigt bis 2050 auf 576 000 jährlich. Entsprechend erhöht sich das mittlere Alter der Bevölkerung von 40,6 im Jahre 2001 auf 48 im Jahre 2050. 12 Prozent der Bevölkerung werden bei gleichen Annahmen dann achtzig Jahre und älter sein (9,1 Millionen), die Zahl der Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren geht gegenüber knapp 20 Millionen im Jahr 2001 auf etwas über 14 Millionen im Jahr 2050 zurück.
Es versteht sich von selbst, dass das Zahlenmaterial eine Vielzahl von Varianten erlaubt, je nachdem, welche Entwicklungslinien miteinander verbunden werden (hohe Einwanderung mit geringerem Anstieg der Lebenserwartung, niedrigere Einwanderung mit höherem oder niedrigerem Anstieg der Lebenserwartung usw.). Wenig Neigung zeigt das Amt, die Annahmen über die Zahl der Geburten pro Frau, die sogenannte Fertilitätsrate, zu variieren. Sie verharrt konstant bei 1,4, vorausgesetzt, dass sich die (noch) etwas niedrigere Geburtenrate in den neuen Bundesländern und Berlin (Ost) innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums den weiter westlich anzutreffenden Verhältnissen angleichen wird. Das erstaunt ein wenig, da gerade diese Zahl in der Vergangenheit erheblichen Schwankungen unterlag. Es scheint, dass die Hüter des statistischen Erbes den periodisch aufflammenden Debatten über eine wünschenswerte Anhebung der Geburtenzahlen und entsprechende staatliche Maßnahmen mit einem milden Kopfschütteln gegenüberstehen. Dafür bieten sich zwei Erklärungen an: erstens, die Auswirkungen möglicher Schwankungen in diesem Bereich werden als statistisch marginal angesehen, zweitens, die Aussicht auf signifikante Veränderungen gilt als extrem unwahrscheinlich. Für die erste Annahme könnte sprechen, dass der etwa gegenüber 1970 bereits eingetretene Schwund an Frauen zwischen 15 und 49 Jahren die Anknüpfung an frühere Regenerationsraten für die Gesamtbevölkerung in den Bereich des Wunschdenkens verweist. Die zweite Annahme führt in komplexere Überlegungen.
3. Der Gegenstand der Untersuchung
Unter der Oberfläche einer bis zur Jahrhundertmitte keineswegs spektakulär veränderten Bevölkerungszahl tritt damit jener demographische Umschwung zutage, der in der Rentenversicherung sowie bei den medizinischen und sozialen Leistungen bereits Konsequenzen gezeitigt hat und weitere Einschnitte bringen wird. Vertraut man dem kurrenten Datengewirr, so liegt das Beispiel Deutschland mit seiner Entwicklung im Trend der westlichen Industriegesellschaften, Japan eingeschlossen. Mit Italien, Spanien und Japan zusammen fällt es innerhalb dieser Gruppe durch eine besonders geringe Geburtenrate auf, teilweise unterboten durch einige Staaten Osteuropas, in denen der Systemwechsel die Problemlage verschärft. Neben den allgemein bestimmenden Faktoren scheint in dieser Ländergruppe mindestens ein zusätzlicher ins Spiel zu kommen – möglicherweise auch mehrere (und nicht unbedingt überall dieselben). Wer nach Erklärungen sucht, sollte sich also nicht mit der ersten besten zufriedengeben und auch nicht mit ihrer Summe. Wie so oft kommt es darauf an, zu verstehen, auf welche Weise die Einzelbefunde ineinander greifen und welche Wirkungen aus ihrem Zusammenspiel resultieren. Darüber hinaus wäre es wohl naiv anzunehmen, man könne das Problem auf die unmittelbar beteiligten Faktoren eingrenzen, ohne weitergehende Interdependenzen zu bedenken.
Sorgfältig sollte man die notwendige Suche nach Erklärungen von der Suche nach den ›Schuldigen‹ trennen, mit der man in Gesellschaften schnell bei der Hand ist, die sich von nicht oder nur unvollständig verstandenen Entwicklungen mehr oder weniger diffus geängstigt fühlen. Es hat nicht an vergangenen Versuchen gefehlt, dem Zeugungswillen der Bevölkerung aufzuhelfen, ohne dass davon besondere Wirkungen ausgegangen wären. Der naheliegende Schluss, es müsse wohl andere als die gängigen Erklärungen geben, wurde viel zu selten gezogen. Auch die Frage, ob die Entwicklung überhaupt eine Bedrohung (oder mehrere) darstellt, wenn ja, welche und welchen Ausmaßes – und für wen –, fällt bereits in den Gegenstandsbereich notwendiger Analysen, deren Art und Umfang man erst langsam abzuschätzen beginnt. Dies festzustellen hat jedoch wenig mit der Diskussion um ›Chancen‹ und ›Risiken‹ zu tun, die diese wie jede Entwicklung für die Einzelnen bereithalte. Chancen und Risiken entstehen in turbulenten wie in ruhigen Zeiten, sie finden sich in der Katastrophe ebenso wie in Zeiten des kollektiven Glücks. Wer fassungslos auf Karrieren blickt, die unter Hitler und Stalin getätigt wurden, sollte die Möglichkeit künftiger Karrieren und ›Mitnahmegewinne‹ nicht zum Maßstab der Beruhigung oder der Zustimmung machen.
Die Sorge, die Sozialsysteme könnten kollabieren, wenn die Anzahl der zu Versorgenden, insbesondere der älteren Mitmenschen, gegenüber der Zahl der Versorger signifikant zunimmt, grundiert neben dem politischen Themenwandel auch das Verhalten von Menschen, die ihren Ort bisher stets auf der Sonnenseite eines Systems gesehen haben, das für Menschen anderer Weltregionen signifikant andere Lebensläufe bereithält. Manche öffentlichen Bekundungen könnten den Eindruck erwecken, die letzte politische und private Leidenschaft von Jahrgängen, die sich einmal als ›politisch‹ verstanden, bestehe im ungehinderten Altwerden. Dagegen wäre nichts einzuwenden, solange es nicht den Blick auf andere Fragen – und andere Sorgen – verstellt. Wären nur die sozialen Sicherungssysteme von der Entwicklung betroffen, so ließen sich die notwendigen Anpassungsleistungen mehr oder weniger bequem durch Bündel staatlich-administrativer Maßnahmen erreichen und die Bevölkerung könnte sich ohne größere Zukunftsängste weiterhin der Pflege ihrer Lebensstile widmen. Das ist nicht der Fall, wie ein Blick auf die Sorgenkataloge der Länder und Kommunen lehrt. Wenn wesentliche Teile der Infrastruktur unbezahlbar werden oder ihren Zweck nicht mehr erfüllen, verändert sich vieles und vielerlei – eine lehrreiche, wenngleich noch immer beschränkte Optik.
Zukunftsängste sind irrational und können, wenn sie sich mit enttäuschten Erwartungen hinsichtlich Lebensstandard und Lebenssicherheit paaren, zu Verhaltensänderungen führen, die aus einem zunächst leicht lösbar erscheinenden Problem unter der Hand – und in der Regel zu spät bemerkt – ein fast unlösbares entstehen lassen oder eines, das erst durch die Zeit selbst gelöst wird. Die Spannungen, die solchen Eruptionen und Verwerfungen vorausgehen, lassen sich im Lebensgefühl der Leute ebenso lokalisieren wie in ihren Einstellungen und ihrem Sozialverhalten. Weniger leicht fällt es, sie im Katalog der öffentlichen Themen und ihrer Behandlungsarten wiederzufinden, solange sie dort unter falscher Flagge segeln und sich häufiger durch Negationen verraten als durch offene Thematisierung. Auch die Kunst scheint kein sicherer Indikator des Klimawandels in der Gesellschaft zu sein – jedenfalls da nicht, wo das kommerzielle Selbstverständnis ihrer Vertreter für weitere Überblendungen sorgt und eine lächerliche Endzeit-Mythologie immerzu Scheuklappen nachliefert. Die öffentliche Wahrnehmung schleichender, in ihrer Summe dramatischer Veränderungen bevorzugt den ›Bruch‹, das plötzliche Umschwenken, das entschiedene Vorher-Nachher, das die vorhergehenden Denk- und Argumentationsmuster über Nacht entwertet. Darin liegt auch eine Gefahr.
4. Das kulturelle Klima
Wo das Lebensgefühl des Einzelnen wie des Kollektivs schwer greifbar bleibt, da verfügt die Literatur über Möglichkeiten, das scheinbar Unaussprechliche, das darin besteht, dass es noch nichts bedeutet, in Redeformen zu fassen, die unverantwortlich scheinen – und in der Vielzahl von Fällen wohl auch wirklich sind –, aber durch Drastik, Witz, Hohn und Verunglimpfung hindurch Sachverhalte zur Sprache bringen, die zu komplex oder zu einfach oder auch beides sind, um im geregelten Gedankenaustausch behandelt zu werden. Ein Wort wie ›Diskriminierung‹, das eine Vielzahl möglicher Sachverhalte deckt, kann zur Definition eines Straftatbestandes deshalb herangezogen werden, weil es das Interesse des Staates am ruhigen Mit- und Nebeneinander der Bevölkerungsgruppen und -teile unmittelbar zum Ausdruck bringt: Unruhestifter ist, wer dort unterscheidet, wo aus übergeordneten Gründen nicht unterschieden werden soll. Über eine halbwegs gesicherte Heimstatt verfügt die Sprache der Verletzung und Verunglimpfung an den Polen öffentlicher Kommunikation, im abgeschirmten Raum des vom Bevölkerungsgros ignorierten Theaters und im mediengestützten Gebrüll der Arenen – urbanen Institutionen, in denen es auch im Zeichen des Kommerzes gelingt, »politische Räume frei zu halten und zu fördern« (Giorgio Agamben). Legt sich der Mehltau einer undurchdringlichen Korrektheit auf die öffentlichen Debatten, in denen die Zukunft der Menschen und Kollektive weitgehend aufs individuelle Ein- und Auskommen zusammenschnurrt, so ergötzt sich am oberen und am unteren Ende der kulturellen Skala ein ausgewähltes Publikum an unverhofften Durchblicken. In dieser Welt geben kinderlose Zicken, faselnde Greise, pöbelnde Jugendliche, ›Ego Shooter‹-Geschädigte und ausgetrickste oder identitätsstarke Zugewanderte, an deren Aura keine dreifache Einbürgerung etwas ändert, einen befremdlichen Ton vor. Lächerlichste aller Figuren: der Reformer, der verachtete ›Gutmensch‹, der vom Bürger im Menschen schwadroniert und seine Abzockereien mit dem Projekt Moderne rechtfertigt. Zu seinen Visionen will man so wenig zurück wie zum rheinischen Kapitalismus: es wäre ›zu einfach‹.
Ein Klima: nicht mehr, nicht weniger. In ihm erscheint die ›Bevölkerungsfrage‹ wie eine Fata Morgana oder ein Feuerwerk am nächtlichen Himmel, dem sich die kulturell erregbaren Bevölkerungsteile, das Sektglas in der Hand, mit einem ›Ah‹ zuwenden, um es gleich wieder zu vergessen, während die Stillen im Lande ihre Barschaft zählen oder auf Ausreise sinnen. Man ›hat‹ jetzt die Bevölkerungsfrage, das ist bekannt. Es wird schon nicht so schwer sein, das Karussell der Geburten wieder in Gang zu bringen, ohne die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte aufs Spiel zu setzen, widmen wir uns den Errungenschaften! Es gibt aber keine Errungenschaften, die nicht angesichts ihres historischen Telos zu Makulatur würden. Absurd wäre es, wenn der für die Akteure so unerwartete Einsturz des sowjetischen Systems und seine Folgen für das überlebende Weltsystem einem Fatalismus die Türen geöffnet hätten, der Kontinuität für eine Frage ökonomischen Wachstums hält und Identität für eine der Blumen des Bösen. Es gibt nur den langsamen, leidenschaftslosen, Umstände machenden und keine Umwege scheuenden Weg der Analyse. Dass Kontinuität und Identität zusammengehören und in einer fundierten Theorie der Welt, in der wir leben (werden), angemessen artikuliert werden sollten, wäre selbst dann wahr, wenn es sich nur um einen soziologischen Gemeinplatz handelte. Die geläufige Rede vom kulturellen Gedächtnis, eine der wenigen neueren Erfindungen der Geisteswissenschaften, die von der Politik dankbar aufgegriffen wurden, bezieht sich aber auf mehr: die ästhetische, ethische und soziale Adressierbarkeit eines Menschen ist darin ebenso mitgedacht wie sein Herkommen und spezifischer Lebensernst, seine in kollektiven Wahrnehmungs-, Denk- und Glaubensformen präfabrizierte ›Weise zu sein‹. Auf mehr bezieht sich auch die lebendige Sorge um das ›Gemeinwesen‹, die das mündige und politikbereite Individuum jenseits der hedonistischen Ausprägung des Unglaubens an das Bestehende voraussetzt.
– wird fortgesetzt –