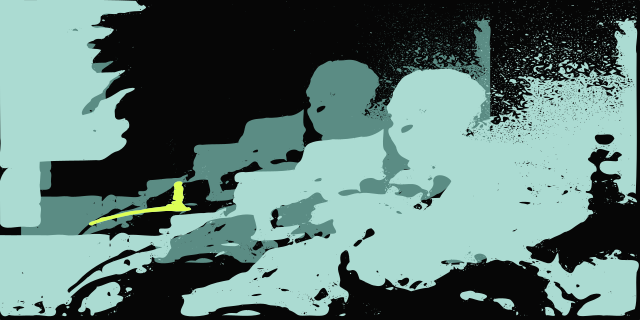von Helmut Roewer
...und andere nützliche Motive, eine Autobiografie zu lesen
Der Dienstagmittag war regenverhangen in Erfurt, und da ich zu früh dran war, trat ich in das mildtätige Geschäft von Oxfam ein, um mich unter den Augen wohl konservierter älterer Damen die nächsten zehn, zwanzig Minuten herumzudrücken und vor dem einsetzenden Dauerregen zu schützen. Ein wunderbarer, ein ordentlicher Laden, die Bücher reichlich und wohl sortiert. Die überwiegende Zahl davon autobiografischen Inhalts und davon die meisten von Schauspielerinnen.
Wie gesagt, ich musste Zeit totschlagen, also hatte ich welche, um die erste These meiner geplanten Biografie der Autobiografien zu formulieren, und die geht so: Autobiografien erfreuen sich deshalb eines besonderen Zuspruchs der Leserinnenschaft, weil sie der Spiegel des eigenen, so nicht gelebten Lebens sind. Nicht meine Lektüre, so dachte ich, wohl wissend, dass ich erst vor zwei Wochen das schlechte Wetter zu Weihnachten nutzte, um parallel drei autobiografische Texte zu lesen. Hier sind sie:
Eins
Der Buchtitel lautet Knife, so wie im amerikanischen Original, ansonsten handelt es sich um eine Übersetzung ins Deutsche. Ich nehme an, dass dem Bertelsmann-Verlag das Wort ›Messer‹ inopportun erschien, hat doch das Messer im Deutschen keinen guten Klang mehr, seit man lauthals über Messerverbotszonen debattiert, anstatt die Illegalen, die das Problem erst schufen, achtkantig aus dem Lande zu werfen.
Das Buch Knife stammt von dem Schriftsteller Salman Rushdie, einem ehemaligen Inder, der via Großbritannien jetzt in den USA lebt. Es beschreibt den vor zwei Jahren auf ihn verübten Anschlag eines Mohammedaners, der sich offenbar berechtigt sah, das vor Jahrzehnten gegen Rushdie durch den finsteren persischen Revolutionsführer Khomeini verhängte Todesurteil zu vollstrecken. Man erinnert sich: Rushdie hatte den in den westlichen Feuilletons breit diskutierten Roman Die satanischen Verse veröffentlicht, der in der islamischen Welt für viel böses Blut sorgte, da, wie ich las, darin über den arabischen Religionsstifter Unerfreuliches zu lesen sein soll. Der Leser bemerkt es sogleich: Ich habe das Skandal-Buch ebenso wenig gelesen, wie all die anderen, die sich darüber ereiferten.
Das Attentat auf Rushdie war überaus brutal. Die Messerstiche brachten ihn dicht an die Schwelle des Todes, die er wie durch ein Wunder nicht überschritt. Besonders schauerlich wirkt noch heute auf mich, dass ihm ein Auge ausgestochen wurde. Im ersten Kapitel des Buches erlebt der Leser den Angriff auf den Autor in einer lesenswerten Reportage aus seiner Sicht, im wahrsten Sinne des Wortes, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihm die Sinne schwanden.
Doch jetzt kommt das ›Ja-aber. Der Leser wird im Weiteren in die Welt Salman Rushdies eingeführt. Es ist eine Welt der moralischen Überlegenheit, der New Yorker Schickeria, wo man bei Ausstellungen, bei Lesungen und bei angesagtem Essen angesagte Leute trifft, die sich über jene erheben, die nicht so weltoffen sind wie sie selbst. Dass ausgerechnet aus diesen Kreisen auch Leute zitiert werden, die im Nachhinein Verständnis für den misslungenen Meuchelmord äußerten, lese ich mit Abscheu. Ich lese mit Unverständnis, dass es Leute gibt, die sich an der Ironie weiden, dass die Untat an einem Orte geschah, an dem die Guten sich eigens versammelt hatten, um die Alternativlosigkeit ihrer Werte zu betonen, und im selben Atemzug lese ich Kritik am Versagen des Sicherheitsdienstes. Eine Welt also, wo das wechselseitige friedliche und weltumspannende Umarmen nur unter bewaffnetem Personenschutz möglich ist.
Und schließlich noch die Liebe. Darüber ist kaum zu diskutieren, wenn ein über Siebzigjähriger sich in eine deutlich jüngere Frau verliebt, die diese Liebe erwidert. Schöne Geschichte, das. Beide Familien sind strikt dagegen. Kommt vor. Beide Familien sind überaus erfolgreich, auch die Familie der Frau, deren Mitglieder tauchen am Rande auf. Einer davon, ein Bruder der jungen Frau, der erste schwarze Bürgermeister von Weiß-ich-wo in den USA. Ach, das ist es? Gerne füge ich hinzu, es ist mir wurscht, wer hier mit wem, aber Unmut kommt auf, wenn wir auf diese Weise erfahren, wie wichtig dem Autor die Gewalttäter-Bewegung mit Namen Black-lives-matter ist. Das ist unverhohlen Lob der politischen Gewalt. Aber nur, wenn’s grade passt.
Und als schließlich die Ausfälle gegen den eigenen Vater (angeblich ein Säufer), der dem Autor das Leben eines Dandys an Englands Elite-Universitäten ermöglichte, zum Thema des Buches gemacht werden, habe ich es zugeklappt. Soviel Korrektheit muss sein.
Zwei
Das Buch von Bernd Wagner Die Sintflut in Sachsen ist laut Untertitel, den der Verlag für richtig hielt, ein Roman. Es ist jedoch, falls nicht alles, was da zu lesen ist, gelogen sein sollte, in Wirklichkeit eine Autobiografie mit einigen leicht nachvollziehbaren Verfremdungen.
Das Buch bringt die Geschichte eines Jungen aus Wurzen (in Sachsen), Ende der 1940er Jahre dort geboren und aufgewachsen. Falls, wovon ich ausgehe, nicht alles gelogen ist, dann ist es ein teils witziger, teils todtrauriger Schelmenroman über einen, der unter denkbar schlechten Bedingungen auf die Lebensbahn entsandt wird. Wir lesen im Wechsel die Reportage über diesen Weg und immer wieder eingestreut Betrachtungen aus dem Hier und Jetzt, die uns zweierlei zeigen: Was ist aus den im Lebensroman des Jungen vorkommenden Akteuren geworden, und dies hier: Was musste er selbst tun, um das zu werden, was er jetzt ist. Diese Reflexionen sind oft notwendig, denn die Welt, in der der Autor aufwuchs, ist keine, die einem Heutigen noch geläufig wäre.
Nun ist es ja in gängigen Autobiografien üblich, dass der Leser mit Kinder- und Schulgeschichten behelligt wird, die man in dem Satz zusammenfassen könnte: Bevor ich ins Leben startete, ging ich bis zum soundsovielten Lebensjahr zur Schule in Sonstwo. Hier ist das anders. Wagners Buch ist auch und streckenweise nur die Geschichte seiner Eltern. Der Vater ist ein selbständiger Schmied am Rande der Stadt, die Mutter eine ehemalige Dienstbotin vom Dorf. Also eine Aufsteigergeschichte? Nicht ganz. Haus und Grundstück sind von Vorgänger-Generationen erarbeitet und ererbt. Man war wer, in einem eigentümlichen Stolz, dem der Selbständigkeit, der sich auf einzelne der Nachkommen übertrug, denn auch die Verwandten des Autors, Onkel, Tanten, Geschwister bevölkern detailliert beschrieben die Szenerie.
Über dem Ganzen wölbt sich die schöne neue, soeben in Schwung kommende Welt des Sozialismus à la DDR, in der Leute wie die Eltern der Klassenfeind waren. Wir erleben den Niedergang des mit viel Fleiß erwirtschafteten bescheidenen Wohlstands, das Wegbrechen der Kundschaft, das Verschwinden der einst auf jedem der Höfe vorhandenen Pferde. Das Aussterben der Höfe, zudem der selbständigen Handwerker und Händler und mit diesen den Verfall einer offenbar einst reichen Kneipen-Kultur. Traditionen verschwinden und mit ihnen eine wohlgeordnete Gesellschaft, an deren Stelle der genormte neue Mensch treten sollte. Einige fügen sich nur widerwillig, andere laufen mit fliegenden Fahnen über.
Und schließlich, ich kann es mir nicht verkneifen, der Autor als Liebhaber. Das sind mehr als nur Andeutungen, wenn es darum geht, das weibliche Geschlecht ins Zentrum des eigenen Lebens zu rücken. Ich habe nicht vor, hier die Details preiszugeben. Die sollte sich der Leser schon selbst erarbeiten. Doch soviel sei verraten: Da ist mir ab und an ein verstehendes Aha oder So-so entschlüpft. Die Zahl der Möglichkeiten ist offenbar begrenzt. Was nicht bedeutet, dass man Anderleuts Leiden der Menschwerdung nicht vergnügt liest. Ganz im Gegenteil. Ich tat’s.
Das Buch endet, lange nach dem Tod des Vaters, schließlich auch mit dem Ableben der Mutter, deren spätes Siechtum den Sohn wieder in die völlig veränderte Vaterstadt zurückführt. Als die kleine Trauergesellschaft nach der Beerdigung beisammen sitzt, bricht der Deich des Flusses Mulde. So geht das Buch in einem Furioso zu Ende. Ich empfehle es allen, die in ein längst vergangen geglaubtes Leben ohne jedes Gejammer eintauchen wollen. Diejenigen, die es gelebt haben, sind noch unter uns. Der Autor ist einer davon.
Drei
Dieses dritte Buch ist ein nobel ediertes Bändchen des holländischen Schriftstellers Cees Nooteboom mit dem Titel Venedig – fluide Stadt. Nun besteht ja weiß Gott kein Mangel an Schriften über die Lagunenstadt, und jeder Venedig-Reisende wird sein Lieblingsbuch über die Stadt und ihre Geschichten zu loben wissen.
Das vorliegende Buch auf einen simplen Nenner gebracht, möchte ich den Bericht eines Flaneurs nennen. Der Autor beschreibt, was er unternahm und sah, als er es sich zur Gewohnheit machte, bei einem längeren Aufenthalt, also in einer Mietwohnung wohnend, Venedig abseits der Touristen-Ströme zu seiner eigenen Sache zu machen. Das klingt wie die Quadratur des Kreises: der Tourist als Nicht-Tourist. Damit hat er bei mir eine Saite zum Klingen gebracht, denn derselbe Wunsch stellte sich bei mir in den Nuller Jahren dieses Jahrhunderts ein, als ich ein festes Quartier bezogen hatte, das es mir freistellte, mich zu Hause zu fühlen, nicht jeden Tag etwas zu unternehmen, dafür aber für den täglichen Bedarf einzukaufen.
Zurück zum besprochenen Buch, es ist ein autobiografischer Text, über dessen Existenz ich mich am Eingang dieses Aufsatzes lustig machte: Ich habe ihn gelesen, um mich in ihm zu spiegeln. Er ist so, als wäre er eigens für mich geschrieben worden. Dem Buch sind einige schwarz-weiß Aufnahmen der Photografin Simone Sassen beigegeben. Ich nehme mir vor, beim nächsten Mal auf den Wegen Nootebooms und seiner Gefährtin zu wandeln – beim hoffentlich nächsten Mal.