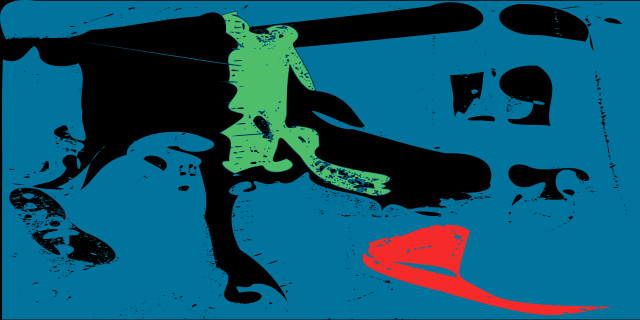von Ulrich Schödlbauer
Oberreiter
Lieber Herr Oberreiter,
beim Wiederlesen der Schriften Ciorans, nachdenkend über das Wunder, dass es sie gibt, dass es sie in dieser Vollständigkeit gibt, dass sie entstanden sind und man sie gegen ein kleines Entgelt kaufen und lesen kann, stellt sich, unvermutet, diese Empfindung ein: was wäre, wenn dieser Autor heute schriebe, wenn er hierzulande schriebe, von alledem lesbar? Was davon käme jemals an den Tag? (Damit meine ich nicht jene frühe Verstrickung, gegen die, nach Adornos einschlägigem Wort, ein Lebenswerk einsteht.) Schon die lausige Übersetzung weckt Argwohn, doch sie entstammt einer anderen Zeit, einer anderen Gestimmtheit, man sollte sie ruhen lassen. Stattdessen sollte man das literarische Verfahren ins Auge fassen, die Art, wie der Autor sich freistellt, die Art von Thesen, mit denen er sich herumschlägt, überhaupt die Weisen, auf die er sich herumschlägt, das leicht Nachzumachende und das Unnachahmliche daran, die Unart, wörtlich und sogar persönlich zu nehmen, was für die Azubis des akademischen Systems nur kulturelles Gewäsch darstellt: Worte, Worte, nichts als Worte, nicht wahr? Eine kleine Schreib-Enthemmung, nicht wahr, ein Sich-Gehenlassen in Worten, vermutlich der transkulturellen Situation geschuldet, man müsste über Sozialisationen nachdenken, falls man dazu aufgefordert würde, ansonsten... besser schweigen. Einmal nachdenklich geworden, könnte man andere Namen aufführen, ganz andere, ich bleibe bei diesem, in dessen Wohnung ich einmal ein- und ausging, und bin mir ganz sicher, dass ihn diese Mauer aus Schweigen umstünde, aus Verlegenheit, wenn man so will, einer Verlegenheit, die rasch weg will, die bereits auf die Uhr schielt, die ihre Termine hat. Die kanonischen Texte unserer Kultur wären, würden sie heute geschrieben, nicht vorhanden. Die sie zu Gesicht bekämen, würden ungerührt darüber hinwegsehen, und die anderen würden ohnehin nichts mitbekommen. Das ist die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, und jeder, den es angeht, ist darüber verständigt.
Es gibt für diese Situation ein Bild, Sie kennen es, es ist das Floß der Medusa und stammt von Géricault, der es 1819 beim Pariser Salon einreichte, ein Bild der Trostlosigkeit und der Hoffnung am Horizont für ein paar Überlebende, während der Betrachter, der immer klüger ist, hinter ihren Rücken die zerstörerische Woge herannahen sieht. Die Fregatte Medusa, 1816 auf Grund gelaufen, war unterwegs nach dem Senegal, ein Sandkorn innerhalb jenes Sturms, der damals Kolonisation und heute Globalisierung heißt, der damals von Europa ausging und heute Europa ins Gesicht bläst – ein zerklüftetes und gleichzeitig weitgehend glatt geschmirgeltes Gesicht, das an nichts und niemanden erinnert außer, in seinen besten Momenten, an etwas, das nicht existiert. Was Géricault diskret verschweigt, ist der Kannibalismus an Bord des Floßes, das die für eine Rettung nicht vorgesehenen Schiffbrüchigen aufnehmen musste. Das alles hat, als Bild der Zivilisation und der unvermeidlichen condition humaine, unsere Dichter und Musiker tief bewegt und beschäftigt, vor allem letzteres, man kann den Kapitalismus, den Neoliberalismus, das Schicksal heutiger Kontinente und morgiger Welten hineinpacken und Europa sollte sich dabei nicht beklagen, nicht wirklich beklagen. Nicht dass es auf der sicheren Seite säße, aber es hat gelernt, sich seinen Teil der Vorräte zu sichern und wüsste sich seiner Haut zu wehren – vielleicht, vielleicht auch nicht. Seltsam, dass einen das Schicksal der Welt so kalt lässt, sobald man das Bild betrachtet. Es ist ein Anspruch hineingeschrieben, den die Bewohner des Floßes vielleicht am Anfang noch besaßen, den sie aber Stück für Stück aufzugeben genötigt waren.
Dieser Anspruch, es möge der Dampfer am Horizont auftauchen, der die Lage bereinigt und für sichere Verhältnisse sorgt, unter denen das Leben weiter seinen Gang gehen kann, heißt für den Einzelnen, es gebe ein, vielleicht nur bescheidenes, Überleben in der Kultur, wenn schon in keinem Jenseits, in das die Person sich unter Zurücklassung jeglicher Ration einschiffen könnte. Der Kannibalismus tötet diesen Anspruch, er ist das finstere Geheimnis, das die Hoffnung mit einem Schlag zum Einsturz bringt, weil es keine offene Zukunft mehr gibt. Diese pervers gewordenen Gebildeten, die um ihres Fortkommens willen den Überlebenskontrakt zerreißen, sind nicht ohne Hoffnung, aber sie hat sich wundersam verwandelt, sie hat sich wundersam vermehrt, die Fleischvorräte sind ins schier Unermessliche gestiegen, die Hoffnung, auf Kosten seiner Mitmenschen weiterzukommen, ist alles in allem nicht schlecht, vorausgesetzt, man hütet sich und legt das Messer nicht weg. Der Dampfer am Horizont? Ein Phantasma, aber ein bedrohliches, denn in ihm rechnet die Vergangenheit mit der Gegenwart ab. Wer begriffen hat, für den läuft das Leben wie geschmiert, wir werden die überkippenden Wellen schon meistern. Die ganze öffentliche Rhetorik hat sich dieser Sicht verschrieben, die private läuft ihr, wie immer, teils voraus, teils hinterher, das kann niemanden wundern. Ein Talent? Her damit, fördern wir es zugrunde, wer wird da pingelig sein. Es soll ja diese Leute geben, die sich selbst zur Strecke bringen, die innerlich schon ganz wund sind vom Nachdenken, das wäre dann leichte Beute. Auf geht's. Das Los ziehen, aufteilen, bei den Messern sitzen, davon will keiner, der es versteht, je wieder lassen. Es gibt kein Danach.
Der kleine Schritt von der Begabung zum Talent, lieber Herr Oberreiter, hat die Literatur – wir reden hier nur von ihr, von nichts anderem, bewahre – Kopf und Kragen gekostet, und solange lauter Talentierte in der Gegend herumlaufen und Verträge abschließen, vor denen Großmutter stets gewarnt hat, wird man dort, wo sie hingehören, nichts finden. Wer einmal ein paar von ihnen aus der Nähe beobachten durfte, der weiß, warum das Talentsein das Begabtsein so unendlich aussticht. Es findet sich zurecht, es findet sich immer zurecht, es findet auch nichts Besonderes daran und wundert sich nur, dass diese sehr schwierigen Dinge, von denen es reden hört, sich in der Praxis so leicht anlassen. Das muss wohl daran liegen, dass es selbst etwas sehr sehr Kostbares ist. Es tut also recht daran, sich auf Kosten anderer zu mästen. Wer gelten lässt, sagt Cioran, gibt einen tiefsitzenden Defekt zu erkennen, es wirkt beunruhigend, ihn in seiner Nähe zu wissen, besser wäre es, ihn rechtzeitig zu schlachten, bevor er von selbst verfault. Wer den Mitmenschen gelten lässt, der lässt am Ende auch die falsche Frage gelten, die Frage, vor der innerlich alle ein wenig erbleichen. Bleiben Sie ruhig, ich meine nicht die ewige Frage des Gekreuzigten, die sie als Freibrief wohlverwahrt im Gepäck mit sich führen, ich meine auch nicht das kindliche Warum, das sich im Englischen so vortrefflich aufs Flennen reimt, dass diese Tatsache allein die Dominanz dieser Sprache worldwide rechfertigte. Gestellt hat sie einmal ein Kommilitone von mir, zu einer Zeit, die so weit zurückliegt, dass eine eventuell darin zum Vorschein gekommene Beleidigung mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Lebenden mehr träfe: »Wenn all diese Idioten« – er unterstrich das Wort durch eine unbestimmt wedelnde Gebärde – »mit einem Schlag nicht mehr wären, was würde dann aus dem Feuilleton?« Wir Heutigen kennen die Antwort: Es wäre ihm gleich, nein, es ist ihm gleich, aber es schert sich nicht drum. Schließlich hat es den Film. Und auch der ist – was geht, geht – egal.
Man kann sich natürlich fragen, ob Exportnationen, die ihren ökonomischen Status und ihren mentalen Zusammenhalt in Ziffern des internationalen Warenaustauschs auszudrücken gelernt haben, für die Produktion kultureller Güter überhaupt günstige Standortbedingungen bieten. Die man da warten lässt, werden es vielleicht gar nicht merken außer denjenigen, die vielleicht schon ein wenig länger warten. Mit dem Warten ist es auch nicht getan. Solche Prozesse, Sie wissen es, lassen sich nur sehr schwer umkehren und kurzfristig ist da in der Regel nichts zu machen. Kultur hat viel mit Selbstschätzung zu tun, mit der Bereitschaft, Regungen ernst zu nehmen, die sich im internationalen Verkehr leicht verlaufen oder groteske Formen annehmen, das heißt, erst in zweiter oder dritter Linie an Maßstäben des internationalen Erfolgs, überhaupt des Erfolgs, gemessen werden möchten. Erfolg ist in kulturellen Dingen eine vergröbernde Kategorie, vom Erfolgszwang, unter den sich jemand stellt, nicht zu reden. In diesen Dingen ist Erfolg etwas, das hinzutritt, das nicht erzwungen werden kann und nicht erzwungen, ja nicht einmal gewollt werden darf und oft genug den Bedingungen Hohn spricht, unter denen etwas entsteht. Dennoch lieben die Menschen den Erfolg, sie lieben ihn so, dass sie sich von einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens an unerbittlich in sich selbst verheddern, falls er ausbleibt, und entweder das Leben selbst oder das, um dessen willen sie angetreten sind, irreparablen Schaden nimmt. Von diesen Schäden müsste man reden, wollte man von den Generationen reden, die heute, ginge es nach der Politik und dem Feuilleton, die ›Weltgeltung der Kultur dieses Landes sichern‹ sollen, um den Auftragsbüchern ihrer Geld- und Prestigegeber gerecht zu werden. Man müsste, wenn man wollte... Will man es wirklich?
Ihr