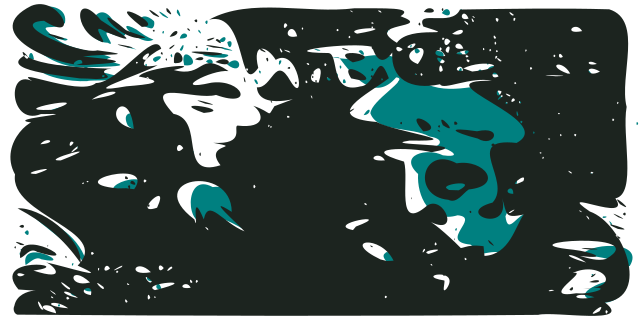von Don Albino
Dem Frieden dienen, den Frieden erhalten.
Frage ich mich, welcher Hund mich im Laufe meines Lebens am meisten beeindruckt, ja geprägt hat, dann fällt mir automatisch Goethe ein, ein Zwergpinscher, den ich für die längste Zeit unserer Bekanntschaft nicht zu Gesicht bekam, was der Intensität unserer Beziehung aber keinen Abbruch tat, denn seine durchdringende Stimme tat es auch. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, mich durchfährt jedes Mal eine merkwürdige Empfindung, wenn jemand das Wort Stimme auf das Gekläff eines Hundes anwendet, eine Instanz, die ich nicht weiter kenne, möchte es für menschliche Laute reserviert wissen, was natürlich der reinste Humbug ist. Selbstverständlich haben Hunde, wie andere Tiere, Stimmen, recht kräftige dazu, wie unschwer feststellen kann, wer mit einem Hund unter einem Dach lebt, aber nicht die Wohnung teilt. Hundebesitzer haben kein Ohr für den Krach, den ihr treuer Gefährte veranstaltet, geschweige denn für die seelischen Verwüstungen, die er bei ihren häuslichen Mitbewohnern anrichtet. Das liegt, wie alle, die es angeht, wissen, am fehlenden seelischen Band. Nicht zuletzt deshalb sind Hundebesitzer der Auffassung, man müsse ihren Liebling (oder ihre Lieblinge) einfach mögen, andernfalls sei man ein herzloses Subjekt, bei dem Mitgefühl fehl am Platz sei.
Ich weiß nicht, welche Auffassungen von der seelischen Leistungsfähigkeit seiner Umwelt Goethe im Laufe seines kurzen Kläfferlebens zu entwickeln Gelegenheit fand. Vielleicht hat er sich selbst jede Entwicklungsmöglichkeit genommen, als er beschloss, die geringste Abwesenheit seines Frauchens – einer älteren, bei allen Hausbewohnern wohlgelittenen Dame – auf Übungen im Dauerkläffen zu verwenden, wobei es ihm weniger auf stimmliche Modulation als auf Lautstärke und Durchhaltevermögen ankam, bis er schließlich die Drei-Stunden-Schallmauer durchbrach, um neuen Rekorden entgegenzu-… naja, was wohl? Mag sein, er hatte in einem früheren Stadium seines Lebens die Chance ergriffen, sich Sloterdijks Kulturbegriff einzuverleiben, und den leistungssteigernden Wert permanenten Trainings erkannt. Mehr Plausibilität besitzt die Hypothese, dass er durch zu frühen Entzug der Muttermilch zum lebenslangen Nervtöter wurde. Wahrscheinlich war die Mutter Künstlerin (ich stelle sie mir mit einem roten Schleifchen im Haar vor und bewundere aus historischer Distanz ihre überragende Intelligenz) und nicht gewillt, dem kleinen Goethe, nachdem sie scharfsinnig seine Spießernatur erkannt hatte, mehr als eine Noterziehung angedeihen zu lassen. Man kennt die Grausamkeit großer Künstler gegen ihren Nachwuchs und weiß um die tragischen Folgen. Ich bin fast sicher, dass auch Goethe sich für einen großen Artisten hielt, jedenfalls der Stimme; wahrscheinlich glaubte er auf diesem Feld locker mit Mutter konkurrieren zu können. Ich denke aber, sein eigentlicher Triumph lag in der rücksichtslosen Verschwendung seines Talents, dem er sich nur zu entfalten gestattete, solange er eingeschlossen zwischen die Wände einer leeren Etagenwohnung auf Frauchens Wiederkehr wartete.
Übrigens glaube ich nicht, dass sie auch nur den geringsten Verdacht bei sich zuließ, ihr kleiner Kamerad, der ihr die Lektüre so vieler Bücher ersparte, könnte in ihrer Abwesenheit das gesamte Haus tyrannisieren. Bei allem Höllenlärm, den Goethe veranstaltete, behielt er offenbar ein feines Sensorium für die Laute seiner Umgebung und verstummte sofort, sobald der leise Fuß der alten Dame im Hausflur hörbar wurde. Wahrscheinlich erkannte er sie bereits an der Art, wie sie den Hausschlüssel ins Schloss steckte und umdrehte, aber das muss Spekulation bleiben. Er wollte allein sein in seinem Krach. Dass außerhalb der vier Wände, in denen er sich aufhielt, die Welt die Fäuste ballte oder in nervöses Gelächter ausbrach, kümmerte ihn nicht, solange nur Frauchen nichts von seinem sich täglich steigernden Talent erfuhr. Man kann das für Bescheidenheit halten oder für Größenwahn, Tatsache ist, dass er mit dem Publikum jede Art von Zuspruch aussperrte, Lob oder Tadel, wofür es nur eine Erklärung gibt: Beides galt ihm gleich viel. Der wahre Künstler, das weiß man einfach, genügt sich selbst, vor allem dann, wenn seine Kunst darin besteht, alle Welt von seiner Sendung zu überzeugen. Was ist die Welt dort draußen gegen die Welt im Kopf? Ein Dreck, ein Nichts, eine Quantité négligeable, überdies ein Beweis dafür, dass es leichter ist, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen als ihn aus der Tür zu stecken, um sich in einer guten Stunde anzuhören, was die Nachbarn zu sagen haben. Goethe, davon bin ich überzeugt, wusste in all den Stunden, in denen er mit seinem Gekeife das Haus erfüllte und die Mitbewohner (mich eingeschlossen) zur Weißglut trieb, ganz genau, was er von uns und unseren Maßnahmen, die teils ihm, teils dem Terror, der just zu dieser Zeit über uns alle hereinbrach, zu halten hatte – nichts nämlich, gar nichts, um genau zu sein, weniger als nichts, um ganz genau zu sein, und wem das nicht genügt, der kann sich mit der Vorstellung vergnügen, dass Goethes Mission der ganzen Welt galt und wir nur deshalb die ersten Leidtragenden waren, weil wir, nun ja, weil wir einfach zu nah dran waren.
An jemandem dran zu sein, der eine Mission hat, ist schon unter Menschen eine schwierige, manche behaupten aus Erfahrung: eine missliche Angelegenheit. Zwischen Mensch und Hund wird daraus ein Drama, das jede Beziehung sprengt. Das liegt daran, dass es an eigentlicher Verständigung fehlt. Nicht dass es Menschen an Vorstellungen vom Innenleben ihrer geliebten Zweibeiner fehlte, ganz im Gegenteil, sie wissen blendend darüber Bescheid – allein die Tatsache, dass sie davon überzeugt sind, dieses Innenleben drehe sich weitestgehend um sie, lässt Misstrauen sprießen. Zu Recht! Was der Mensch über die Psyche des Hundes denkt, ist eitle Selbstbespiegelung, je überzeugter, desto lächerlicher. Warum sollte es auf der Hundeseite anders zugehen? Was wir das Denken des Hundes nennen, ist nichts – oder fast nichts – weiter als seine Abhängigkeit von Frauchen, sie – die Abhängigkeit – denkt sozusagen an Hundes statt und schreibt ihm sein Verhalten vor. Man stelle sich ein Land vor, reich an Altertümern und tief geprägt von seinen kulturellen Ambivalenzen, das aber durch den unerbittlichen Gang der Geschichte zu einer Art Satrapie herabgesunken ist, in der die Vertreter der größeren Macht ein- und ausgehen, als handle es sich um ihr Eigentum, was zu großen Teilen auch der Fall ist: Es würde sich vorzugsweise mit den üblichen Vorstellungen identifizieren, die seine Herren über es hegen, erstens um zu gefallen und zweitens, um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, die überall da auftreten, wo ein eigener Kopf ins Spiel kommt. Es würde sich zweitens darüber hinaus mit der Identifikation identifizieren, das heißt, es würde die ihm auferlegte Rolle als Rolle akzeptieren – andere sagen, es würde vor aller Welt den Affen geben –, und drittens würde es in seinem Untergrund rummeln und rauschen, das alles sei es nicht, jedenfalls nicht wirklich, nicht in den Tiefen der Seele, was immer das wieder sein mag. Doch lieber würde es zur Selbstausschließung schreiten als den Sprung in die Selbständigkeit zu wagen, und sei es nur deshalb, weil es verlernt hat, ständig selbst zu sein und stattdessen darauf schielt, was die anderen von ihm halten – diejenigen, nach deren Pfeife es tanzt, und die anderen, die es glaubt nach seiner Pfeife tanzen lassen zu können.
Ganz so – oder so ähnlich – muss es dem Hündchen ergehen, das selig an Frauchens Mutterbusen ruht, scheinselig, denn sein Herzchen ist eine Mördergrube, süchtig nach Identität und identitätsflüchtig, nur darauf wartend, dass Frauchen es mit einem Klaps entlässt und die Wohnungstür hinter sich zuzieht: Endlich allein! Jedenfalls habe ich Goethe so zu verstehen gelernt, es war ein langer und mühseliger Prozess, in dem ich mehrfach, wie es so heißt, gegen die Decke ging, ohne mir mehr als einen Brummschädel dabei zuzuziehen. Dieses pfeifende, japsende Pinschergekläff, es ist seine Mission und es enthält sie, beides in einem, unauflöslich, man kann sterben, ohne den Hund verstanden zu haben, man kann aber auch … es gibt dort draußen etwas, das in etwa dem menschlichen Verstehen der Hundeseele entspricht, jedenfalls gab es das einmal: Es war das jedem Bahnreisenden vertraute rhythmische Stoßen der Räder zu einer Zeit, zu der die Bahngleise aus einzeln verlegten, noch nicht miteinander verschweißten Schienen bestanden, zwischen denen ein winziger Abstand klaffte … ich sage ›rhythmisch‹, dabei war es die Monotonie selbst, doch wie sich herausstellte, war die menschliche Psyche unfähig, diese Monotonie über längere Zeit zu ertragen, und begann zutiefst unbewusst nach wenigen Minuten ihr spontan einen Rhythmus zu unterlegen, bei dem es aber nicht blieb, der zum Ausgangspunkt wurde unzähliger, individuell abgestimmter Rhythmen, so dass der Reisende am Ende erschöpft und erfrischt den Zug verließ: erschöpft von Bewegungsmangel und Monotonie, erfrischt durch die rhythmische Abwechslung, die sein Körper – oder sein Gemüt, wir wollen hier nicht pingelig sein – während all der Zeit ganz von allein hervorgebracht hatte.
Es ist nicht überliefert, ob die Betonschwellen der alten, von der DDR ins wiedererstandene Deutschland herübergeretteten Reichsautobahnen jemals eine ähnliche Wirkung auf das Seelenleben der Deutschen entfaltet haben. Ich jedenfalls habe im Lauf der Zeit gelernt, die entsetzliche Pinscher-Monotonie mit spontanen Rhythmen auszufüllen und ihr damit einen menschlichen Sinn zu unterlegen, ohne dabei jemals des Hündchens, das meine Umgebung Goethe nannte, ansichtig zu werden. Bald wusste ich alles über ihn, seine Melancholie, seinen hündischen Stolz, seinen Wunsch, der Welt seine Einfälle aufzunötigen und sollte er selbst daran zugrunde gehen, seine verletzte Eitelkeit, seine unzugängliche, als Weltoffenheit getarnte Einsamkeit, seine eigensinnige Feigheit vor dem Eigen-Sinn, seine Angst, Frauchen werde eines Tages nicht mehr zurückkehren und ihn von seinem Dauertraining erlösen, den eigentümlichen Hunde-Wahnsinn, der ihm eingab, unverletzlich zu sein und die Welt bloß durch sein Gekläff am Laufen zu halten, schließlich den Terror gegen sich selbst und die perverse Hoffnung, eines Tages werde die gepeinigte Nachbarschaft mit vereinten Kräften die Tür aufbrechen und ihn erschlagen oder ins Hundeheim deportieren … das alles las ich aus der immer gleichen Abfolge von Lauten heraus, die mich ansonsten in den Wahnsinn getrieben hätte.
Eines Tages jedoch – wer spricht von Tagen, es geschah gänzlich unerwartet in einem Moment, herausgehoben aus dem Fluss der Zeit und auf der Stelle in ihm versinkend –, eines Tages antwortete dem hellen, dem menschlichen Keifen so verwandt klingenden Geräusch des Zwergpinschers ein tiefer, mächtiger, dabei klagender Ton, dessen Ursprung unlokalisierbar in einer anderen Wohnung lag. Die Wände unseres Hauses, ich vergaß das zu erwähnen, sind dünn, sehr dünn, ich spreche hier nicht von entfernten Vorgängen, sondern von Geschehnissen, die gut und gerne in meiner Wohnung hätten spielen können, wenn man davon absieht, dass sie meinen Blicken und meinem Sinn für Entfernungen entzogen waren. Der Neue – ich erfuhr es binnen kurzem durch den üblichen Haustratsch – war eine dänische Dogge, breit in den Schultern, nicht besonders groß für seine Art, aber verglichen mit Goethe ein Riese, das Fell hellgrau, mit einem Zug ins Braune, vor allem im Rücken- und Schulterbereich schwarz gefleckt, aber das wusste ich damals nur vom Hörensagen, denn der Hund zog alsbald Bewunderung auf sich, die allerdings einen beträchtlichen Dämpfer erhielt, als sich herumsprach, dass seine Besitzerin, eine junge, schlanke Blondine, die hauptsächlich in schwarzen Leggins herumlief, ihn mit einem Glas Gin Tonic auf den Namen Putin getauft hatte.
Ich erspare mir an dieser Stelle, das üppige Klangbild zu beschreiben, mit dem Putin in mein Leben und das Goethes trat, das sonore Knurren, das wie eine gerade einmal einen Spaltbreit geöffnete Tür zur Seite gestoßen wurde durch das wuchtige Anschlagen des zur Jagd bereiten Herrn der Fluren – ich bemerke nur, dass Goethe in diesem Moment abrupt verstummte, um nach ein paar Sekunden und vergeblichen Japsern etliche Oktaven höher wieder einzusetzen, frenetischer denn je, mit der Tendenz sich loszureißen, man wusste nicht, von was und von wem. Wäre es nur bei dem einen Moment geblieben! In den Wochen und Monaten, die auf diesen Schicksalstag folgten, war es um die Tag- und Nachtruhe der Hausbewohner geschehen. Goethe beruhigte sich auch dann nicht mehr, wenn sein geliebtes Frauchen ins traute Heim zurückkehrte, sondern führte sein Zwiegespräch mit dem Unbekannten – ein unbeschnüffelter Hund ist und bleibt ein Unbekannter – über alle Zeitschranken hinweg fort. Oft blieb Putin die Antwort schuldig, in mir wuchs der Eindruck, er war nicht besonders scharf auf die Beziehung, die ihm da durch die Wohnsituation eingebrockt wurde. Er wirkte abgelenkt und unwirsch, ganz anders als Goethe, der im Lauf der Zeit immer mehr außer Rand und Band geriet. Später erfuhr ich, dass Goethes Frauchen währenddessen gegen die Neue intrigierte und das Haus gegen sie aufzubringen versuchte, vermutlich um Goethes Monopolstellung – und ihr Monopol auf Goethe – gegen den Rest der Welt abzusichern, aber in diesem Fall sprachen die Eigentumsverhältnisse eine klare Sprache und alles blieb so, wie es nun einmal eingetreten war.
Es war ein warmer Frühlingstag, an dem ich zum ersten Mal die beiden Frauen, die mollige Ältere und die überschlanke Junge, mit Hundeleinen bewaffnet zusammen unter den Bäumen auf dem Rasenstreifen, der unser Haus vom Kanal trennt, lustwandeln sah. Sie wirkten, als habe der Zufall sie zusammengeführt. Die schwarz glänzende Leggins nahm sich seltsam intim neben dem bauschigen Rock der Älteren aus. Gleichzeitig strahlte die Gruppe, gestisch und choreographisch, so etwas wie Harmonie aus, ganz, als wollten die beiden ihren Zwist ein für alle Mal vergessen oder auch nur für ein paar Stunden ruhen lassen. Währenddessen preschten Putin und Goethe über den Rasen, brachen durch Büsche und erschreckten ein paar Zufallspassanten, die lauthals ihrer Empörung Ausdruck verliehen. Ein paarmal packte Putin das Kerlchen am Genick und es sah aus, als wolle er ihn bedrohlich schütteln. Doch im nächsten Augenblick sprang ihm Goethe fast übergangslos an die Gurgel und Putin stürmte über ihn weg. Die beiden Frauen, die das tolle Spiel aufmerksam verfolgt hatten, wandten den Blick zum Wasser, auf dem das erste Ausflugsboot des Jahres mit flatterndem Wimpel vorbeirauschte. Es muss in in diesem Augenblick gewesen sein, dass Goethe, Kampfmut im Herzen und spiegelblind für die Gefahren des nüchternen Lebens, auf die Straße hinausschoss und die Bahn eines der in dieser Wohngegend üblichen Pkw kreuzte. Bezeugen kann ich den Vorgang nicht, mein Blick ruhte auf den ins Gespräch oder auch nur in den Anblick des sich feiernden Lebens vertieften Halterinnen, die hochfuhren, als das kurze Quieken ertönte.