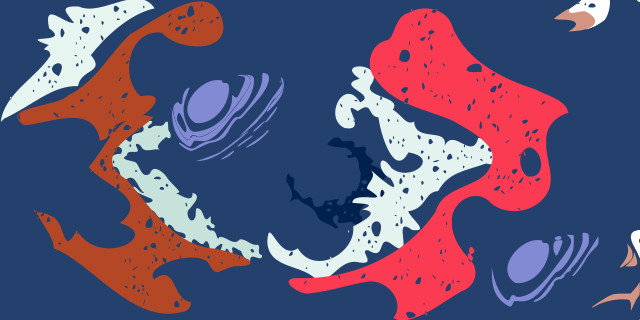von Immo Sennewald
Gregor Gysi, Präsident der Europäischen Linken
Ja, die ›gesellschaftlichen Zwänge‹, möchte einer ausrufen und dem Genossen Gysi in diesem Falle verständnisvoll zunicken. Wer sich Tag für Tag als Kader im Anzug mit Schlips bewegen, die Rituale des Apparates befolgen, Konferenzstühle drücken oder gar in Uniform und militärisch strammer Haltung Wutausbrüche seines Vorgesetzten ertragen muss, kann sich innerlich aufrichten, sobald er sich den Hauptabteilungsleiter, Oberst, gar Genossen Minister nackt vorstellt.
Einem von ihnen unbekleidet gegenüberzustehen war in der DDR durchaus möglich, denn nirgendwo sonst auf der Welt war ›Freikörperkultur‹ – FKK – landesweit so verbreitet, massenhaft beliebt und selbst außerhalb von Saunen, Kleingärten, Stränden anzutreffen, wie im »sozialistischen Staat deutscher Nation«. So beschrieb Artikel 1 der Verfassung 1968 – noch zu Zeiten von Walter Ulbricht – das Herrschaftsgebiet der SED.
Nach seinem Sturz durch Honecker verschwand die deutsche Nation endgültig aus dem Sprachgebrauch: 1974 aus der Verfassung, danach so weitgehend, dass der Volksmund spekulierte, ab wann auch der deutsche Schäferhund zum ›Schäferhund der DDR‹ erhoben würde. Artikel 1 enthielt stattdessen den »Staat der Arbeiter und Bauern«, aber natürlich blieb »die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei« so unangetastet wie Berlin als Hauptstadt und die gesellschaftlichen Zwänge. Sie hießen nicht so, aber etliche Kilometer Stasiakten bezeugen sie. Ich auch.
Aus ihnen auszubrechen verhinderte ein weltweit bekanntes Bauwerk in Berlin, dazu mit Minen, Stacheldraht, Wachttürmen, Hunden (meist Schäferhunden) und Patrouillen gesicherte 1400 km lange Grenzanlagen und eine wohlorganisierte Gesinnungskontrolle in fast allen Lebensbereichen, einschließlich Urlaub im gewerkschaftseigenen Ferienheim, auf dem Zeltplatz oder im sozialistischen Ausland. Betriebe und andere Einrichtungen schmückten sich mit einem Schild ›Bereich der vorbildlichen Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit und Disziplin‹. Ich erinnere mich, so ein Schild an einem Kinderferienlager gesehen zu haben, aber ich bin nicht sicher, vielleicht war es auch eine Herberge.
›Sicherheit‹ galt alles in der DDR. Seltsamerweise gehören zu den Stützpfeilern einer jeglichen Konstruktion des Musters ›Es war nicht alles schlecht!‹ neben Medaillenrängen im Sport, sicheren Arbeits- und Kitaplätzen, kostenlosen Brillen und Zahnersatz auch die Nacktbadestrände. Nicht nur Arbeiter und Bauern, alle Schichten der Werktätigen in Stadt und Land gaben sich genussvoll Sonne, Wind und Wasser hin: splitterfasernackt, befreit von Bekleidungsvorschriften, Rangordnung, ökonomischen und informellen Insignien der Macht. Zugleich fielen ›Spanner‹ – vor allem die mit Badehose – nicht selten lautstarker Verachtung anheim. Sie sollten sich schämen, Hose runter, Ordnung muss sein!
Neben den ordentlich ausgeschilderten Oasen zwischen Ostseedünen, gab es auch die wilden an Kiesseen, wo das Baden verboten war, in entlegenen Ecken von Freibädern, Parks und Sportplätzen. Viele von ihnen wurden in den 80er Jahren – auf dem Höhepunkt der Bewegung – legalisiert. Dieser Höhepunkt korrelierte zeitlich mit dem Höhepunkt der Ausreisebewegung: Hunderttausende DDR-Bürger wollten heraus aus Mangelwirtschaft und Bevormundung. Der KSZE-Prozess und internationale Verträge hatten zwar der DDR die staatliche Anerkennung gebracht, ihr aber auch politische Kompromisse abgezwungen, obendrein die ökonomische Krise, vor allem Devisenknappheit und hohe Schulden verschärft.
Mitte der 70er Jahre waren mutige Ausreiseantragsteller von der Stasi noch mit schweren Schikanen drangsaliert worden, Entlassung, Verhaftung, Misshandlungen inklusive. Wer es wagte, sich als solcher etwa mit einem weißen Bändchen an der Autoantenne zu bekennen oder zu solidarisieren, kassierte ebenso schwere Strafen. Trotzdem ermutigte jede erfolgreiche Übersiedlung in den Westen immer mehr neue Gesuche.
Ab 1985 nahm kaum noch jemand ein Blatt vor den Mund, wenn er über Bittgänge zu ›Inneres‹ – also zur bei kommunalen Behörden für seinen Antrag zuständigen Abteilung – redete. Dort saßen ihm Stasis gegenüber, ebenso am Stammtisch, womöglich mittags in der Kantine. Wenn er sehr unbesorgt lebte, landete schon mal eine Freundin bei ihm im Bett, deren Unterschrift unter die Verpflichtungserklärung als IM noch nicht ganz trocken war. Aber damit musste einer immer rechnen; war er am Ende mit allen Träumen, mochte er auch in der zartesten Umarmung nicht säumen.
Besonders bizarr fand ich einen ›Hotspot‹, Treffpunkt Ausreisewilliger auf einer Rasenfläche an der Dimitroffstraße (heute Danziger Straße), direkt an der Rückseite des berühmten ›SEZ‹, eines der absoluten Glanzstücke von Erich Honeckers ›Sondervorhaben der Hauptstadt Berlin‹. Das ›Sport und Erholungszentrum‹ war von einem schwedischen Architektenteam entworfen, mit enormem Aufwand an der Kreuzung mit der Leninallee (heute Landsberger Allee) gebaut, 1981 eröffnet worden und seinerzeit das weltweit größte seiner Art. Es lohnt sich, einen Bericht des DDR-Fernsehens anzusehen, der vom Deutschen Rundfunkarchiv bei YouTube eingestellt wurde.
Ich wohnte damals nur eine halbe Stunde Fußweg entfernt im Prenzlauer Berg. Natürlich probierte ich alles aus: Wellenbad, Sauna, Sporthalle und Fitness-Räume, ließ mir in den Restaurants schmecken, was in für DDR-Bürger ungewöhnlicher Qualität angeboten wurde. Durchaus möglich, dass mir seinerzeit Gregor Gysi über den Weg lief – ich hätte ihn nicht erkannt, denn er gehörte zum Nachwuchs der Nomenklatura. Wahrscheinlich verbrachte er seine Freizeit in erlauchteren Kreisen, als FKK-Fan etwa an jenen Seeufern, die von Uniformierten mit Kalaschnikows bewacht wurden.
So eines gab es am Liepnitzsee, unweit von Erich Honeckers Wohnort Wandlitz. In einem wunderschönen Wald aus alten Buchen liegt dieses klare, tiefe Gewässer mit einer Insel in der Mitte und den schönsten Stellen zum Nacktbaden, die sich einer wünschen kann. Wochentags und außerhalb der Ferien war es sehr ruhig; manchmal war ich dort ganz allein. 1986 endeten die Ausflüge. Ich hatte mein Motorrad verkauft und wartete auf ›Entlassung aus der Staatsbürgerschaft‹, nachdem im Jahr zuvor SED und Stasi alle meine Arbeiten unterdrückt hatten. Ich jobbte als Kellner, hielt mich zweimal die Woche im SEZ fit, als ich an eben jenen ›Hotspot‹ geriet. Es war wohl so, dass mich eine Kollegin mitschleppte, in die ich – leider ergebnislos – verliebt war, sie war verheiratet, wartete gemeinsam mit ihrem Mann auf die erlösende Meldung von ›Inneres‹.
Stellen Sie sich vor, auf einer Wiese an einer der meistbefahrenen Straßen mitten in der Millionenstadt etwa zwei Dutzend Nackedeis jeglichen Alters und Geschlechts herumliegen oder -sitzen zu sehen, mit Picknick, Lesen, Kartenspiel oder dem Verteilen von Sonnencreme auf nahtlose Bräune beschäftigt, gern auch in inniger Umarmung. Meine Begleiterin wurde sogleich begrüßt, stellte mich vor – so etwa ›auch einer von uns‹ – und umstandslos begann ein Erfahrungsaustausch über Lebensläufe, Wartefristen, allfällige Schikanen, Verhaftungen, Ziele. Einmal flossen Tränen: Ein Gesuch war abgelehnt, der schwule Freund aus Westberlin an der Einreise gehindert, fortgesetztes Bestehen auf Ausreise mit Strafe bedroht worden. Zwischendurch, etwa im Abstand von ein bis zwei Stunden, erschien ein Volkspolizist. Die grüne Uniform war von Weitem zu sehen, einige zogen Badehosen oder Bikini über, manche aber verharrten, bis der ›Genosse Wachtmeister‹ sie ansprach.
›Ich fordere Sie hiermit auf, bedecken Sie sich!‹ Das klang nicht einmal unfreundlich. Grinsend taten die Nackten wie ihnen geheißen. Sobald ›das Schnittlauch – außen grün innen hohl‹ weg war, waren es auch die Textilien.
Das Spiel wiederholte sich – in leicht wechselnder Besetzung – an jedem sonnigen Tag. Einige gingen zwischendurch zum Sport, Schwimmen und Saunieren, die meiste Zeit verbrachten sie unter Ihresgleichen, eine schräge Gemeinde, keine Sekte, zusammengehalten nur von einem Ziel: Sie kamen dorthin, weil sie weg wollten, sie machten sich zum Ärgernis, auf dass der Staat das Naheliegende tue – sie ziehen lassen. Es hieß, die Badegäste des SEZ hätten sich immer wieder einmal beschwert, aber das halte ich für ein Gerücht. Das Personal dieses ›Sondervorhabens‹ bestand zu einem großen – wenn nicht zum überwiegenden – Teil aus Leuten, die für Erich Mielkes Liebesministerium arbeiteten. Das Vorzeigeobjekt für die Wonnen sozialistischen Lebens wäre übel befleckt worden, hätte es in seiner Umgebung gewaltsame Übergriffe gegeben. Die Gäste hinter den riesigen Glasfenstern kamen schließlich nicht nur aus dem Osten – sie brachten Devisen mit und konnten ›drüben‹ erzählen, wie entspannt es in der Hauptstadt der DDR zuging.
Ich war nicht oft dort. Einmal traf ich eine meiner Studentinnen, sie freute sich und erzählte, dass sie einen Dozenten aus Spanien kennengelernt habe, der sie demnächst ehelichen wolle. ›Herzlichen Glückwunsch‹, sagte ich, ›aber was willst du hier? Rausheiraten lassen ist die eleganteste Lösung. Kein Risiko. In dieser bunten Gesellschaft nimmt dich womöglich die Stasi auf den Kieker.‹ Sie schüttelte den Kopf.
›Ist dir noch nicht aufgefallen, dass hier niemand verhaftet, nicht mal ein Strafzettel verteilt wird? Das Völkchen hier an der langen Leine zu lassen, ist viel klüger, als sie zu kujonieren. Das Wichtigste ist, dass keiner ein Muster erkennen kann, nach dem jemand früher oder später freikommt. Sie und nur sie entscheiden, und über die Gründe für eine Entscheidung muss Ungewissheit herrschen. Ich komme her, um Spanisch zu lernen – und da habe ich Gesellschaft.‹ Sprach’s, zog ein Wörterbuch und einen Kassettenrekorder westlichen Fabrikats aus der Tasche und fläzte sich in den mitgebrachten Campingstuhl.
Die Ungewissheit hätte mich vielleicht schlimmer zermürbt, wären da nicht Fitnessräume, Sauna, Wellenbad, Solarinseln (keine UV-Särge! Scheinwerfer über Liegeflächen!) gewesen, schlingerndes Seelenleben zu stabilisieren und Lüste sprungbereit zu halten – meine und die meiner damaligen Freundin. Nein, sie ist mir nicht in den Westen gefolgt, sie hat in der Hauptstadt geheiratet und ihre Tochter aufgezogen. Mit dem SEZ, das wir gemeinsam besucht hatten, war es schon 1991 vorbei. Eigentümer wurde der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, von Grünen, Linken, Sozialdemokraten verwaltet und außerstande, Sanierung, Instandhaltung, laufenden Betrieb wirtschaftlich zu gestalten. Mit dem Investor, dem man das zunehmend herunterkommende Objekt 2003 für einen Euro verkaufte, ist man seither im juristischen Clinch. Nicht etwa wegen inzwischen aberwitziger Energiepreise für Bäder und Eishalle. Es geht nur noch darum, wer die millionenschwere Immobilie nach dem Abriss des SEZ als Baugrund verwerten darf. Ist schon eine Ironie, dass Sozialisten 40 Jahre nach der Eröffnung wegbaggern lassen, wofür sie sich damals feiern ließen.
›Unten ohne‹ ist für mich bis heute ein Vergnügen – sei’es mit Freunden am Kiessee neben dem Rhein, sei es in dem wunderbaren Friedrichsbad, 1877 über den Ruinen eines mehr als 2000 Jahre alten Römischen Bades erbaut. In dem Neorenaissance-Bau sprudelt 60° heißes Thermalwasser in historische Räume mit Majolika-Fliesen, fast alles ist im Originalzustand und denkmalgeschützt. Zwar ziehen auch hier gelegentlich lärmende Banausen durch, ignorieren Schilder mit Hinweisen auf den Zusammenhang von Ruhe und Entspannung, aber es ist eine Augenweide. Ob ich noch erleben werde, dass es hier auf Ruhebetten zu ›einvernehmlichem Geschlechtsverkehr‹ kommt wie die Wikipedia von den Solarinseln des SEZ zu berichten weiß?
Und wird das Friedrichsbad seinen 150sten Geburtstag als Oase des genussvollen Lebens oder nur noch als Denkmal feiern können? Es herrscht wieder – wie damals, als ich ›unten ohne auf dem Sprung‹ in die Freiheit das beste aus den lähmenden Zeiten der Politbürokratie Ost zu machen suchte: Ungewissheit. Unsere Thermalquellen sind versperrt. Solange ›oben ohne‹ verboten ist, bleiben sie es. Nein, nackte Demonstranten gegen das Manövrieren mit Angst und Ungewissheit wird es wohl nicht geben im schönen Baden-Baden, wo Tourismus, Gastronomie, Einzelhandel und die Zulieferer von ›Lockdowns‹“ gerade durch ›gesellschaftliche Zwänge‹ zerrieben werden. Ob allerdings demnächst die Verantwortlichen nicht ›unten ohne‹ – dastehen, ob die Basis, von der sie leben, ihnen nicht das Vertrauen aufkündigt, darauf würde ich nicht wetten. Es heißt auf dem Sprung bleiben.