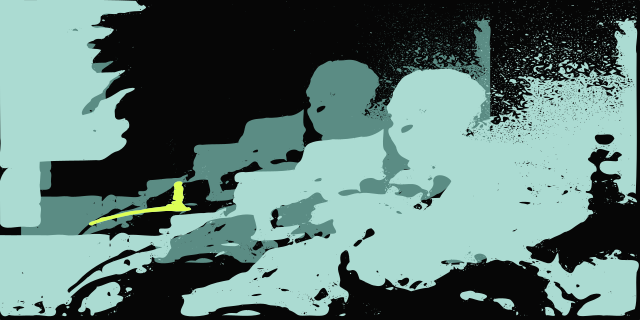von Ulrich Schödlbauer
Verfällt die Öffentlichkeit der westlichen Gesellschaften? Um das zu entscheiden, müsste man sich die Frage stellen, ob die Begriffe ›Verfall‹ und ›Öffentlichkeit‹ überhaupt zueinander passen. Ehrlich gesagt: Ich bin mir da nicht so sicher. ›Verfall‹ oder ›Dekadenz‹ setzt eine Normgestalt voraus, eine (meist kulturell gedeutete) erreichte Höhe, sagen wir, eines Baustils wie der Gotik oder des Barock oder eines allgemeinen Bewusstseins, die nur leider viel weniger gemessen, geschweige denn gedeutet werden kann. Die Rede vom Verfall bezeichnet dann den Fall, dass der Zenit überschritten ist und es bergab geht, also zum Beispiel – um vom Baustil auf die zugrunde liegende Gebäudemetapher zu kommen –, dass Sanitäranlagen nicht mehr richtig funktionieren und irgendwo der Putz zu blättern beginnt, sich hier und da bereits erste Risse im Mauerwerk zeigen und das Dach nicht mehr dicht hält.
Mit Spengler und anderen lässt sich diese ›Idee‹ – genauer: Vorstellung – der Dekadenz erfolgreich auf die Spätphase ganzer Kulturen anwenden, vorausgesetzt, man behält dabei im Auge, was Goethe über die Jahrhunderte spätrömischer Dekadenz dachte: Eine solche Dekadenz würde sich jeder wünschen. Jeder erfahrene Journalist oder Kulturkritiker weiß, wie’s geht: Man nehme das einschlägige Vokabular und charakterisiere damit den gesellschaftlichen Aufstieg sexueller Randgruppen, die Feminisierung der Politik oder die Einwanderungspraxis postnationaler Gesellschaften – und schon sitzt man, ideologiepolitisch gesprochen, in den Nesseln. Selbstredend kann auch das Individuum oder der Individualismus als solcher als dekadent angesehen werden. Aber Öffentlichkeit? Die Allgemeinheit ist die Allgemeinheit. Sie besitzt, so sollte man meinen, den ihr eigenen Grad an Gemeinheit und wird dadurch nicht besser, dass man sie bunt beflaggt.
1. Verfall ist keine Kategorie, die sinnvoll auf Öffentlichkeit angewandt werden kann, solange ein funktionierendes Gemeinwesen existiert
Organisationsformen können degenerieren – sei es durch starre Hierarchisierung oder durch horizontale Zellteilung, die irgendwann in Überspezialisierung und mangelhaften Informationsfluss umschlägt. In den Jahrhunderten nach der Erfindung des Buchdrucks und noch einmal durch den Rotationsdruck mitsamt seinen Folgen hat die bürgerliche oder liberale Öffentlichkeit gewaltige Organisationsschübe erfahren, an denen auch heute noch, im Zeitalter digitaler Vernetzung, der letzte Verbraucher partizipiert, wann und wo immer er seine Zeitung aufschlägt. Es mag in manchen Ohren kurios klingen, obwohl es doch nur eine Binsenweisheit ist: Im Zentrum der organisierten Öffentlichkeit steht der Verbraucher, der in Personalunion als Kundschaft und Publikum in Erscheinung tritt. Wo es Kundschaft gibt, muss es auch etwas zu kaufen geben. Damit deutet sich die Spaltung der Öffentlichkeit in einen aktiven und einen passiven Teil an: der eine füllt die Artikel-, der andere die Leserbriefspalten der Medien. Doch damit ist auch gesagt, dass der passive Teil, also das Publikum, nicht so passiv ist, wie es manche Meinungsmacher gern hätten.
Die medial organisierte Öffentlichkeit begleitet, einmal leiser, einmal lauter, der Verdacht, nur eine Teilöffentlichkeit zu repräsentieren: die veröffentlichte Meinung. Es ist nicht so lange her, dass liberale Meinungsblätter diesen Begriff regelrecht perhorreszierten, indem sie ihn, schon damals, als ›rechts‹ abkanzelten. Dabei hatten Elisabeth Noelle-Neumanns Untersuchungen zur ›Schweigespirale‹ längst gezeigt: Da ist was dran. Wenn heute gern von Gegenöffentlichkeit geredet wird, dann deshalb, weil der technische Fortschritt, sprich: das Internet, vor allem mit Hilfe der dort vertretenen sozialen Medien, theoretisch jeden Mitbürger in den Besitz der Produktionsmittel versetzt, deren es bedarf, um am Meinungsprozess teilzunehmen. Das Deutungsmonopol der organisierten Öffentlichkeit aus öffentlich-rechtlichen und privaten Leitmedien hat sich damit fürs erste erledigt. Entsprechend sinken die Renditen der Privaten, schrumpfen ihre finanziellen Möglichkeiten, ›anspruchsvollen Journalismus zu gewährleisten – und zwar mehr und mehr unter das Selbsterhaltungsniveau, weshalb die Branche während des vergangenen Jahrzehnts einen Teufelspakt mit einer Reihe diskreter Geldgeber geschlossen hat, von dem, aus naheliegenden Gründen, nur spärliche Informationen an den von ihr berieselten Teil der Allgemeinheit gelangen: Das sind, neben den üblichen Großinvestoren, offenkundig mehr und mehr auch Regierungsstellen. Und spätestens an dieser Stelle hört der Spaß auf. Denn Instanzen dieses Kalibers verlangen Gegenleistungen.
Ist das Verfall? Ich denke nicht. Das Internet hat den Printmedien die Schuhe ausgezogen und die Meinungsmonopolisten alter Schule sind ins Straucheln geraten (der Ausdruck ›Gegenöffentlichkeit‹ trifft die Sache nicht, weil Öffentlichkeit als kommunizierende Allgemeinheit stets eine ist). Die entthronten Meinungsmonopolisten haben sich, vielfach mit Unterstützung des Gesetzgebers, das ›Internet‹ als propagandistischen Feind erkoren, gleichgültig darum, dass sie bereits große Teile davon beherrschen. Denn selbstverständlich wissen auch sie, dass dort die künftigen Renditen erobert werden wollen. Dementsprechend formieren sich die Angegriffenen als Gegenmacht. Als Ausgegrenzte profitieren sie vom Aufmerksamkeitswert, den so ein Konflikt nun einmal hervorbringt. Dass die Altmonopolisten – oder Oligopolisten, falls der Begriff mehr zusagt – so erstaunlich regierungsfromm geworden sind, wie täglich zu erleben, liegt einerseits sicher an den diskreten Unterstützungsprogrammen, andererseits daran, dass der ideologische Kampf gegen eingebildete oder wirkliche Staatsfeinde natürlich weit mächtigere Ressourcen mobilisiert als das Klein-klein unterschiedlicher Meinungen zu irgendwelchen Sachthemen, die ausdiskutiert gehören.
Wer will, kann darin einen Verfall der Meinungsvielfalt erkennen. Es herrscht eine neue Bravheit in den Ländern des liberalen Westens, begleitet von einer Welle der Feindseligkeit gegen Andersdenkende, welche die Bevölkerungen bis tief in die Familien hinein spaltet. Das ist ganz unübersehbar. Weniger offensichtlich, aber deshalb nicht weniger wichtig ist aber etwas anderes: Dadurch, dass die Meinungsmonopolisten alter Schule durch die Ökonomie auf die Schlachtfelder des Internet gezwungen werden, wo sie sich ihren – in gewisser Weise selbst gezogenen – Feinden stellen müssen, sinkt das Risiko drastisch, dass Öffentlichkeit insgesamt zur Beute ideologisch aufgestellter, am Gängelband weitgehend ungenannter Interessen laufender Gesinnungsdompteure wird. Wer will, kann sich der Meinungsführerschaft beanspruchenden Gewalt gewisser Kreise durch ein paar Mausklicks entziehen. So einfach war der Rückzug auf alternative Informations- und Meinungsquellen noch nie. Entsprechend hektisch verläuft das Rennen nach neuen – und effektiven – Formen der Zensur.
2. Öffentlichkeit und Diskussionskultur sind nicht dasselbe
Natürlich darf man sich an dieser Stelle fragen: Wie steht es um die Diskussionskultur? Es ist offenkundig, dass offen ausgetragene Feindschaft, die mit ›Fake News‹, Schmähvokabular und Kontaktschuld operiert, die öffentliche Diskussionsbereitschaft gewisser Kreise schmälert, wenn nicht vernichtet. Daraus lässt sich vor allem eines lernen:
3. Der Verfall der guten Sitten ist ein Treiber von Öffentlichkeit
Die guten Sitten lassen sich in zweifacher Weise interpretieren: (a) als Gradmesser des in einer Gesellschaft waltenden Anstands und (b) als erstickendes System der Niederhaltung alles dessen, was der einen oder anderen Seite nicht genehm ist. In der Regel fehlt die Instanz zu entscheiden, welche von beiden Interpretationen just die richtige ist. Der Weg der ›Political Correctness‹ als Taktgeber öffentlicher Äußerungen in die Falle des Dogmatismus und Fanatismus ist damit vorgezeichnet. Wo die Korrektheit, statt in der Sache Partei zu ergreifen, Sache der Parteien wird, verkehrt sich ihr Sinn – und leider auch ihr Ton – rasch ins Gegenteil. Doch auch eine auf Krawall gebürstete Öffentlichkeit bleibt Öffentlichkeit – vital, funkelnd, aufmerksamkeitsfordernd und -beherrschend.
4. Je tiefer der Graben zwischen präsenter und medialer Öffentlichkeit, desto wahrscheinlicher wird das Vorhandensein einer institutionellen Krise
Einen Gutteil der Öffentlichkeit beanspruchen die Auftritte der Mächtigen: die Zurschaustellung von Staatsmacht mit Hilfe von Herrschaftszeichen, Herrschaftsarchitektur, Paraden, Autokorsos, Flaggenschmuck, Balkonszenen, Reden ans Volk und dergleichen mehr – rituelle Elemente repräsentativer Öffentlichkeit, die gelegentlich auch, in Anbetracht ihres historischen, sprich vor-aufklärerischen Vorlaufs, als ›Proto-Öffentlichkeit‹ bezeichnet wird. Dem entspricht eine Auffassung, der zufolge die ausgebildete, reife, eigentliche Öffentlichkeit erst und nur dort anzutreffen ist, wo die aktive Teilhabe aller, jedenfalls der Intention nach, mitgedacht wurde.
Allerdings wird eine solche aktive Teilnahme auch den Teilnehmern einer kirchlichen Prozession abverlangt. Doch natürlich fehlt hier etwas: Man könnte es das Element der Positionsbestimmung, der Selbstbestimmung innerhalb eines wogenden Feldes widerstreitender Positionen und Möglichkeiten nennen. Öffentlichkeit und Streitkultur gehören, jedenfalls in Europa, seit der Aufklärung zusammen. Es schönt das Bild nur wenig, diese Form der Öffentlichkeit mit Jürgen Habermas als ›kritische‹ Öffentlichkeit zu bezeichnen, vorausgesetzt, man hat dabei im Ohr, was ›Kritik‹ im Zeichen der Auseinandersetzung bedeutet: die Verhandlung eines gegebenen Sachverhaltes vor dem Richterstuhl der Vernunft, der im Medium der Öffentlichkeit sozusagen zweimal aufgeschlagen ist, einmal im Streitenden selbst, soweit er gewillt ist, sich dem besseren Argument zu beugen, sodann im Verhältnis der Streitenden zum Publikum, das, sobald die Dinge politisch werden, zum Volk mutiert.
Folgt man dem Historiker Reinhart Koselleck, dann ist diese Mutation, wenngleich ohne Wissen der Akteure, bereits im Aufklärungsanspruch ›kritischer‹ Öffentlichkeit enthalten. So betrachtet, wäre die Öffentlichkeit ihre eigene Krisis und als solche die Krise des autoritären Staates – was an sich wenig besagt, weil im Medium der Kritik jeder existierende Staat bloß autoritär, soll heißen defizitär gedacht werden kann, jedenfalls dann, wenn man den Maßstab vernünftiger Selbstbestimmung aller an ihn anlegt.
Nicht enthalten ist in Kosellecks Modell von Öffentlichkeit die grundlegende Duplizität von Öffentlichkeit. Einerseits existiert Öffentlichkeit als räumliche Präsenz – von den Marktplätzen, Theatern, Foren und Arenen der Antike bis zu den Demonstrationsmeilen, Fußgängerzonen, Kneipen und Bars, in denen die öffentlichen Dinge lautstark oder halblaut verhandelt werden, wobei die Lautstärke als Gradmesser freier Rede zu betrachten ist. Andererseits existiert sie als medialer Raum, den sich die verschiedensten Sprecher und Sprechergruppen teilen. In beiden Fällen lässt sich die Frage stellen, wer die jeweiligen Räume, die physischen wie die medialen, beherrscht und wie rigide er sie beherrscht. Rigidität bedeutet Zwang oder, subtiler, Tabu, also offene oder versteckte, gelegentlich sogar unbewusste Zensur.
Auch diese Duplizität ist alt. Im Grunde ist sie eine Konsequenz der Schriftkultur und der in ihr angelegten Weltverdoppelung. Das heißt aber nicht, dass beide Seiten nicht von Zeit zu Zeit in ein spannungsvolles Gegeneinander gerieten. Jene 68er Studenten, die ihren Straßenaufruhr, ihre Sit-Ins und Happenings in den Abendnachrichten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens am Wohnzimmertisch kontrollierten, wollten nicht bloß wissen, ob die Frisur richtig saß und ob man sich hinreichend in den Vordergrund gespielt hatte (das sicher auch), sondern sie wollten (1) sichergehen, dass sie drin waren, und (2) lernen, welche Provokationen funktionierten und an welchen noch gearbeitet werden musste. Das unidirektional sendende, also autoritäre und unterstelltermaßen regierungsfreundliche Fernsehen wurde in diesem aufrührerischen Spiel zum Feind, dessen Kräfte man, gemäß der chinesischen Kampfregel, gegen ihn selbst zu wenden versuchte. In anderer Weise bedeutsam wurde das Fernsehen – in diesem Fall das Westfernsehen – 1989 für die Teilnehmer der Leipziger Montagsdemonstrationen: Es sicherte ihnen exakt die mediale Öffentlichkeit, die ihnen der eigene Staat verweigerte.
Das bedeutet nicht zwingend, dass ›die Leute‹ dies und die Medien jenes meinen. Es bedeutet, dass diesseits und jenseits der Linie aneinander vorbei informiert, diskutiert, ge- und verurteilt wird, gleichgültig, wie die Mehrheitsverhältnisse sich gestalten. Wenn also wissenschaftliche Untersuchungen im Nachgang zur medialen Berichterstattung im Flüchtlingsjahr 2015 in den führenden Medien ein starkes Übergewicht regierungsfreundlicher Beiträge konstatierten, dann trifft das nicht den Kern des Problems. Das Problem besteht darin, dass das Wechselspiel von Argumenten und Meinungen (sprich Überzeugungen) dann außer Kontrolle gerät, wenn die eine Seite den Reden der anderen ausschließlich Meinungs-, den eigenen hingegen Argumentcharakter bescheinigt und dieser Gegensatz zum Zankapfel zwischen den verschiedenen Formen der Öffentlichkeit gerät. Nicht die Öffentlichkeit kommt dabei in Gefahr, sondern die Gesellschaft: Plötzlich liegt ihre Fähigkeit, die Verständigungsleistungen zu erbringen, ohne die partizipatorische Herrschaft nicht gelingen kann, in den Händen von Demagogen, die, selbstverständlich in bester Weltrettungs-Absicht, eine im Kern autoritative, tendenziell totalitäre Agenda verfolgen.
Frage: Kann die Substitution von kritischer Öffentlichkeit durch Propaganda Leben retten?
In den letzten Jahren haben sich, verstärkt durch Migrations-, Klima- und Pandemie-Regime, verstörende Tendenzen in das öffentliche Leben der westlichen Staaten eingeschlichen, die, nach den Erfahrungen mit überwunden geglaubten Totalitarismen, ein für allemal aus dem zugelassenen Repertoire verbannt schienen, während sie in demokratiefernen Regionen des Globus zum Alltag gehören, Techniken der indirekten, bis zur sozialen Annullierung der Person reichenden Zensur, die heute allgemein unter den unzureichenden Begriff ›Cancel Culture‹ gefasst, gelegentlich auch als ›Verengung des zugelassenen Meinungskorridors‹ bezeichnet werden. Wobei das Canceln, das Unter-den-Tisch-fallen-Lassen vor allem die Matadore der Öffentlichkeit betrifft, die schmerzlich zur Kenntnis nehmen müssen, dass ein falsches Wort genügt, um ihnen Einkommens- und Reputationseinbußen zu bescheren. Demgegenüber trägt die Rede vom zugelassenen Meinungskorridor selbst tendenziell freiheitsfeindliche Züge, weil die implizit erhobene Forderung nicht der Freiheit der Meinungsäußerung, sondern dem Zugelassensein gilt.
In der Löschpraxis der sozialen Medien wird ein neuartiger Herrschaftsanspruch sichtbar, der sich in der offenkundigen Absicht zwischen die Regierenden und ihr ›Volk‹ schiebt, beide Seiten zu manipulieren. Ein solcher Anspruch benötigt, neben der schieren Verfügungsmacht über das Medium, eine legitimatorische Basis. Wer sich umsieht, gerät rasch an eine Reihe globaler Vereinbarungen, mit deren Hilfe sich die Regierungen unspektakulär Zugriff auf den heimischen Meinungsmarkt verschafft haben, klassischerweise durch Zielabsprachen, die ihr repressives Potential unter einer Wolke wohltätiger Zwecke verbergen. Was wäre wohltätiger als die Rettung von Menschenleben? Gewiss nichts. Zitiert seien zwei Stellen aus dem UN-Migrationspakt (2018):
»Vor diesem Hintergrund soll der Globale Pakt für Flüchtlinge Grundlage für eine berechenbare und ausgewogene Lasten- und Verantwortungsteilung zwischen allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und gegebenenfalls anderen relevanten Interessenträgern sein, darunter internationale Organisationen inner- und außerhalb des Systems der Vereinten Nationen (…) internationale und regionale Finanzinstitutionen, Regionalorganisationen, lokale Behörden, die Zivilgesellschaft, einschließlich religiöser Organisationen und wissenschaftlicher und anderer Sachverständiger, der Privatsektor, Medien, Mitglieder der Aufnahmegemeinschaften sowie die Flüchtlinge selbst (im Folgenden ›relevante Interessenträger‹).«
Einleitung A, Absatz 3
»In Anbetracht dessen, wie wichtig gute zwischengemeinschaftliche Beziehungen sind, werden bis zur Verfügbarkeit dauerhafter Lösungen Programme und Projekte konzipiert werden, die dem Zweck dienen, alle Formen der Diskriminierung zu bekämpfen und ein friedliches Zusammenleben zwischen Flüchtlingen und Aufnahmegemeinschaften zu fördern, im Einklang mit den nationalen Politikvorgaben. (…) Zur Förderung des Respekts und der Verständigung sowie zur Bekämpfung der Diskriminierung werden das Potenzial und der positive Einfluss der Zivilgesellschaft, religiöser Organisationen und der Medien, einschließlich der sozialen Medien, zur Geltung gebracht werden.«
Teil II 2 Abschnitt 10
Die Richtung, in die sich diese Auslassungen bewegen, ist deutlich: Es handelt sich um die Indienstnahme der – nominell unabhängigen – Medien für eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe unter Federführung der ›relevanten Interessenträger‹, insbesondere der Staaten, sprich der nationalen Regierungen, soweit sie in den Pakt eingebunden sind und ihn gemäß den ›nationalen Politikvorgaben‹ interpretieren. Das ist ein ziemlicher Freibrief für die Umgestaltung der nationalen Medienlandschaften. Die Bundesrepublik hat den Pakt 2018 unterzeichnet. Auf den Seiten des Auswärtigen Amtes heißt es dazu relativ unzweideutig:
»Die Umsetzung des Globalen Pakts soll ›unter Berücksichtigung der unterschiedlichen nationalen Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen und unter Beachtung der nationalen Politiken und Prioritäten‹ erfolgen. Der Globale Pakt ist kein völkerrechtlicher Vertrag und nicht rechtsverbindlich, seine Umsetzung liegt in der nationalen Souveränität der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. In Deutschland obliegt die Umsetzung auf nationalstaatlicher Ebene der Bundesregierung. (…) Ein großer Teil der im Pakt vorgesehen Maßnahmen wird in Deutschland ohnehin bereits umgesetzt.«
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/migration/umsetzung-globaler-migrationspakt-wie-geht-es-weiter/2229674
Das war 2018. Die heutige Verabreichungs- und Löschpraxis geht, beflügelt durch den US-Kulturkampf und die im Zuge der von der WHO ausgerufenen Corona-Pandemie erlassenen Regulierungen, bereits weit über den damaligen Stand hinaus. Gleichzeitig dürfte den Regierungen deutlich geworden sein, dass sie damit, uneingedenk Hegels Dialektik von Herr und Knecht, sich selbst den Zensor in Gestalt globaler Medienplattformen ins Haus geholt haben, denen es nichts auszumachen scheint, bei Bedarf auch den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ›löschen‹ – für welchen Bedarf und zu welchem Ende, wer will das heute wissen?
Zitate: Unterstreichungen durch den Autor.