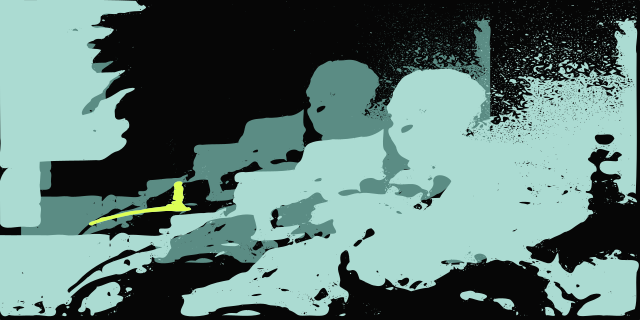von Boris Blaha
Lebenserfahren nennt man jemanden, der viel herumgekommen ist, viel erlebt hat, zahlreiche unterschiedliche Länder, Menschen, Sitten und Gewohnheiten kennengelernt, ja sie buchstäblich erfahren hat. Dagegen wird man Menschen, die nie aus ihrem kleinen Dorf herausgekommen sind und solchen, die das geistige Milieu ihres Konfirmationsstuhlkreises ihr Lebtag nicht verlassen haben, einen eher beschränkten Horizont attestieren. Erfahren kann nur werden, wer sich Gefahren aussetzen kann, wobei hier als Gefahr nicht nur eine existenzielle Lebensgefahr gemeint ist, sondern jegliche Konstellation, in der man nicht sicher vorhersehen kann, was sich als Nächstes ereignen wird. Für dieses Fehlen von Gewissheit gibt es im Deutschen den schönen Begriff ›unheimlich‹. Unheimlich kann schon der dichte Wald sein, in dem das flaue Gefühl der Orientierungslosigkeit auftaucht, was in aller Regel das berüchtigte ›Pfeifen im Walde‹ hervorruft. Wer noch genügend Fantasie hat, mag sich vorstellen, wie es wohl gewesen sein muss, als sich Gefährten auf unsicheren Schiffen das erste Mal aufs offene Meer hinauswagten und außer Wasser rings herum nichts anderes mehr zu sehen war. Im Unterschied zu heute galt früheren Zeiten die Fähigkeit, ungewisse, gar gefährliche Begegnungen, zumal mit Fremdem, in friedliche und angstreduzierte Bahnen zu lenken, ungleich mehr.
Auch ohne die philosophische Aufklärung des Westens haben viele Kulturen den inneren Zusammenhang zwischen Gefahr und Erfahrung intuitiv verstanden. Der Ethnologe Arnold van Gennep berichtete von zahlreichen Übergangsriten, mit deren Hilfe die schwierige biografische Passage vom Jugendlichen zum Erwachsenen gefordert, erleichtert und eingeübt wurde. Auch in Europa war über viele Jahrhunderte hinweg nach der Lehrzeit in etlichen Handwerksberufen die Wanderschaft, auch Walz genannt, die Voraussetzung dafür, überhaupt Meister werden zu können. Selbst die von allem Weltlichen zurückgezogenen Klöster schickten Mönche auf gefährliche Reisen durch ganz Europa, um wertvolle Bücher zu kopieren. Klugheit und Erfahrung wurden ebenso geschätzt wie die Gelassenheit, nicht bei jeder kleinen Unterbrechung des Gewohnten gleich aus der Haut zu fahren. Die Großväter erzählten nicht nur von früher, sondern auch von draußen, dem Außerhalb der vertrauten Umgebung.
Von derlei zivilisatorischen Errungenschaften sind wir wieder weit entfernt. Die gleichen Leute, die Menschenrechte für ein unhintergehbares Prinzip halten, bezeichnen mittlerweile andere Menschen als gefährliche Bakterien, krebsartige Geschwüre oder Unkraut. Wer solche Reden in die allgemeine Sprache einführt, hat sicher auch keinerlei Probleme damit, zur Beseitigung von Unkraut entsprechende Vernichtungsmittel einzusetzen. Die Sprache ist inzwischen so offen menschenverachtend, dass man sich verwundert fragen muss, wie das in einem Land geschehen kann, das seine Betroffenheitskultur zu höchster Blüte getrieben hat.
Schon am Begriff ›Flüchtling‹ war deutlich geworden, in welchem Ausmaß seine allgemeine Verbreitung Berichte über tatsächliche Erfahrungen mit Fremden untersagte. Erinnert sei nur an das ›kommunikative Beschweigen‹ der Silvesterereignisse von Köln. Bis heute muss das eine Bild mit immer größerem Aufwand gegen die Ereignisse der Wirklichkeit abgedichtet werden, ein Zug, der tief in der abendländischen Geistesgeschichte verankert ist. Hannah Arendts erste Vorlesung bei Heidegger – Platons Sophistes – handelte von der Festschreibung der Rangordnung zwischen sophia und phronesis, eine Verfestigung, die nach dem Untergang der Antike erst Machiavelli wieder auflockerte.
Die Intensität der Aufregung um eine vergleichsweise belanglose Wahl eines Ministerpräsidenten hat diesen Zug der Wirklichkeitsabwehr noch deutlicher als bislang hervortreten lassen. Wie ein nächtlicher Blitz, der eine Szenerie schlagartig erhellt, machen Reaktion und Wortwahl der Bundeskanzlerin die politische Konsequenz sichtbar, die in der Tradition der modernen Selbstvergewisserung liegt. Mit Verweis auf Machiavelli, der diesen Konflikt zwischen Christenmensch und politischer Verantwortung als erster verstanden hatte, sprach Arendt vom Unterschied zwischen der ›Sorge um das Selbst‹ gegenüber der ›Sorge um die Welt‹ und davon, dass es in der Politik darum gehe, nicht gut zu sein, also gerade nicht im Sinne christlicher Moralvorstellungen zu handeln. Das im christlichen Abendland häufiger vorkommende Aufflammen religiös motivierter Reinigungsleidenschaften spricht für die anhaltende Stabilität der ›Sorge um das Selbst‹.
Wenn unsere Bundeskanzlerin einen demokratischen Wahlakt als unverzeihlich qualifiziert, so erhält nicht nur das allgemeine und gleiche Wahlrecht eine neue Qualität. Bestimmte Abgeordnete sind nun nicht mehr gleich. Sie tragen das Kainsmal deutlich sichtbar auf der Stirn. Mit ›unverzeihlich‹ wird zudem eine Schuld eingeführt, die im Strafgesetzbuch aus gutem Grund nicht vorgesehen ist – die Kontaktschuld. Die Unverzeihlichen dürften eigentlich weder wählen, noch sich überhaupt in einem öffentlichen Raum aufhalten, denn jeder Kontakt mit einem solchen, jede zufällige Begegnung auf der Straße, im Fahrstuhl, in einem Café enthält schon die Gefahr einer Ansteckung, die nie wieder gutzumachen wäre. Jude und Klassenfeind in einem, werden die Unverzeihlichen zur Verkörperung alles Negativen. Die erfolgreiche Auslagerung entlastet die Auslagernden vom Anspruch eigener Konfliktbewältigung und verhilft ihnen zu einer fragilen Scheinidentität. Damit sie nicht wieder zerbricht, muss das Feindbild permanent gemacht werden. Müsste man jetzt die Unverzeihlichen nicht in Lagern konzentrieren? Die auf dem intellektuellen Tiefpunkt angekommene SPD war sich nicht zu schade, Gesetze wieder rückgängig machen zu wollen, die mit unverzeihlichen Stimmen verabschiedet worden waren. Kurzfristigen Ruhm erlangte auch die Vorsitzende einer Landtagsfraktion mit der bemerkenswerten Einsicht, Faschisten würde man zweifelsfrei daran erkennen, dass sie höflich sind. Selten wurde anschaulicher demonstriert, wie sich Geschichte als Farce wiederholt.
Die Kontaktschuld wirkt als Erfahrungsverbot. Das Verbot der Erfahrung steckt schon im ersten der zehn Gebote: Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben heißt ja nichts anders als: Du sollst eine Vorstellung vor alles andere stellen. Unverzeihlich handelt ab sofort, wer sich einen eigenen Zugang zur Wirklichkeit verschaffen will, ist doch der Kontakt zur Wirklichkeit als solcher schon verdächtig. Die Bonner/Berliner Republik ist zu Ende. Die SED wird es freuen. Nachdem sie schon die Ostzone ruiniert hat, kann sie jetzt auch im Westen ganze Arbeit leisten. Der Antifaschismus wird zur neuen Staatsreligion deklariert, das Grundgesetz dient nur noch als Fassade. Meinungsfreiheit stand auch in der DDR-Verfassung. Gefordert wird jetzt ein echtes Bekenntnis zum neuen Einheitsglauben. Wer noch nicht konvertiert ist, sollte es jetzt tun. Cuius regio, eius religio. Im Kampf gegen das Böse sind Parteien entbehrlich, eine geschlossene Front genügt. Man müsse jetzt zusammenstehen. Die Bücklinge beeilen sich und stehen Schlange. Eine allgemeine Kennzeichnungspflicht der Unverzeihlichen müsste jetzt die verbleibenden Reinen vor jeder Kontamination schützen. Der ganze Spuk wäre sofort vorbei, wenn Bürger tun würden, was nach allgemeiner Auffassung zum Status eines Erwachsenen gehört: sich in Dingen allgemeiner Relevanz eine eigene Meinung zu bilden. Es würde schon genügen, Bundestagsreden zu verfolgen oder das offizielle Programm zu studieren. Die ganz Mutigen könnten sogar einen der Unverzeihlichen zum Kaffee einladen und sich, wie das am Tisch so üblich ist, gepflegt unterhalten. Der ganze infantilisierte Zirkus funktioniert nur unter der Voraussetzung, dass sich erwachsene Menschen ohne jede Not vorschreiben lassen, welche Begegnungen erlaubt und welche verboten sind. Das einstige Land der Dichter und Denker hat sich in eine Region kreischender und duckender Kinder zurückentwickelt. Zum dritten Mal nach 1918 tun die Deutschen alles, um sich den Titel des politisch dümmsten Volkes redlich zu verdienen.
Im Endstadium der ideologischen Fiktion entsteht durch die Einbildungskraft zwischen dem fiktiven Bild des Wirklichen und einer möglichen Erfahrung ein unüberwindlicher Graben. Der reine Glauben hat jeden Außenbezug aufgegeben, sich vollständig in sich selbst zurückgezogen und sich dort verkapselt. Alle Türen und Fenster sind fest verriegelt. Ironie der Geschichte: sie nennen ihr Erfahrungsverbot weltoffen. Tatsächlich handelt es sich um ein von der Wirklichkeit abgesondertes Selbstverhältnis, das die theologische mit der philosophischen Metaphysik teilt. Die Monade, so erklärte Leibniz, hat keine Fenster, enthält aber in sich das Ganze. Das Paradox der Kantischen Metaphysik: die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung verunmöglicht jede tatsächliche Erfahrung. Nur seine dritte Kritik arbeitete mit einem Weltbezug.
Die vollständige Absonderung von der wirklichen Welt hat Folgen: Die Schar der auserwählten Heiligen landet am Ende dort, wo sie herkam...