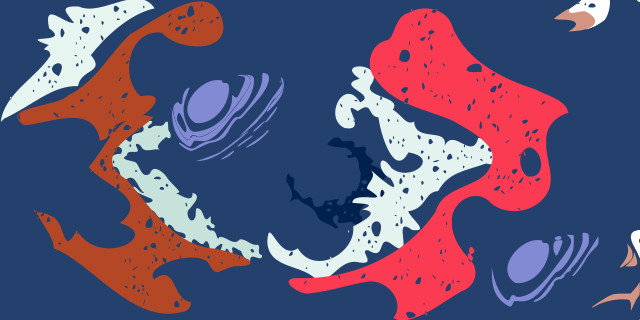von Herbert Ammon
Das Gedenken an den 11. November 1918, an dem der Waffenstillstand im Walde von Compiègne das Gemetzel des Großen Krieges beendete und doch nur eine Zwischenkriegsphase einleitete, ist erneut Anlass zum Nachdenken über Europa. Die Nachricht, dass Europa sich wieder in einer Krise befindet, könnte man gelangweilt ad acta legen, wären da nicht so viele Zeichen, die ernstzunehmen sind:
1. das durch den Krieg in der östlichen Ukraine akzentuierte, an den Kalten Krieg gemahnende Verhältnis der EU zu Russland, 2. die durch Kanzlerin Merkel – gestern noch »the most powerful woman in the world« (Time Magazine) – ausgelöste ›Flüchtlingskrise‹, die Europa mit den umfassenderen, ungelösten Themen ›Migrationsdruck‹, ›Migration‹ und ›Widersprüche der Integration‹ konfrontiert, 3. der durch Merkels moralisch überhöhtes, opportunistisches Agieren forcierte Brexit, 4. die nur aufgeschobene, durch Italiens Schuldenprogramm erneut akut werdende Euro-Krise, 5. die auch unter Macron anhaltende Instabilität Frankreichs, 6. das Aufkommen der ›populistischen‹, EU-skeptischen Kräfte in Parallele zur Widerspenstigkeit der osteuropäischen Staaten gegenüber den von der liberalen EU-Elite verfolgten Konzepten, 7. last but not least die politisch-kulturellen Folgen der Multikulturalisierung des alten Kontinents.
Wie dunkel sind die Wolken, die über Europa heraufziehen? Wie gelangen ›wir Europäer‹ wieder in eine hoffnungsreiche Zukunft – wie ehedem im Revolutions- und Wendejahr 1989/90?
Die Themen ›Europa in der Krise‹ und ›Demokratie in der Krise‹ sind nicht identisch, aber sie überlappen sich. Unter diesem thematischen Doppelaspekt stand die Veranstaltung ›Demokratie unter Druck‹, welche die grün-schwarze Landesregierung von Baden-Württemberg zusammen mit dem Magazin Cicero in der Berliner Landesvertretung des Südweststaates abhielt. (Die Veranstaltung ist auch auf youtube abrufbar.)
Die einführenden Worte sprach Volker Ratzmann, als Grüner aus Berlin in das Amt des Bevollmächtigten und Staatssekretärs der baden-württembergischen Landesregierung beim Bund berufen. Auf dem Podium saßen, eingerahmt von den Cicero-Redakteuren Alexander Marguier und Christoph Schwennicke als Moderatoren, der belgische Althistoriker David Engels, derzeit tätig an der Universität Posen, die Politologin Ulrike Guérot, Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems sowie Joschka Fischer, zuletzt hervorgetreten als Autor des Buches Scheitert Europa?
Nicht der für ihren Europa-Enthusiasmus bekannten Politologin Guérot – zusammen mit dem Schriftsteller Robert Menasse und anderen ›Kulturschaffenden‹ plant sie in diesen Novembertagen in diversen deutschen und/oder europäischen Theatern die Ausrufung der ›Europäischen Republik‹ – fiel die Ehre des ersten Wortes zu, sondern David Engels, Präsident der internationalen Oswald Spengler Society. In dieser Funktion hielt er unlängst die Laudatio auf den als Warner vor der Unterwerfung unter den Islam (La Soumission) zu Berühmtheit gelangten Preisträger Michel Houellebecq.
Engels warnte einerseits vor vorschnellen historischen Analogien, bekräftigte andererseits den Nutzen der Historie hinsichtlich der in zeitlich wechselnder Gestalt hervortretenden Entwicklungsmuster. Sein großes Thema ist nicht der von Kritikern der Masseneinwanderung gewöhnlich zitierte Niedergang des Weströmischen Reiches, sondern die Krise der alten res publica Romana im ersten Jahrhundert vor Christus. Engels sieht Entsprechungen zur Gegenwart in Phänomenen wie dem demographischen Niedergang, dem Verlust des Vertrauens in die alte Religion, begleitet vom Eindringen des Multikulturalismus. Die ökonomische Globalisierung im – militärisch errungenen – Mittelmeerraum war begleitet von sozialer Polarisierung, von Konflikten zwischen dem populus und der Adelspartei, als Ablenkung dienten Brot und Spiele. Zugleich sah sich Rom als ›Zivilisation‹ Bedrohungen durch die ›Barbaren‹ ausgesetzt, worunter nicht allein die Seeräuber zu zählen waren. Der Vertrauensverlust in die Institutionen der Republik führte zu ›populistisch‹ angeheizten Parteikämpfen, zu Bürgerkriegen und mündete schließlich mit dessen Versprechen der Rückkehr zum mos maiorum in den Prinzipat des Augustus.
Das autoritäre Regime des Augustus trug somit traditionalistische Züge, aber es garantierte wieder Recht und Ordnung. Name und Begriff des ›Cäsarismus‹ fehlten in Engels' Ausführungen. Analogien zur Gegenwart legte er wiederholt nahe: Dazu gehören der Verlust der christlichen Glaubenstradition einerseits, das Anwachsen der muslimischen Bevölkerungsgruppen in Westeuropa andererseits. Unübersehbar sind die sozial-kulturellen Krisenherde in den Banlieues. Auf diese Krisenphänomene habe man noch keine Antwort gefunden. Im Gegenteil: (West-)Europa erzeuge mit seiner pazifistischen Grundtendenz – nicht zu letzt gegenüber dem militanten Islam – nur neue Krisen – mit der unerfreulichen Aussicht auf einen autoritären Staat.
Auch David Engels hält eine stärkere europäische Einigung – mit mehr Rücksicht auf die Sensibilitäten der Staaten Osteuropas – für nötig. Mit dem von Guérot propagierten Konzept einer ausschließlich von demokratisch-republikanischem Selbstbewusstsein europäischer citoyens getragenen Republik kann er indes nichts anfangen.
Auf den gelassen argumentierenden Kulturkritiker Engels folgten Wortkaskaden der Europa-Enthusiastin Guérot, ehedem Referentin des CDU-Politikers Karl Lamers. Sie belehrte das Auditorium über Inhalt und Wert des Begriffs Republik. Wer meine in ›Deutschland‹ zu leben, befinde sich im Irrtum: Es sei die Bundesrepublik Deutschland, mithin eine Republik. Das Europa der Gegenwart lebe in einem Zustand, zumindest in einer Vorstufe von stásis. Für Nicht-Gräzisten – oder Politiologen – erläuterte sie ihren Lieblingsbegriff, übersetzbar mit ›Stockung‹, aber leider auch mit ›Bürgerkrieg‹: Unlängst habe Emanuel Macron an den guerre civile européenne erinnert. Allenthalben seien Symptome von stásis zu registrieren, beispielsweise in England (offenbar angesichts des Brexit). Die Lage in England erinnere an Bürgerkrieg und Revolution vor einigen Jahrhunderten. Hierzu genügten der Professorin Stichworte: ›Heinrich VIII., 1688‹. Ob vom Redeschwall überwältigt oder ob aus chivalresker – selbst in feministischen Zeiten zuweilen noch gebotener – Rücksichtnahme verzichteten die Herren auf dem Podium auf eine Korrektur des eigenwilligen Geschichtsbildes der Dame.
Auch im Publikum war Gelächter nicht zu vernehmen. Im Gegenteil: Für ihre leidenschaftlichen Interventionen zur Rettung, besser zur Neugründung Europas erntete die Kremser Politologin mehrfach den stärksten Beifall, deutlich mehr als Joschka Fischer. Der Ex-Außenminister (und multiple Aufsichtsrat) Fischer präsentierte sich – in verwaschenen blauen Jeans, rosa Hemd und Jacke – als elder statesman. Aufgefordert, seine Vorstellung eines ›europäischen Deutschland‹ zu explizieren, ließ er sich die Chance zu einem historischen Kurzvortrag nicht nehmen. Seit der Reichsgründung 1870/71 sowie der stets gefährdeten hegemonialen Rolle, noch keineswegs gebrochen durch die Niederlage im Weltkrieg 1918, sei Deutschland nicht nur machtpolitisch, sondern auch intellektuell (!) stets überfordert gewesen. Europa selbst habe seine Souveränität 1945 an die beiden Hauptsiegermächte verloren. Die Chance zu einer neuen Rolle mit wiedergewonnener Souveränität liege in dem von der EU vorgegebenen Rahmen. Gefahr drohe indes von den Nationalisten, wie schon Mitterrand in seiner Abschiedsrede gewarnt habe: ›Nationalismus ist der Krieg.‹ Entscheidend für das Schicksal Europas seien die Wahlen zum EU-Parlament 2019.
Für Guérots Vision einer ›Europäischen Republik‹ hat Fischer nur milden Spott übrig. Das Prinzip ›one man / one woman – one vote‹ sei angesichts der höchst unterschiedlichen Bevölkerungsgrößen der – von Fischer »als historisch gewachsene Realitäten« (!) akzeptierten – Nationen nicht praktikabel. Die von Guérot propagierte Abschaffung des – aus ihrer Sicht undemokratischen – Europäisches Rates bedeute die Aufhebung des demokratischen Prinzips, da eben die im Rat vertretenen Regierungen demokratisch legitimiert seien. Zu Guérot: »Die Republikausrufung findet im Theater statt.« Als Guérot sich auf den österreichischen Mitstreiter Menasse beruft, kontert Fischer mit Geschichtsdetails: »Die erste österreichische Republik wurde im Theater proklamiert.« Guérot beruft sich auf die weltgeschichtliche Bedeutung der Worte Schabowskis vor dem Mauerfall. Fischer: »Was ist der Unterschied zwischen Ihnen und Schabowski?« Guérot beleidigt: Es gehe um einen »offensiven Diskurs nach vorne. Sie können mich lächerlich machen, aber ...« Für derlei Standfestigkeit gab es wieder Beifall. Später blieb der Beifall dann doch aus, als sie eine europäische Sozialversicherung für die (nach einem Stichtag) »Danachgeborenen« fordert und Europa auf die Trias »Ein Markt, eine Währung, eine Demokratie« gründen will.
Fischer geht mit Orbán ins Gericht. Zwar verstehe er die die historische Problematik Ungarns seit dem im Kontext von Versailles aufgenötigten Frieden von Trianon. Orbáns Rolle in der EU sei indes destruktiv, er gleiche in seinen autoritären Tendenzen – und in seinem Verhalten gegenüber der Unterdrückermacht Russland – Putin. Man dürfe seiner Kampfansage an die Europäische Kommission nicht nachgeben. Mit Geduld werde man ihn aber zur Einsicht zwingen. Als gegen Ende der Veranstaltung – das Publikum kam mit gerade mal drei Wortmeldungen zum Zuge – der ungarische Botschafter, zunächst ohne Mikrofon schwer verständlich, Widerspruch erhebt, bescheidet ihm Fischer, es sei angesichts des Vorgehens von Orbán gegen Soros »ein starkes Stück«, wenn er Ungarn »zum Opfer machen« wolle.
Bezüglich des Brexit waren sich die Herren auf dem Podium einig: Für Fischer »gibt (es) ein Leben danach«. Auch der Historiker Engels glaubt, der Brexit werde schwächer ausfallen als befürchtet. Zuvor hatte er um Verständnis für die in der Migrationsfrage grundsätzlich ablehnenden Osteuropäer geworben. Er brachte die für die in der West-Ost-Diskrepanz hervortretende, für die ›Krise Europas‹ grundlegende Problematik auf den Begriff: Es handle sich um den Gegensatz von zwei Bildern und entsprechend konträre politische Konzepte. In Westeuropa herrsche ein globalisiertes, von universalistischen Doktrinen geprägtes, kosmopolitisch orientiertes Europabild vor. Letztlich betrachte man das gegenwärtige Europa als eine Art Zwischenstadium zum Weltstaat. Im östlichen Europa halte man aufgrund eigener Geschichtserfahrung an einem traditionellen Europabild fest.
Ein Zuhörer, der die Tradition des christlichen Abendlandes gegen den in der Aufklärung und in der Französischen Revolution proklamierten Menschheitsbegriff für Europa in Erinnerung bringen wollte, traf bei Engels auf Zustimmung – mit einer die »geistige Situation der Zeit« (Karl Jaspers) erhellenden Einschränkung: Der Ruf nach Rückbesinnung auf die christliche Tradition sei vergleichbar dem Versuch des Augustus, die Tradition, die alte römische Religion, wiederzubeleben.