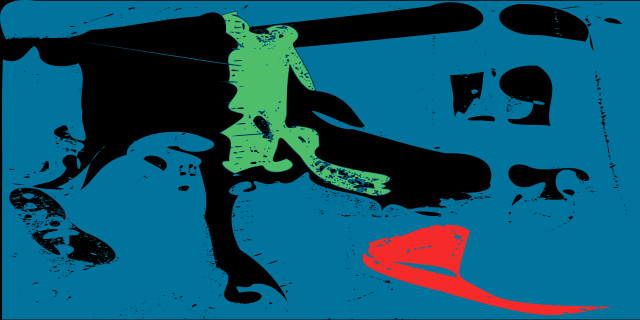von Steffen Dietzsch
Ich möchte Sie hier auf eine Kontroverse innerhalb der deutschen Aufklärung aufmerksam machen, die zeitlich zum Ende dieser geistigen Bewegung in Europa gehört, aber sie bewegt mit ihren Argumenten und mit ihren Paradoxien bis heute unser Selbstverständnis von einer freien Gesellschaft – in ihr soll doch Immanuel Kants Diktum gelten: Auf die Rechte der Menschen kommt es mehr an als auf die Ordnung (und Ruhe). Es läßt sich große Ordnung und Ruhe bey allgemeiner Unterdrückung stiften.
1
Aufklärung, so betont Kant in weltbürgerlicher Absicht, ist nicht bloß – sozusagen ›objektiv‹ – ein wissenschaftliches, sozialreformerisches oder technologisches Problem.
Kant macht mit einer sehr persönlichen Sentenz zunächst darauf aufmerksam, dass Aufklärung vom Grunde her wohl nur funktioniert, wenn mit ihr – eben subjektiv – »ein gewisser Herzensanteil« verbunden werden kann, den – und so sieht Kant uns – wir als Vernunftpersonen »am Guten« zu empfinden in der Lage sind.
Aber gerade das, so Kant, darf nicht nur eine private Inspiration bleiben, sondern »muß nach und nach bis zu den Thronen hinauf gehen und selbst auf ihre Regierungsgrundsätze Einfluß haben.«
Zugleich kritisiert Kant (1784) am zeitgenössischen Regierungshandeln, dass »unsere Weltregierer zu öffentlichen Erziehungsanstalten und überhaupt zu allem, was das Weltbeste betrifft, für jetzt kein Geld übrig haben, weil alles auf den künftigen Krieg schon im Voraus verrechnet ist.«
Hat aber, so fragt Kant das nicht womöglich negative Auswirkungen auf dasjenige, was mit Aufklärung »dereinst einmal zu Stande kommen« sollte? Kant konstatiert hier zum Verlauf seiner Gegenwart durchaus »einen befremdlichen, nicht erwarteten Gang menschlicher Dinge«, – so wie auch sonst im Allgemeinen, dass, wenn man die Geschichte »im Großen betrachtet, darin fast alles paradox ist. Ein größerer Grad bürgerlicher Freiheit scheint der Freiheit des Geistes des Volks vortheilhaft und setzt ihr doch unübersteigliche Schranken.«
Gerade wir heute sind Zeitgenossen und Betroffene solcher Antagonismen. Wir akzeptieren im demokratischen Raum der Polis immer mehr teilnehmende Akteure und Meinungen und bemerken aber zugleich durch sie auch immer wieder drastische Infragestellungen von (eigentlich grundgesetzlich garantierter) Denk-, Meinungs- und Forschungsfreiheit. So erleben wir im gesellschaftlichen Zusammenleben (zumal in Deutschland!) eine inzwischen bis in den Verkehrs- und Schulalltag reichende Widerstands- und Insurrektionspraxis, deren moralische Robustheit ihren sachlich aufklärerischen Mehrwert bei weitem überflügelt. Dieser sogenannte ›zivile Ungehorsam‹ versteht sich seinem Selbstverständnis auch noch absurderweise sogar als ›Enlightenment-in-action‹, bzw. als ›La lumière directe‹. – Aber, so die Einsicht von Zeitgenossen europäischer Revolutionen: so eben wird »in Revolutionen die Menge ihr eigener Tyrann.«
Kant hatte mit seinem tiefen Sinn für Paralogismen und Paradoxien immer einen realistischen Zugang zur Unübersichtlichkeit dynamischer Vorgänge in Natur und Geschichte – zu, mit Goethe gesagt, »des Lebens labyrinthisch irre[m] Lauf.«
Gerade für die Gegenläufigkeit von Absicht und Resultat in Politik & Wissenschaft hatte Kant immer einen ironischen Zungenschlag parat. Er brauchte da keine Belehrung in, wie das später hieß, Dialektik der Aufklärung. Kant versteht das Unabgeschlossene, das Prozesshafte, das Asymmetrische als jedem Leben lege artis inhärent, – geradeso wie Goethe, wenn dieser Wirklichkeit bestimmt als »die ewige Synkrisis und Diakrisis, das Ein- und Ausathmen der Welt, in der wir leben, weben und sind.« Kant sieht hinsichtlich der unterschiedlichen Wege zur Aufklärung auch keinen prinzipiellen Unterschied zwischen verschiedenen Kultur- und Zivilisationslagen der Völker: »Die Rohen Völker waren keine Barbaren; sie […] haben mehr gelindigkeit des Naturells mit Freyheitsgeist verbunden und also mehr Fahigkeit und Willen, nach Gesetzen regiert zu werden, als die Römer.« Kant begriff, dass es entlang der Erdgeschichte nicht nur ganz unterschiedliche Varietäten des Menschen gab, sondern vor allem auch, dass in ihnen allen ein sie verbindendes Allgemeines zu entdecken war. Wie schon der junge Kant schreibt: »daher die Seele eines Menschen in Indien mit der eines anderen in Europa, was die geistige Lage betrifft, oft die nächsten Nachbaren sind.«
2
Gerade innerhalb solcher Problemlagen paradoxer Weltprozesse und solchen Weltverstehens können Kant und wir dieselbe Frage stellen: »Leben wir denn nun jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter?« Unsere Antwort ist die Antwort Kants: »Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung.«
Ein solches war, so Kant, das Zeitalter Friedrichs (des Großen) mit seinen politischen und kognitiven Innovationen, – dem auch wir uns mit unseren demokratischen und digitalen Aufbrüchen als Aufklärungsbemühungen wohl zugesellt fühlen dürfen.
Wie wir Menschen nun, in unterschiedlichen Zeitaltern von Aufklärung, endlich auch selber zu Aufgeklärten werden könnten, dazu gibt uns Kant in seinem Text in der Berlinischen Monatsschrift von (September) 1784 einige Hinweise.
Die Perspektive von Kants Überlegung ist dabei nicht, etwa mit althergebrachten Schulbegriffen im Empirischen unserer alltäglichen Weltverhältnisse auf bislang unerkannt Emanzipatorisches aufmerksam zu machen, sondern er richtet seinen neuen Weltbegriff von Subjektivität ganz auf unser Selberdenken. Hier macht er einige Schwierigkeiten namhaft, die wir Menschen selber zu bewältigen hätten, wenn wir als Aufgeklärte wollten gelten dürfen. Dazu möchte ich drei Aspekte hervorheben.
I. Kant als systemischer Aufklärer
Als systemischer Aufklärer hat Kant ein Problem vor Augen: Er sah den zeitgenössischen Zustand seiner Wissenschaft, der Metaphysik, selber höchst aufklärungs-bedürftig: Wir kennen alle die kräftigen Metaphern, mit denen er diesen Zustand beschreibt – etwa seine Rede vom »bodenlosen Abgrund der Metaphysik«, dass sie »ein finsterer Ocean ohne Ufer und ohne Leuchttürme« sei. Er will, wie er schreibt, den »Scandal des scheinbaren Widerspruchs der Vernunft mit ihr selbst zu heben« versuchen.
Um das zu bereinigen schien ein Umsturz im philosophischen Denken vonnöten, der an Radikalität nur mit der des Copernicus zu vergleichen wäre. So wie Copernicus den Blick über die Erde hinaus in die Tiefe des Raums und der Zeit erweiterte, so hat Kant seinen Blick in die Tiefe unseres Verstandes und der Vernunft erweitert; hin ins Selberdenken als autopoietsches Vermögen. Beide Male wird das Denken befreit vom Zwang zum Absoluten. Vernünftiges Denken verläuft nicht länger unter der Maßgabe des sub specie aeternitatis (also unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit).
Kants transzendental-philosophische Kritik aller Erkenntnis erzeugt eine im Vergleich zur alten universalistischen Metaphysik reduzierte Wissenspraxis. Er kapriziert sich auf die Diesseitigkeit und das Fragmentarische aller wissenswerten Dinge, er konzentriert sich auf das Endliche der Erscheinungen. Seine kritische, Kant sagt auch »skeptische«, Methode versteht er als »Experimentalphilosophie«. Kant wollte damit begreiflich machen, dass Erkennen ein Vorgang des Konstruierens ist, »wodurch man im Stande ist, den Zusammenhang der Dinge mit ihren Gründen [selber herzustellen und damit] deutlich einzusehen.«
Zum Zweiten wollte Kant den Leuten klarmachen, dass es auch nicht-begriffliche, gewissermaßen soziale Gründe im empirischen Denken und im individuellen Verstand gibt, wodurch Denken und Verstand sich selber Schranken setzen im Bemühen, nun das Ganze der Welt, kurzum Alles erkennen zu wollen. Innerhalb dieser – objektiven wie subjektiven – Grenzen, auch um sie zu erkennen, fordert Kant die bedingungslose Freiheit im Denken. Das heißt sich frei zu machen von der Leitung und vom Erkenntnisinteresse anderer, – und wenn das nicht gelänge, operierte der Denkende immer weiter im Status der Unmündigkeit. Diese Unmündigkeit wäre dann allerdings keine bloß moralisch lässliche Sünde, sondern ein selbstverschuldeter Mangel in seiner Urteilskraft.
Auch das ist kein bloß individuelles Problem: Jedes Denken für und in weisungsgebundenen oder weisungsgewohnten Gemeinschaften wird durch ein Unmündigkeitsdefizit geprägt (deren gemeinschaftsstiftende Maxime ist u.a.: Das-musst-du-politisch-sehen).
II. ›Selberdenken‹ vs. Nachreden
Das Aufklärungsbegehren begann in Königsberg mit einem großen Akkord, – nämlich mit der Aufforderung, sich bei allen Belangen von Mensch und Welt künftig im Denken zu orientieren. Der philosophische Grund dafür: Kant interessiert sich weniger für das Esse (das Sein) von Welt, als vielmehr für das Operari (das Handeln, das Tätige) in ihr.
Kant präzisiert dieses Denkgebot: es kann aufklärungstheoretisch nur um eines gehen – nur um Selberdenken! Mut haben zum Selberdenken. Zur Definition des Selber-Denkers gehört, dass er anders denkt, »als man von ihm auf Grund seiner Herkunft, Umgebung, seines Standes und Amtes oder auf Grund der herrschenden Zeitansichten erwartet.«
Mit diesem Selberdenken hängt auch Kants Neubestimmung von Philosophie zusammen, was von Hebbel einmal so erfasst wurde: »Der Kern der Kantischen Philosophie ist: daß wir einen Gegenstand nur in so weit begreifen, als wir ihn in Gedanken vor uns werden zu lassen, ihn im Verstande zu erschaffen vermögen.«
Kant überwindet das Verständnis von Erkenntnis als bloß widerspiegelnde, mimetische Leistung. Er führt unseren Begriff von Erkenntnis hin zu ihrem Verstehen als Konstruktion, als Experiment. Jetzt wird Erkenntnis als Poiesis gedacht. Das bedeutet, das, was als Erkenntnis gelten soll, muss – wie in der Mathematik – als herstellbar, konstruierbar ausgewiesen werden. Es sei soviel Wissenschaft in einer Erkenntnis, soviel Mathematik in ihr sei. Dies mache den Sinn von Selberdenken aus.
Kurz: wie erkennen nur das als ›objektiv‹, was wir – ›subjektiv‹ – aus uns heraus erzeugen. In Kants Worten: wir können nämlich »nur das verstehen und Anderen mittheilen, was wir selbst machen können.« Oder, noch aus seinem Nachlasswerk Opus postumum, wo es heißt: »Daß wir nichts einsehen (erkennen können), als was wir selbst machen können.« Das funktioniert aber nur unter der Grundbedingung: »Wir müssen uns aber selbst vorher machen.« Wie? – In einer »Selbstsetzung«.
Also Selberdenken. Was bedeutet das? Ist nicht jedes Denken Selberdenken? Zumal wenn man z.B. selber viel liest? Es gibt ein Problem dabei, darauf hatten Kantianer der strikten Observanz aufmerksam gemacht: »Lesen ist immer bloß Surrogat des eigenen Denkens. Man läßt dabei seine Gedanken von einem andern am Gängelband führen.« (Schopenhauer, Parerga und Paralipomena II, §260)
Hier wird dem Selberdenken zugemutet, eine Differenz in der Vernunft zu erkennen: es sollte die akkumulierende Potenz im Denken (eben lesen) und die ihr zugrunde liegende performative Dimension zu unterscheiden lernen.
1. Dieser Appell zum Selberdenken kommt natürlich ursprünglich aus der Universitätspraxis: wie wäre das Selberdenken zu erklären? Gerade das hatte eben Kant von seinen Studenten verlangt: – wenn ihr Philosophen werden wollt, dann dürft ihr nicht nur das Wissen der Philosophen gewissermaßen ›auswendig‹ lernen, sondern ihr müsst lernen, wie das Wissen der Philosophen zustande kommt, wie es logisch und sprachlich Gestalt und Form annimmt. Also: die jungen Leute sollen nicht ›bloß‹ »Gedanken, sondern denken lernen«, kurzum, es gelte fortan, nicht zuerst »Philosophie zu lernen«, sondern es komme darauf an »jetzt philosophiren zu lernen.“
Der auf ›Pauken‹ (=Buchstabengelehrsamkeit) dressierte akademische Alltag mit alltäglicher Denkroutine (von Professoren wie Studenten) sollte überwunden werden, – damit aber auch Denkfaulheit und die Bequemlichkeit, sich bloß auf akademische und historische Autoritäten zu berufen. Bei Disputationen sollten fortan eher Begriffe gelten, nicht zuerst Gefühle, nicht vertraute Vorlieben oder gerade aktuelle Meinungen, nicht immer wieder grassierende Sprachmoden und gruppenspezifische Vorurteile.
Genau diese ›Dressur‹ des Geistes sollten Selberdenker künftig vermeiden. Aber wie? – Es bleibt dem Suchenden nur eins, nämlich: »Habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!« Denn »das Selbstgedachte versteht man viel gründlicher als das Erlernte.«
Was hätte man damit aber über das Kognitive hinaus gewonnen? Kant sagt es: man bemerkt und überwindet so seine Unmündigkeit, und zwar eine höchst selbstverschuldete Unmündigkeit. Sie zu überwinden ist für Kant das Entscheidende am Aufgeklärt-sein, – nicht das bloß begriffliche Resultat.
›Selberdenken‹ ist eine vielschichtige ganzheitliche Aktion, Kant begreift sie nahezu als »Selbstthun«. Der Selberdenker operiert mit der performativen Kraft des Wortes (Logos). Der begreift sich als sich-selbst-Bestimmender. ›Selberdenken‹ ist so zu verstehen, wie das viele seiner Schüler in Jena verstanden haben: als Thathandlung.
Diese Freiheit, zu denken, was man will, und zu sagen, was man denkt, wird einem nicht ›von oben‹ gewährt, sondern ist als das eingeborene Recht jedes Menschen zu begreifen und zu pflegen. Es jemanden verwehren »zu sagen, was er denkt« (Euripides), ist seit alters her Signum der Fremdbestimmung, des Untertanen, des Sklaven.
Dieses Selberdenken also erst eröffnet die Perspektive der Aufklärung: »Selbstdenken heißt den obersten Probirstein der Wahrheit in sich selbst (d.i. In seiner eigenen Vernunft) suchen.« Also nur, wenn man sich ›auf-den-Verstand‹ stellt, und nicht nur aufs Gefühl, nicht nur auf eine exzentrische Meinung oder auf das, was-alle-meinen, dann erst wäre eine neue Denk-Kultur des Prüfens, der Skepsis, der Infragstellung und der Wahrheit, also Aufgeklärt-sein möglich.
2. Das Selberdenken ist allerdings nicht zu verstehen als Alleine-Denken; vielmehr verhilft es dem Einzelnen zu einer »allgemeinen Menschenvernunft«, hat also intersubjektivem Anspruch.
Sie (die allgemeine Menschenvernunft) ist – seit Spinoza – zu begreifen »als Teil des unendlichen Verstandes« oder, um es noch einmal mit Goethe zu sagen: »Und was der ganzen Menschheit zugetheilt […], / Will ich in meinem innern Selbst genießen, […] Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern.«
Dieser Bezug auf-sich-selbst, auf den (eigenen) Verstand ist also nicht zu verstehen als ein asozialer, privatistischer Schritt weg aus der Gesellschaft, hin zu persönlichen Mutwillen und Egozentrik. Es ist umgekehrt gerade die zentrale Orientierung eben auf den Verstand ein Schritt hin zu unserem einzigen Vermögen, uns in Natur, Gesellschaft und am Menschen orientieren zu können. Das wird prominent noch in Hegels Rechtsphilosophie verteidigt, wenn vom »Denken als Bewußtsein des Einzelnen in Form der Allgemeinheit« gesagt wird, »daß Ich als allgemeine Person aufgefasst werde, worin Alle identisch sind. Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener usw. ist.«
Im Selberdenken wird also nicht auf etwas Individuell-Empirisches, auf etwas Einzelnes, Begabtes hingewiesen, sondern Kant will uns mit dem Selberdenken das Allgemeine in uns Menschen zu erkennen geben. Dass eben das, was uns alle über das Besondere (in uns) hinaus verbindet, das ist, dass wir Menschen sind.
Zwei große Kant-Verehrer, die seine Zeitgenossen waren, haben diese Leistung Kants, in jeder besonderen Person (und ihrer je verschiedenen sozialen, politischen oder ethnischen Maske) ihr Allgemeines als Mensch zu bemerken, zum Begreifen gebracht. Es sind beide Male wir Deutsche, die im alltäglichen Umgang mit der Allgemeinbestimmung ›Mensch‹ so schwer zurecht kommen:
Zum ersten Hölderlin (ihm war Kant der Moses unserer Nation) als er schrieb: »So kam ich unter die Deutschen. … Barbaren von altersher, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden […] ich kann kein Volk mir denken, das zerrißner wäre, wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker aber keine Menschen, Priester aber keine Menschen, Herrn und Knechte […] aber keine Menschen.«
Und dann bei Goethe (ihm war Kant der vorzüglichste aller Denker) lesen wir: »Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens; Bildet, ihr könnte es, dafür freier zu Menschen euch aus.«
In seinem Alterswerk Streit der Fakultäten bezeichnet Kant dieses Selberdenken ganz prominent als den von verschiedenen Seiten her »verschrieenen Freiheitsgeist der Vernunft.«
Dass wir die Trägheit der Unmündigkeit gar nicht unterschätzen dürfen, war in der geistigen Umwelt Kant durchaus ein Problem. Von Lichtenberg ist in seinem Unversitätsalltag die Wahrnehmung überliefert: »Wenn er seinen Verstand gebrauchen sollte, so war es ihm, als wenn jemand, der beständig seine rechte Hand gebraucht hat, etwas mit der linken tun soll.«
Durch Kants intellektuelle Praxis bemerken wir: Aufklärung ist vorrangig Selbsterziehung und Selbstkritik. Nur wir selber können uns aus einer Unmündigkeit befreien, die ganz und gar nicht natürlich ist, auch wenn sie uns längst sozial zur zweiten Natur geworden sein sollte.
III. Vormundschaft als Gefahr beim Selberdenken
Aber: um das »Joch der Unmündigkeit«, – um, wie Kant sagt, unsere »beinahe zur Natur gewordene[n] Unmündigkeit« wirklich abwerfen zu können, scheint neben der Arbeit an sich selber (eben Mut zu haben, selber zu denken) noch ein weiterer Schritt nötig zu werden. Was damit gemeint sein könnte, darauf verwies einer der Freunde aus Kants Tischgesellschaft. Es war sein alter Hausfreund Johann Georg Hamann, der hier ein neues Stichwort in die Königsberger Diskussion einbrachte.
Hamann verlagert das Problem sozusagen wieder in den ›diskursiven Raum‹. Und er bestimmte dann das, was er »wahre Aufklärung« nennt neu: er sagt, dass sie im »Ausgange des unmündigen Menschen aus einer allerhöchst selbst verschuldeten Vormundschaft bestehe.«
Damit bewegt man sich hier wieder inmitten unserer heutigen alltäglichen Problemzonen, wenn man bemerkt, wie schnell sich Vormundschaften bilden, wieviele allzu bereit sind, sich mit anderen zu diskursfreien Netzwerken zusammenzuschließen. In der Sprache von heute heißt das: Alles ›Private‹ – also ein naturwüchsig Individuelles – sei eben sofort ›Politisch‹, und das wohl in dem Maße, dass man Anderen nachzufolgen sucht, sich in deren Diskurse einfügt und deren neue Zusammenhänge mitträgt, – sich also deren Dominanz als Vormundschaftlichkeit zu eigen macht.
Der intellektuelle Anspruch auf Denkfreiheit, um die man sich als selbstbestimmter Einzelner gefällig immer zu kümmern hat, ist für Hamann natürlich aller Ehren wert; da ist er mit Kant d’accord. Aber Hamann bleibt gegenüber dem vielfach fremdbestimmenden Alltag skeptisch, – auch seinerzeit, gerade auch gegenüber modernen Obrigkeiten, denn: Was hilft mir daheim, zu Hause, das [offiziell verbürgte] »Feyerkleid der Freyheit, wenn ich beruflich [d.i. auf der Bühne, Katheder, Redaktion oder Kanzel alltäglich von Vormundschaft geschurigelt] im Sklavenkittel sitze?« Eine solche Klage ist leider auch heute immer noch hoch aktuell: Der Soziologe Heinz Bude hat neulich auf eine herrschaftstechnisch bemerkenswerte neue Terminologie aufmerksam gemacht, als er bekannt machte, dass man in hohen ministeriellen Kreisen unseres Landes überlegt habe, wie man aufseiten der Bevölkerung ›Folgebereitschaft‹, also Gehorsam erzeugen könne.
Schon der Königsberger Aufklärungsdisput im Hause Kant kalkuliert also eine Wahlverwandtschaft von Unmündigkeit und Vormundschaft ein.
Kant versucht seine Unmündigkeits-These mit der Hamanns zu verbinden. Er macht drei Modalitäten im Geflecht von Unmündigkeit und Vormundschaft namhaft:
• »Unmündigkeit unter Vormundschaft der Gelehrten
• Unmündigkeit unter Vormundschaft der Regenten
• Unmündigkeit unter Vormundschaft des Geschlechts.«
Wenn Vormundschaft und Unmündigkeit in der allgemeinen Kultur einer Gesellschaft sich Platz schaffen sollten, dann würde bald das Selberdenken unter Verdacht der Unvernunft und Verantwortungslosigkeit kommen.
Kant sieht aber eine Möglichkeit, aus dieser Verschlingung von Unmündigkeit und Vormundschaft herauszukommen. Und in der Demontage dieser doppelten Verschränkung des Massenbewusstseins – das Unmündige als Vormund – sieht auch Hamann den Ansatz für eine wirklich aufklärerische Initiative: »Denn hier liegt eben der Knoten der ganzen politischen Aufgabe.« Also: wie könnte man die Vormundschaft loswerden?
Kant zeigt einen Weg: Damit ist verbunden, dass man sich zunächst vom sozusagen absoluten Vormund befreien muss. Kant skizziert ihn als einen, der noch sagen konnte und durfte, »was ein Freistaat [=Republik] nicht wagen darf: (nämlich) räsonnirt, so viel ihr wollt, und worüber ihr wollt; nur gehorcht.« Im Freistaat (in der Republik) schweigt dieser Vormund. – Statt Vormundschaft hofft Kant auf alltägliche Dispute, Verhandlungen, auch auf Streit zwischen Fraktionen und Fakultäten.
Die große geistige wie institutionelle Hoffnung Kants für die Polis war es dabei, die Universität in republikanischer Form neu zu organisieren, mit der damit neu verbundenen Freistellung der Philosophischen Fakultät als autonomer Kritikerin, derzufolge sie »in Ansehung ihrer Lehren vom Befehle der Regierung unabhängig, keine Befehle zu geben, aber doch alle zu beurtheilen die Freiheit habe.«
Damit würde sich, so hofft Kant, in der Gesellschaft der »Hang und Beruf zum freien Denken« befeuern lassen und es käme allmählich dazu, »den Menschen, der nun mehr als Maschine ist, seiner Würde gemäß zu behandeln.« (Damit endet Kants Aufklärungsessay …)
Unser Fazit:
Wir wissen: Mit dem Verschwinden des absoluten Vormunds verschwindet das Institut der Vormundschaft nicht schon. Es demokratisiert sich sozusagen – und Vormundschaft wird divers. Die obrigkeitliche Vormundschaft verliert ihre Macht, sie verwandelt sich, sie wird nachbarschaftlich und kollegial. Gerade dieser Umstand zeigt an, wie nötig Aufklärung immer bleiben wird. Gegen sie werden immer wieder Vorwürfe, Einsprüche und auch Spott zu erwarten sein. Zumal sie politischen Gemengelagen häufig als Donquichotterie erscheint …