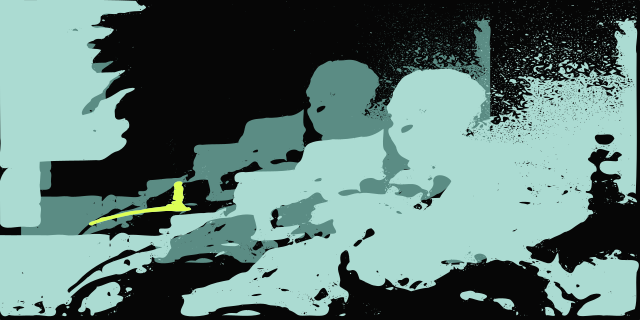von Henning Eichberg
Über die neue nationale Frage
Menschen begegnen einander in diesen Tagen auf eine neue und bisweilen dramatische Weise. Die Migrationsbewegungen geben zu neuen Fragen Anlass – die nicht zuletzt alte Fragen an uns selbst sind.
Die beiden Bilder gingen vor einigen Monaten um die Welt. Ein dänischer Polizist auf einer Autobahn, auf der Flüchtlinge ins Land strömen. Und ein Mädchen aus dem Flüchtlingstreck. Die beiden spielen miteinander. Dänemark zeigte in der Begegnung ein freundliches Gesicht.
Es mag sein, dass es sich hier um eine Ausnahme handelte. Jedenfalls ist Dänemark – trotz Wohlfahrtsstaat und Hans Christian Andersens Märchen – keineswegs eine Idylle in der neuen Welt der Migrationsprozesse. Auch unter dänischen Arbeitern und Kleinbürgern grassiert die Angst vor den Fremden...
Aber die Situation wird sichtbar, in die wir hier gestellt sind: Menschen begegnen einander. Und mit ihnen treffen kulturelle Praktiken auf einander, Völker – und dies auf eine neue Weise, ob auf dänischem Grund oder auf deutschen Grund. Wer sind wir – und wer seid Ihr?
Rechte Antworten
Anstelle der Fragen, hören wir in der Regel Antworten. Von der politischen Rechten her, heisst es: Abschotten! Das heißt: Grenzen hochziehen. Ungarns Viktor Orban lieferte das Modell dafür, mit Stacheldraht an der Grenze nach Serbien. Andere Länder folgten dem Beispiel. Als ob man Völkerwanderungen mit altmodischen Grenzbefestigungen verhindern könne. Auch ›Transitzonen‹ und ›Hotspots‹ wurden erfunden, weil umzäunte ›Lager‹ keinen guten Klang haben.
Und, so eine andere Antwort: Man muss Obergrenzen festlegen! Dabei geht es um Zahlen – solche, die zulässig, und solche, die unzulässig sind. Menschen werden zu Zahlen.
Diese Antworten erhalten ihre Dynamik vor dem Hintergrund von Volksbewegungen, die ernster zu nehmen sind. Denn sie sind von Angst getrieben sind. Menschen sammeln sich, die sich alleingelassen fühlen, die sich in ihrer Identität bedroht fühlen und Angst haben: Wer sind wir denn überhaupt noch?
Was aber bedroht ›uns‹? Dazu hat man von rechter Seite die ›Islamisierung des Abendlandes‹ erfunden. Auf die Identitätsfrage der Völker wird also eine ›religiöse‹ Antwort gegeben, und sie wird zum Religionskonflikt umgedeutet.
Tiefer ging der Gefühlsausbruch von Botho Strauss (Spiegel 41/2015). Angesichts der ›Flutung des Landes mit Fremden‹ fragte er: Was steht dem gegenüber? ›Massen und Medien‹ – ›Mediasten, Netzwerker, Begeisterte des Selbst‹. Da bleibe nur der Weg, sich alternativ zu beheimaten, in der ›Überlieferung‹, im ›geheimen Deutschland‹ der Dichter und Denker, wie es uns Deutschen seit der Romantik ein Zuhause biete. Der Kampf gehe nun ›nach innen um das Unsere‹. Aber letztlich sei doch alles vergeblich. Es bleibt die Klage des Schriftstellers: Er sei ›nur bei den Ahnen noch unter Deutschen‹ – er sei ›der letzte Deutsche‹.
Bürgerlich-liberale Antworten
Der Spiegel hatte den Strauss-Essay lanciert, um mit Strauss' Provokation zugleich das Geschäft zu beleben – und dann seine eigene bürgerlich-liberale Pointe darauf zu setzen. Ein Spiegel-Journalist antwortete Botho Strauss unter der Überschrift: Nie war dieses Land besser als heute. ›Und zwar in allen Bereichen‹. Die Antwort brachte also das Kunststück fertig, Botho Strauss' rechte Klage geradezu als linke Kritische Schule erscheinen zu lassen: Da ist kein Problem in diesem Land! ›Deutschland ist mehr als erfolgreich, mehr als lebenswert.‹ Allerdings: wer ist ›dieses Land‹, wer ist dieses ›Deutschland‹? Diese Frage sollte nicht gestellt werden.
In der Praxis läuft der bürgerliche Liberalismus darauf hinaus, die Völkerwanderung auf ›Individuen‹ zu reduzieren. Wir hier sind Individuen, und es kommen andere Individuen, mehr ist da nicht. Es geht um Essen, Trinken, Kleidung und Unterkunft für den einzelnen. Womit die bürgerliche Mitte allerdings genau bei jenen Zahlen landete, die auch die Rechte umtreiben, und die es zu deckeln gelte.
Allerdings ist da auch eine Eigenschaft zu bedenken, die das ›Individuum‹ gesellschaftlich auszeichne: Das Individuum ist Produzent und Konsument. Darum hörte man aus der bürgerlichen Mitte auch wohlgefällige und zufriedene Berechnungen: Die eingewanderten einzelnen bereichern uns doch unseren Arbeitsmarkt. Einwanderung ist ein Gewinn in der Bilanz der globalen Konkurrenzgesellschaft. Allerdings: ›Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kamen Menschen‹, beobachtete Max Frisch bereits 1965 kritisch angesichts der damaligen ›Gastarbeiter‹-Problematik. Es kamen und es kommen Menschen mit ihrer Identität – dafür hatte die marktverliebte bürgerliche Mitte keinen Blick. Die Identitätsvergessenheit blieb, und sie erneuerte sich nun.
Dass Deutsche sich jetzt mit Gesten der persönlichen Betroffenheit jenen anderen, flüchtenden Menschen zuwandten, das war allerdings die gute Überraschung des Sommers 2015. In der deutschen Zivilgesellschaft geschah etwas Neues und Eindrucksvolles. Aber die bürgerliche Politik nahm das zum Anlass, privat-humanitäre Diskurse über das breite, volkliche Engagement des Willkommens zu legen. Die Herausforderung, die anderen als Andere willkommen zu heißen, wurde verdrängt und zu einer Sache individueller Moral umgedichtet.
Das fügte sich ein in die bürgerliche Staatsideologie, die schon im alten Westdeutschland – wohl anders als in der DDR? – die nationale Identität für überholt erklärt hatte. Habermas hatte das Ende nationaler Identität schon 1974 postuliert, und in der Folgezeit mobilisierten westdeutsche Soziologen den Demos-Begriff gegen den Ethnos, die ›Bevölkerung‹ gegen das ›Volk‹. Wer von einer offenen nationalen Frage, von deutschem Volk und deutscher Identität sprach, wurde damals ein Fall für den Verfassungsschutz. Dann fiel 1989 die Mauer in Berlin, und die Rufe ›Wir sind das Volk!‹ und ›Wir sind ein Volk!‹ erwiesen materielle Kraft. Damit wäre eine Selbstkritik angesagt gewesen. Dennoch wurde die bürgerlich-individualistische Besserwisserei in den siegreichen groß-westdeutschen Staat überführt.
In der politischen Praxis geht es der bürgerlichen Individualisierung nun angesichts der Einwanderung, wie gesagt, ebenfalls vor allem um Zahlen und um Quoten. Wie viele können wir beherbergen, und wie sind sie zu verteilen. Im Namen der Quoten appelliert man an ein Europa, von dem sich allerdings plötzlich herausstellt, dass es das nicht gibt.
Das Phantom des bürgerlichen Europa stellt zugleich vor eine Identitätsfrage: Sollen die anderen denn Europäer werden, und müssen wir ihnen das zumuten? Man erörtert ›europäische Werte‹, die der Einwanderung zur Bedingung und zur Grundlage von Staatsbürgerschaftprüfungen und Gesinnungstests gemacht werden sollen. Das Gerede von der ›europäischen Lösung‹ schiebt auf gut bürgerliche Weise die Verantwortung weg von uns – von uns Deutschen, uns Dänen…
Linke Antworten?
Linke und Sozialisten sind durch die neuen Wanderungsbewegungen auf eine andere Weise herausgefordert. Gibt es einen dritten Weg jenseits der rechten Abschottung einerseits und des bürgerlichen Individualismus (im Zusammenhang des marktorientierten Produktivismus) andererseits?
Wenn das Grundprinzip der Linken und des Sozialismus die Solidarität ist, so stellt sich die Frage: Solidarität mit wem? Ja, Solidarität mit den Vertriebenen. Aber gilt es nicht auch solidarisch zu sein mit den Menschen, die Angst haben?
Insofern sind die Anti-Pegida-Demonstrationen zwar gut gemeint, aber sie sind auch ein Problem. ›Nie wieder Deutschland!‹ – und wer wenn nicht Deutschland soll willkommen sagen? ›Wir sind bunt!‹ – aber welcher Syrer oder Afghane, der auf Hilfe von Deutschen hofft, will den ›Bunten‹ vertrauen? Auf jeden Fall kann demonstratives Geschrei nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch für die Linke hier ein Neudenken gefordert ist.
Integration, Inklusion als Identitätsbegegnung, setzt eine Klärung voraus: Wer sind wir selbst? Zu wem kommt ihr hier, und was haben wir euch anzubieten? Willkommenskultur enthält also Elemente eines Willkommensnationalismus: Ja, die nationale Frage bedeutet etwas! Und das Nationale ist dabei gerade nicht die rechthaberische Selbstbehauptung und Abschottung, sondern die Frage nach dem Volk: Wer sind wir, und wer wollen wir sein? Und wer wollt ihr sein, hier bei uns?
Und Fragen...
Die nationale Frage ist also wirklich eine Frage. Was könnt ihr hier bei uns finden, das ihr an anderem Ort nicht findet?
Von hier aus ergibt sich auch ein selbstkritischer Rückblick auf die ›deutsche Frage‹ der Nachkriegszeit. Die nationale Frage wurde zwischen 1945 und 1989 als das Problem der deutschen Einheit verstanden, auch auf der Linken. Einheit und Selbstbestimmung, das hing zusammen. 1989 zeigte sich allerdings, dass staatliche Einheit und Selbstbestimmung auch auseinanderfallen konnten. Die staatliche Einheit kam – aber wie steht es mit der deutschen Selbstbestimmung unter den Bedingungen der kapitalistischen Globalisierung?
Andeutungsweise hatte sich bereits in den 1970er Jahren der Verdacht erhoben, die nationale Frage habe weniger mit nationalen Interessen und staatlichen Grenzen zu tun als mit volklicher Identität: Wer sind wir selbst eigentlich? Allerdings habe auch ich damals die volle Tragweite der Frage nicht erkannt.
Nun aber stellt sich die Frage neu und unüberhörbar. Und zwar als Frage, nicht als Antwort. Das Paradox scheint zu sein, dass wir nur mit einem kulturellen Begegnungsnationalismus jenen anderen, die bei uns leben wollen, näherkommen können. Und dass wir nur damit dem Angstnationalismus der deutschen ›Mühseligen und Beladenen‹ inhaltlich und substantiell entgegenwirken können, ohne sie niederzuschreien.
Friedrich Nietzsche stellte einmal fest: Es kennzeichne die Deutschen, dass bei ihnen die Frage ›Was ist deutsch?‹ niemals ausstürbe. Das wird oft kritisch zitiert, als eine Abweisung jener wunderlichen Frage. Aber sollte diese Frage vielleicht nicht nur eine Belastung, sondern in der gegenwärtigen Herausforderung geradezu die Chance sein?
Das alles ist keineswegs nur eine Frage luftiger Philosophie. Es wird konkret in der Begegnung, insofern diese über die Deckung basaler Grundbedürfnisse hinausgeht (und auch die sind kulturell). Das offenbart sich – gewissermassen ›materiell‹ – nicht zuletzt in der sprachlichen Begegnung. Wir wollen und müssen einander sprachlich verstehen. Sprache lernen wir aber am besten durch Singen, insbesondere durch Gemeinschaftsgesang. So geschieht es zum Beispiel in Dänemark. http://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/faellessang-skaber-faellesskab-blandt-flygtninge
Das bedeutet nicht, dass sich die Probleme des Kulturzusammenstosses wegsingen ließen. Aber in der Begegnung wird die Frage konkret an uns zurückgegeben: Wer sind wir? Und welche unserer Lieder wollen wir in Deutschland gemeinsam mit jenen singen, die aus Syrien oder Libyen zu uns flüchten? Auf dass auch wir ihre Lieder kennen und singen und lieben lernen?