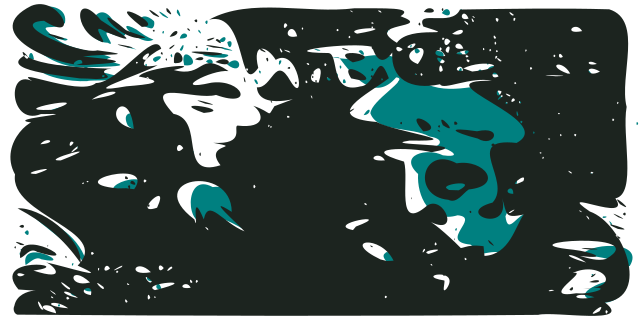von Christoph Jünke
Im Frühling 1966 besuchte eine kleine Gruppe von SDS-Aktivisten, allen voran der spätere ›Rädelsführer‹ der APO-Revolte, Rudi Dutschke, die ungarische Hauptstadt Budapest, um sich mit dem in die Jahre gekommenen marxistischen Philosophen Georg Lukács politisch-intellektuell auszutauschen. Der radikale Berliner Student Dutschke hatte sich schon seit längerem mit dem schillernden Ungarn auseinandergesetzt und plante, ihn zum Thema seiner Doktorarbeit zu machen. Besonders interessiert zeigten sich Dutschke und GenossInnen an jenem jungen Lukács, der zu Beginn der 1920er Jahre, in Zeiten der Aktualität der Weltrevolution, die so genannte Offensivtheorie der internationalen Linken, den sofortigen und bündnispolitisch kompromisslosen Übergang zur revolutionären Aktion, theoretisch zu verallgemeinern suchte. Das Gespräch zwischen den Generationen verlief jedoch nicht ganz so, wie es sich mindestens die jungen SDSler erhofften. Lukács scheint sich von ihrem revolutionären Elan reichlich unbeeindruckt gezeigt zu haben.
Georg Lukács: Autobiografische Texte und Gespräche (Werke Band 18, hrsg. von Frank Benseler und Werner Jung), Bielefeld (Aisthesis-Verlag) 2005, 520 Seiten
Das Warum ist in den ein halbes Jahr später stattgefundenen und sowohl per Radio wie Buch verbreiteten und international bekannt gewordenen Gesprächen mit Georg Lukács (rororo 1967) dokumentiert. Mit Bestimmtheit wendet sich Lukács hier – im Zeitalter von chinesischer Kulturrevolution und lateinamerikanischem Guerillakampf – gegen die »chinesischen Verführungen«, gegen die Jungen, die als Partisanen nach Südamerika gehen und hält dies ebenso wie die damals so genannte Sexwelle vor allem für eine Art der Maschinenstürmerei. Er wolle dem zwar eine gewisse Berechtigung nicht absprechen – in den Kämpfen um die Befreiung der Sexualität werde beispielsweise die Erkämpfung der Unabhängigkeit der Frau erkennbar –, halte es jedoch letztlich für problematisch, denn wir müssten uns im Klaren sein, »dass wir heute in der Erweckung des subjektiven Faktors nicht die zwanziger Jahre erneuern und fortsetzen können, sondern dass wir auf der Grundlage eines neuen Anfangs mit allen Erfahrungen zu beginnen haben, die wir aus der bisherigen Arbeiterbewegung und aus dem Marxismus haben. Wir müssen uns klar darüber sein, dass wir es mit einem Neuanfang zu tun haben, oder – wenn ich eine Analogie gebrauchen würde – dass wir jetzt nicht in den zwanziger Jahren des 20.Jahrhunderts stehen, sondern in einem bestimmten Sinn am Anfang des 19.Jahrhunderts.«
Was damals die Entfremdung der Generationen fast zwangsläufig vertiefte, liest sich vierzig Jahre später anders. Die Aktualität der Revolution, von der ein Rudi Dutschke stellvertretend für die meisten anderen seiner Generation damals ausging, hat sich als ›überschießendes Bewusstsein‹ erwiesen, als heroische Illusion eines weltgeschichtlichen Aufbruchs, die sich bereits zehn Jahre später ernüchtert wusste.
Heute offenbart sich dagegen die tiefe Weisheit des alten Lukács, deren strategische Konsequenzen er selbst zu jener Zeit aber erst zu ziehen begann. Im Widerspruch zu seiner in den zitierten Passagen zu Tage tretenden Erkenntnis, dass die großen Wege der organisierten Arbeiterbewegung im 20.Jahrhundert in eine weit reichende Sackgasse geführt hatten, hielt nämlich Lukács realiter an einer dieser Strömungen auch weiterhin fest. Er hatte sich seit den fünfziger Jahren zwar zunehmend in individueller Opposition zur politischen Realität jenes real existierenden Sozialismus befunden, von dem Dutschke sagte, dass dort alles real sei, nur nicht der Sozialismus. Doch trotz der ihn betreffenden politischen und intellektuellen Ausgrenzung und Repression innerhalb Ungarns und innerhalb der (welt-)kommunistischen Bewegung war nach außen an Lukács' prinzipieller Loyalität zu den Grundlagen bürokratischer Herrschaft noch immer nicht zu rütteln.
In dieser kleinen Episode spiegelt sich nicht nur der komplizierte und heute nur noch bedingt nach Gut und Böse, Richtig und Falsch zu trennende Generationenkampf der sechziger und siebziger Jahre. Hier spiegeln sich auch die spezifischen Widersprüche eines Georg Lukács, die ihn zu einem der am schwierigsten zu fassenden Denker des 20.Jahrhunderts machen. Keiner dieser Denker dürfte in ihrer biografischen und politisch-intellektuellen Entwicklung eine solche Reihe von Wandlungen durchgemacht haben: vom jugendlichen Ästhetiker und Avantgardisten zum rätekommunistischen Volkskommissar, vom linksradikalen Verfasser von Geschichte und Klassenbewusstsein zum Vertreter der ›rechten‹ Blum-Thesen, vom illegalen Kämpfer gegen den aufziehenden Faschisten zum Apologeten des aufziehenden Stalinismus, vom zurückgezogen lebenden Literaturwissenschaftler und Philosophen zum Propagandisten der sowjetischen Außenpolitik, vom in der UdSSR inhaftierten ›Volksfeind‹ zum gefeierten Repräsentanten des ungarischen Weges zum Sozialismus, vom antistalinistischen Erneuerer von 1956 zum Philosophen einer Ontologie des gesellschaftlichen Seins in den Sechzigern. Und gleichzeitig formulierte derselbe Lukács, der alte, in seinen autobiografischen Gesprächen Gelebtes Denken von 1970/71 zurückblickende Lukács, dass er glaube, dass es in seiner Entwicklung »keine anorganischen Elemente« gebe.
Am nächsten, so scheint mir, kommt man der bislang noch wenig thematisierten Einheit der Lukácsschen Widersprüche durch seine späten autobiografischen Gespräche. Nicht alle, aber der große Teil derselben, vor allem auch Gelebtes Denken und die Gespräche mit Lukács, sind nun wieder aufgelegt worden, im Band 18 der von Frank Benseler federführend organisierten Werkausgabe. Verdeutlichen die Gespräche mehr den Sozialphilosophen und seine politische Sicht auf die Welt der 1960er Jahre (und sind insofern etwas unpassend in dem der Biografie gewidmeten Werkband), so finden sich in Gelebtes Denken nicht nur eine Reihe bemerkenswert offener Selbsteinschätzungen.
Nachvollziehbar wird hier vor allem, wie dieser philosophisch und ästhetisch sich zumeist auf Themen der Geschichte stürzende Lukács damit ganz und gar auf seine (geschichtlich gewordene) Gegenwart zielte: Hegel ist bei ihm nicht immer Hegel, Trotzki selten Trotzki, und wenn Lukács in den dreißiger Jahren Brecht angriff, dann hatte dies eben weniger mit Brecht selbst zu tun, den er offenbar sehr schätzte, sondern mehr mit jenen, für die der ebenfalls nicht widerspruchslose Brecht auch stand.
Erst eine konsequente Historisierung des Lukácsschen Lebens und Werkes kann hier die notwendigen Voraussetzungen liefern, um seine Aktualität zu bestimmen – und natürlich, wie Rudi Dutschke in einem Brief an Lukács bemerkt, die »richtige Aufhebung der revolutionären Bewegungen der Vergangenheit«. Heute sollten diese Aufhebungen einfacher anzugehen sein, denn über vieles, was damals noch nicht ausgemacht, historisch offen gewesen ist, hat ›die Geschichte‹ mittlerweile geurteilt. Lukács' geschichtsphilosophisch verankerte Hoffnung auf eine Selbstreformation des arbeiterbürokratischen Sozialismus beispielsweise hat sich als falsch und für die politische Linke fatal erwiesen.
Auf der anderen Seite erscheint gerade sein so hitzig geführter Kampf gegen den modernen Avantgardismus heute in günstigerem Licht. Als ›Kraft der Negation‹ tendiert letzterer in der Tat zum Steckenbleiben in jenem Negativismus, der nicht selten mit einem zynischen Zuckerguss gekrönt wird. Der nonkonformistische Konformismus wesentlicher Teile des Avantgardismus kann heute allenfalls noch seiner Reichweite, nicht aber seinem Gehalt nach bestritten werden. Der Provokateur, dieses Sinnbild des Avantgardisten, hat in postmodern-neoliberalen Zeiten seine Subversivität nicht nur weitgehend eingebüßt, er ist sogar zu einem ihrer tragenden kulturpolitischen Handlanger mutiert. Entsprechend provokativ und treffend erscheint noch heute die von Fredric Jameson bereits Ende der siebziger Jahre gemachte Aussage, dass es gerade dann, »wenn der Modernismus und seine ihn begleitenden Verfremdungstechniken zum dominanten Stil geworden sind, mit welchem der Konsument mit dem Kapitalismus versöhnt wird«, des Realismus als solchem bedürfe, damit die gewohnheitsmäßigen Verfremdungen ihrerseits verfremdet und korrigiert werden.
Gekürzt auch in: Junge Welt, 15.2.2006 (Literaturbeilage).