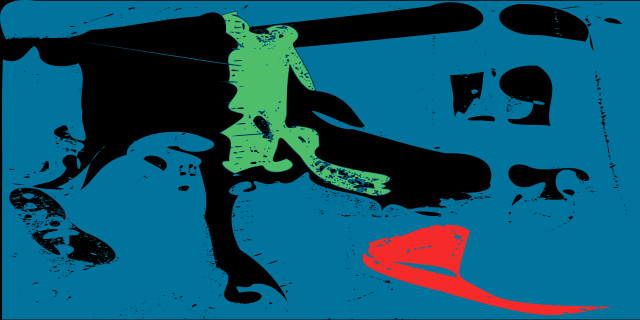von Christoph Jünke
I.
»Fondue ist kein Gericht, es ist eine Religion. Man isst es nicht, es wird zelebriert. Die Delikatesse einer bäurisch-germanischen Käse-Kultur, raffiniert durch den Geist romanischen Weins, das ist Fondue.« Mit diesen Worten beginnt mein Lieblingsaufsatz von Jakob Moneta, ein Essay, der Schweizer Erfahrungen mit dem Unbehagen in der Sattheit behandelt, und vor ziemlich genau sechzig Jahren, im Jahre 1952, in einer kleinen linksrepublikanischen und sozialistischen Zeitschrift namens Aufklärung erschienen ist.
Moneta verarbeitet in ihm die Erfahrungen und Erkenntnisse, die er 1952, bei einem einjährigen Erholungsurlaub in der Schweiz, gesammelt hat. Und er beginnt den Essay, indem er zunächst detailliert den Ablauf eines typischen Schweizer Fondue-Essens beschreibt und darüber philosophiert, dass ja den Deutschen das Essen noch mehr ein Bedürfnis des Magens sei, während die Franzosen längst wüssten, »dass ein Mahl auch Gebilde des Geistes ist«. Moneta preist das Nationalgericht der Schweizer als eine gelungene Symbiose von Deutschem und Französischem, denn das Fondue vereinige beides: »die solide Käse-Unterlage für den Magen und den Geist romanischen Weines«. Er gibt sich idealistisch und erzählt, dass er damals dachte, dass so wohl auch der Schweizer an sich aussähe, wie eine »Mischung, nein Verschmelzung des Edelsten, das die beiden großen europäischen Nationen zu geben haben«. Doch mit Erstaunen habe er vor Ort, in der Schweiz, feststellen müssen, dass ein solcher Schweizer eine Legende sei, dass es die Schweizer als solche eigentlich gar nicht gebe. Es gebe nur Deutsche, Franzosen und Italiener, die zufällig in der Schweiz leben, stellt er fest und fragt sich dann verwundert, warum sich diese Nationalitäten im damaligen Musterland des europäischen Liberalismus nicht verschmelzen würden? In der damaligen Schweiz lägen doch alle Gaben der modernen Zivilisation in Reichweite fast aller Menschen. Aber warum, fragt Moneta, »sind die Deutschen, Franzosen und Italiener keine Schweizer geworden? Warum wird aus dem Selbstbestimmungsrecht der Kantone eine engherzige Kirchturmpolitik? Warum belügen, bestehlen, betrügen, morden Menschen, denen es gut geht, einander? Warum gibt es so viele Ehescheidungen und Sexualverbrechen? Warum ertränken sich so viele im Alkohol, die keine Sorgen haben? Warum begehen Menschen Selbstmord, ohne dass man sie daran hindert? Warum sind die Millionäre trotz Geld nicht glücklich? Warum gibt es nur einsame Menschen und keine Gesellschaft, auch in der Schweiz? (…) Warum sind die Menschen so leer, so ausgebrannt, warum schafft Sorgenfreiheit kein Glück? Gehört mehr als Sattheit dazu, glücklich zu sein?«
Der Aufsatz nimmt hier also seinen Weg vom Fondue-Essen zu den großen Fragen des Lebens – und die meisten anderen Autoren, die in kurzen, gedrängten Texten einen solch großen Bogen ziehen, setzen sich damit in der Regel einem amüsierten Kopfschütteln aus. Nicht so Moneta, der diesen Bogen sogar noch weiter spannt, indem er ausführlicher auf einen Antwortversuch auf seine vielen Fragen eingeht, der nicht von links kommt, sondern von zwei deutschen Vordenkern jenes ökonomischen Neo-Liberalismus, der in seiner damaligen westdeutschen Variante Ordo-Liberalismus genannt wurde. Moneta referiert hier nämlich Wilhelm Röpkes Ansichten, der sich wiederum auf den damals gerade gestorbenen Walter Eucken beruft – beide gelten heute als Väter unserer Sozialen Marktwirtschaft, waren damals aber noch eher als intellektuelle Außenseiter einzuordnen.
Röpkes Antwort auf die von Moneta aufgeworfenen großen Fragen ist die radikale Absage an jede Form eines praktischen oder theoretischen Kollektivismus – und der Begriff des Kollektivismus war damals noch die gängige Chiffre für das, was wir heute eher Gemeinsinn oder Gemeinschaftlichkeit nennen würden, eine Chiffre für den Wert kollektiver, gesellschaftlicher Solidarität. Der Anspruch des Kollektivismus führe immer in den Totalitarismus, so Röpke in kritischer Auseinandersetzung mit dem in jener Zeit noch in voller Blüte stehenden real existierenden Sozialismus, und das gesellschaftliche Gesamtinteresse sei auch erkenntnistheoretisch gar nicht zu haben. Der kollektivistische, d.h. der planwirtschaftliche, der Zentralverwaltungs-Weg behindere und unterdrücke den Selbstbehauptungstrieb und die Eigenverantwortung der Individuen. Die kapitalistische Wettbewerbsordnung sei deswegen der einzige Ordnungstyp, der die Kräfte des Egoismus in einer Form zu bändigen wisse, die deren vitalen Impulsen nicht Gewalt antue. Erst durch den Kampf aller gegen alle entstehe für Röpke der allgemeine Frieden, und Moneta antwortet ihm polemisch: »Welch tröstliche Aussicht für den Menschen! Welch erhabene Moral! Entwickelt nur euren Eigennutz, fördert ihn, hegt und pflegt ihn, denn er ist die Antriebskraft unserer Wirtschaft. Was ist schon die Seele des Menschen, dass man ihrer groß achte, – die Wirtschaft, die Wirtschaft, das ist entscheidend. Sie braucht eine Antriebskraft, einen Motor, und das ist dein Eigennutz. Lasse deinem Selbstbehauptungstrieb freien Lauf! Kämpfe gegen deinen Nächsten und nie gegen dich selbst! Das ist die Losung, das ist die Moral.« [Zur gleichen Zeit, als er an diesem Essay arbeitete, arbeitete Moneta an seinem 1953 erschienenen Kommentar zum Kurzen Lehrgang der Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki). Aufstieg und Niedergang des Stalinismus, der gerade dies versuchte, und mit dem Untertitel als neuem Haupttitel 1976 in Frankfurt/M. neu aufgelegt wurde.]
Dass der Anspruch auf Kollektivismus scheitern müsse, wo, wie im Realsozialismus, eine unbeschränkt herrschende Führerschicht das Gesamtinteresse nur als Maske ihres eigenen Machterhaltungsinteresses benutzt – darin gibt Moneta Röpke sogar explizit Recht: »Wahr, nur zu wahr«, schreibt er: »Siehe das Sowjetsystem, wer Augen hat zu sehen!“ Doch anders als Röpke beharrt er darauf, dass man dieser die Macht usurpierenden Führungsschicht die Maske vom Kopf reißen könne. Und er hinterfragt Röpkes Alternative, dass das Glück des Ganzen einzig aus dem Glück des Einzelnen entstehe. Darauf warte man nämlich schon lange vergeblich: »Auch dort, wo jeder sein Glück machen konnte, ist jeder unglücklich geblieben, und ein Glück des Ganzen konnte schon darum nicht entstehen, weil es dieses Ganze nicht gibt.«
Für Moneta stellt sich die liberale Gesellschaft stattdessen dar wie eine von wilden Tieren bevölkerte Wüste, in der sich die Individuen mit Alkohol zugrunde richten, sich durch Sport brutalisieren und durch Reklame verdummen lassen. »Die Sattheit erzeugt nicht automatisch das Glück, weil sie nicht automatisch einen neuen Menschen gebiert«, schreibt er, und eine, so wörtlich: »Sünde wider den Menschen« sei es deswegen nicht nur, wenn man dem Menschen kein Brot gebe, sondern auch, wenn man ihm nur Brot gebe und sich dann selbst überlasse. Denn: »Verbrecher werden nicht geboren, sie werden gemacht. Ehescheidungen als Massenerscheinung sind Zeichen mangelnder Stabilität der Partner. Aber wer hat sie aus dem Gleichgewicht geworfen? Dass Franzosen und Deutsche nicht verschmelzen, liegt nicht an ihrem ewigen und unabänderlichen nationalen Charakter, sondern daran, dass beide nicht menschlich wurden. Alkoholiker sind leere oder ausgebrannte Menschen, aber warum war niemand und nichts da, um diese Leere auszufüllen, und warum wurde der Brand nicht rechtzeitig gelöscht? Zu warten, bis der Mensch sich schuldig macht, um hinterher über ihn zu Gericht sitzen zu können, heißt, sich mitschuldig machen. Es nutzt nichts, die Symptome zu bekämpfen.«
Es geht Moneta hier also um eine grundsätzliche Kritik des herrschenden Liberalismus, der unfähig sei, diese Probleme zu lösen, und dessen Glücks-Credo immer, damals wie heute, das individuelle carpe diem ist, der Imperativ, den Tag zu genießen. Für Moneta jedoch ist dieses liberale carpe diem die, so wörtlich: »gespenstisch anmutende Aufforderung, Freudentänze auf den Grabhügeln menschlicher Skelette aufzuführen, die uns die jüngste Geschichte als Erbe hinterlassen hat«. Es könne deswegen nicht darum gehen, den Tag einfach nur zu nutzen oder zu genießen. Es müsse vielmehr darum gehen, den Tag zu nutzen, um die Zukunft vorzubereiten: »darin liegt unser Glück«.
Die Sattheit erzeugt also nicht automatisch das Glück, weil sie nicht automatisch den neuen Menschen gebärt. Glück bezeichnet vielmehr die Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit in ihrer ganzen Vielfältigkeit. Eine solch glückliche Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit sei aber kein gesellschaftlicher Wildwuchs, sondern eine Kulturpflanze, ein langer und komplizierter Prozess, wie er schreibt. Und ein solch langer und komplizierter Prozess bedürfe, gerade weil er lang und kompliziert ist, eines eigenen Maßstabes – eines Maßstabes weniger im Sinne eines von oben durchzusetzenden Imperativs als vielmehr im Sinne einer permanenten Selbstvergewisserung der sich in Bewegung setzenden Individuen.
Doch woher nehmen wir diesen Maßstab, wenn wir ihn nicht auf Zwang und Gewaltanwendung gründen wollen? Moneta schreibt: »Man kann ihn offensichtlich nicht aus dem Menschen gewinnen, so wie er heute ist; aus diesem von der Arbeitsteilung zerrissenen, vom Kampf ums Dasein erschöpften, vom Dienst am Eigennutz erniedrigten, armseligen, geängstigten Geschöpf, das sich Mensch nennt.« Ein solcher Maßstab lässt sich nur aus der Geschichte der Menschheit, aus ihren kumulativ angehäuften und verarbeiteten Lebens- und Kampferfahrungen, aus »den großen schöpferischen Leistungen des Geistes« herauslesen, aus jenen Möglichkeiten, die sich in der bisherigen Geschichte bereits aufgetan haben. Und diese geschichtliche Erfahrung lehre, dass der Mensch als ein unteilbares Ganzes zu verstehen ist, dass er ebenso individuell wie kollektiv sei, ebenso ökonomisch wie politisch, ebenso sozial wie kulturell. Der Maßstab der Emanzipation des Menschen liegt also für Moneta im Verständnis der anthropologischen Grundlagen des Menschen, in einem anthropologischen Verständnis, das auf einem ganzheitlichen Blick auf den Menschen ruht und sich der allseitigen Entfaltung dieses ganzheitlichen Wesens verpflichtet fühlt. Und weil er die üblichen Einwände linker Kritiker gegen diesen Gedanken gut kannte, fährt er gegen diese argumentierend fort: »Die Ökonomie ist die Grundlage, das ist wahr. Ohne Freiheit von der Sklaverei des Hungers, von der Jagd nach Arbeit oder Reichtum, ohne Befreiung von erschöpfender und langer Arbeitszeit, ist keine Voraussetzung vorhanden, von der aus die Persönlichkeit sich entfalten kann. Aber der eigentliche Kampf um den Menschen, der Kampf gegen seine Entmenschlichung durch Jahrtausende alte Schlacken, die er mit sich herumschleppt, er beginnt erst, nachdem diese Voraussetzung geschaffen ist. Das ist ein langer und zäher Kampf, aber die Mittel und Möglichkeiten, ihn zu führen, sind vorhanden, man muss sie nur ausschöpfen. Die gleiche Zähigkeit, mit der man Zigaretten oder Alkohol anpreist, die gleiche Presse, die sich durch ihren Inseratenteil verkaufen muss, der gleiche Rundfunk, der sich von Briefen steuern lässt, die Hörer mir verkümmertem Bewusstsein und bereits abgestumpften Seelen schreiben, sie könnten mächtige Waffen im Kampf um den neuen Menschen werden. Die gleichen verhüllten Gewalten, die heute im Dienste des Eigeninteresses stehen, könnten auch in den Dienst der Umformung des Menschen gestellt werden. Die Mittel sind vorhanden, man muss nur den Mut haben, sie anzuwenden.«
Ganz in diesem Sinne beendet er seinen Essay über das Unbehagen in der Sattheit mit den Sätzen: »Sattheit allein genügt nicht. Sie bringt das Unbehagen nicht zum Verschwinden. Im Gegenteil, sie weckt es meist, weil die Menschen mehr Muße haben, sich des Unbehagens bewusst zu werden. Bei den materialistischen Liberalen und [Halb (bei Moneta »Kleinst«)]-Sozialisten steht die Wirtschaft im Mittelpunkt. Für den sozialistischen Humanismus dreht sich alles um den Menschen. Ohne ein neues Bewusstsein wird der Mensch nie glücklich sein. Er wird die Sattheit nicht verdauen können.«
Jakob Monetas hier etwas ausführlicher referierter Essay von 1952 ist ein in doppelter Hinsicht bemerkenswerter Text. Er transportiert eine erfrischende Aktualität, obwohl sich doch die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir heute, 60 Jahre später, leben, sehr weitgehend verändert haben. Und er spiegelt auf treffende Weise das Leben und Werk einer der beeindruckendsten Gestalten der deutschen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert. Zuerst zur Biografie und dann zurück zum Essay.
II.
Die ersten Erinnerungen des im November 1914 im damals noch österreichisch-ungarischen Ostgalizien Geborenen waren Weltkriegserinnerungen. Am Ende dieses Ersten Weltkrieges wurde der vierjährige Jakob nicht nur Zeitzeuge des revolutionären Zusammenbruchs dreier europäischer Monarchien (Russland, Deutschland und Österreich-Ungarn), sondern musste auch gleich erleben, wie seine nun polnische Heimatstadt Blasow die neue Unabhängigkeit nicht besser zu feiern wusste als mit einem Judenpogrom. Nachdem daraufhin seine Familie 1919 nach Köln flüchtete, in die Heimatstadt seines Vaters, eines Textilfabrikanten, wuchs er im Köln der Zwischenkriegszeit auf und schloss sich Anfang der dreißiger Jahre der Jugendorganisation der aus einer linksoppositionellen Strömung der SPD hervorgegangenen Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP) an und engagierte sich im Arbeitersport. Ende 1933 verließ der junge Jude und Sozialist das faschistische Deutschland und ging nach Palästina, um in einem Kibbuz nicht nur zu überleben, sondern auch am Aufbau einer neuen solidarischen Welt Anteil zu nehmen. »Würde man mich fragen, woher meine unverrückbare Zuversicht stammt, dass Menschen Habsucht, Jagd nach Geld, Konkurrenzneid, Selbstsucht, Unterwürfigkeit – jene zum großen Teil vom Kapitalismus mühsam anerzogenen ›menschlichen‹ Eigenschaften – ablegen können; würde man mich fragen, wo die tiefste Wurzel meines Glaubens daran liegt, dass Menschen ohne jeden äußeren Zwang als Gleiche und Freie im Kollektiv ihr Leben selbst gestalten können, ich würde antworten: Das hat mir meine Erfahrung in der Praxis des damaligen Kibbuz bewiesen.« (1991, S.115) Hier, im palästinensischen Kibbuz also, lernte er eine praktisch gelebte sozialistische Kollektivität, die ihn zeitlebens prägen sollte, die ihn aber auch politisch ernüchtern ließ, als er aus dem Kibbuz ausgeschlossen und mit 27 Monaten Internierung bestraft wurde, weil er 1939 gegen den politischen Zionismus auftrat und gewerkschaftliche Streiks organisierte und dabei wie selbstverständlich auch mit nichtjüdischen Arabern zusammenarbeitete.
»In der falschen Hoffnung, die Geschichte würde dort weitergehen, wo sie nach der Revolution von 1918 unterbrochen worden war«, (ebd. S. 122) wollte er nach dem Ende des zweiten Weltkrieges und dem Zusammenbruch des deutschen Faschismus unbedingt zurück nach Deutschland. Doch erst 1948 gelang ihm über Frankreich und Belgien die Rückkehr nach Westdeutschland – der deutsche Osten bot ihm, dem trotzkistisch beeinflussten Antistalinisten, keine wirkliche Perspektive. Zurück in Köln wurde er Redakteur der von Willi Eichler und Heinz Kühn geführten sozialdemokratischen Rheinischen Zeitung und Mitglied der neuen Sozialdemokratie. Er stärkte dort – zusammen mit Leo Kofler, Ernest Mandel und anderen – den linkssozialistischen Flügel und ging nach seinem Schweizer Erholungsurlaub 1952, als er verstand, dass dieser zu Beginn der fünfziger Jahre in die hoffnungslose Defensive geraten war, im Jahre 1953 als Sozialreferent an die bundesdeutsche Botschaft nach Paris.
Er hielt zwar den Kontakt in die Heimat, doch das Westdeutschland, in das er neun Jahre später, 1962, zurückkehren sollte, hatte sich während des vergangenen Jahrzehnts nachhaltig verändert. Große Teile seiner Generation heimatloser Linker hatten sich nach langen und intensiven Kämpfen gegen die Godesbergisierung der SPD enttäuscht und zermürbt geduckt oder gar zurückgezogen. Und die neue, an den Universitäten heranwachsende linke Generation wollte von der ersten Generation einer Neuen Linken nicht mehr viel wissen – was zu tiefgreifenden gegenseitigen Vorbehalten führte und, anders als in Ländern wie Frankreich und Großbritannien, eine fruchtbare und für die Zeit nach 68 folgenreiche Zusammenarbeit zwischen alter und neuer ›Neuer Linker‹ verhindern sollte. Nur ganz wenige derjenigen, die in den fünfziger Jahren politisch führend aktiv waren, sehen wir nach 68 auf der politischen Bühne wieder. Und einer dieser wenigen war Jakob Moneta, den der IG Metall-Vorsitzende Otto Brenner 1962 zum Chefredakteur der beiden einflussreichen IG-Metall-Zeitungen Metall und Der Gewerkschafter gemacht hatte, und damit auch zum IG Metall-Vorstandsmitglied.
Mit seinem tatkräftigen Optimismus gelang Moneta der Brückenschlag zwischen den Generationen und er ging als einer der wenigen Exponenten des linken Gewerkschaftsflügels in die Geschichtsbücher der sechziger und vor allem siebziger Jahre ein. Als neuer Metall-Chefredakteur brachte er die IG Metall wieder auf einen strikt antimilitaristischen Kurs gegen den Vietnam-Krieg und gab den Ohnmächtigen eine Stimme, u.a. durch Berichte und Interviews aus dem betrieblichen Arbeitsalltag, durch Ausdehnung der Leserbriefspalten und, später, durch fremdsprachige Zeitungsausgaben für die in Deutschland lebenden und arbeitenden ›Gastarbeiter‹. Als zuvor die Studenten aufbegehrten und ihr ›Wir wollen alles – und zwar sofort‹ auf der Straße skandierten, wusste er zwar, dass dieses ›sofort‹ eine Illusion war, aber immerhin eine heroische Illusion, denn dass hier jemand endlich wieder einmal alles begehrt, das gefiel ihm sehr. Entsprechend kritisierte er seine reformistischen Kolleginnen und Kollegen nicht dafür, dass sie sich als Reformisten verstanden, sondern dafür, dass sie nicht reformistisch genug waren, dass sie nicht das politische Bündnis mit den Radikalen suchten, um ihrem Reformismus den nötigen Nachdruck zu verleihen.
Solange ein Otto Brenner noch an der Spitze der IG Metall stand, konnte Moneta mit dieser Haltung noch produktiv wirken. Als jedoch Eugen Loderer den 1972 plötzlich verstorbenen Brenner ersetzte, ging dieses Verständnis Stück für Stück verloren, bis Moneta Ende der siebziger Jahre den vorgezogenen Ruhestand suchte, um endlich wieder frei von institutionellen Zwängen als Autor und Vortragsreisender wirken zu können. Es war die Zeit des Niedergangs der Neuen Linken und des Aufstiegs der ökologischen Frage. Es wurde aber auch die Zeit des Postmodernismus und eines wie Phönix aus der Asche auferstandenen Neo-Liberalismus. Kein Zufall ist es deswegen, dass Moneta in seinen Kolumnen der achtziger und neunziger Jahre so gekonnt den alten Faden seines Essays von 1952 wieder aufnahm und nicht mehr müde wurde, das damals seinen Siegeszug antretende neoliberale Menschenbild kritisch aufzuspießen, wo es nur ging.
III.
Damit bin ich wieder zurück beim Essay von 1952, der getragen wird von einem Verständnis vom Menschen, das eindeutig anthropologisch argumentiert, d.h. mit dem menschlichen Wesen. Das ist noch heute bei den meisten Linken eine Provokation und war damals, vor nun 60 Jahren, eine wirkliche theoriepolitische Revolution. Moneta fordert hier eine ›neue Anthropologie‹, die davon ausgehen müsse, dass der Mensch unteilbar sei, dass man ihn nicht künstlich aufspalten dürfe in ein ökonomisches, in ein politisches oder in ein kulturelles Wesen. Der Mensch sei ein ganzheitliches Wesen und es gebe dieses ganzheitliche Wesen, dieses Gattungswesen Mensch nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Wirklichkeit – nämlich als ansatzweisen Aufschein des Möglichen und als theoretisch-praktische Aufgabe, als konkrete Utopie im besten Sinne des Wortes.
Moneta hat diese neue Anthropologie später nicht weiter theoretisch durch dekliniert. Das war erstens nicht seine Sache und zweitens hat dies ein anderer Theoretiker für ihn getan – und zwar niemand geringeres als Leo Kofler. Moneta hat mit Kofler damals, in den Jahren 1951/52, sehr viel diskutiert und politisiert, weil er den austromarxistischen Einzelgänger nach dessen Flucht aus der sich stalinisierenden DDR in seinem Kölner Haus am Brüsseler Platz aufgenommen hatte. Dort saßen dann Moneta, Kofler und der junge Ernest Mandel häufig zusammen und diskutierten über Gott und die Welt. Sowohl Kofler wie auch Moneta arbeiteten damals parallel an Schriften gegen den Stalinismus und Kofler entwickelte in jener Zeit auch die Grundlagen seiner philosophischen Anthropologie, die er als Wissenschaft von den unveränderlichen Voraussetzungen menschlicher Veränderung fasste – und die dann übrigens auch eingegangen ist in Ernest Mandels großes, zweibändiges Werk über die Marxistische Wirtschaftstheorie, an der Mandel schon damals arbeitete. Und weil Moneta einen sensiblen Blick hatte für andere Menschen und ihre Fähigkeiten, hat er nicht nur erkannt, wie originell Kofler gewesen ist, sondern auch, wie wichtig dessen Idee einer marxistischen Anthropologie in den geistigen Auseinandersetzungen seiner Zeit war und ist. Zu seinen Lieblingsliedern gehörte deswegen auch das alte US-amerikanische Arbeiterlied »Her mit dem ganzen Leben: Brot und Rosen«, das auf einen Streik von mehr als 20.000 Textilarbeiterinnen mit Migrationshintergrund (wie man heute sagt) in Massachusetts (USA) zurückgeht, die 1912, also vor genau hundert Jahren, erfolgreich für einen gerechten Lohn, sprich: Brot, und für eine menschenwürdige Arbeits- und Lebensumgebung, sprich: Rosen, kämpften. In der Theorie sind wir dieser neuen Anthropologie in den vergangenen Jahrzehnten marxistischer und nichtmarxistischer Diskussion ein gehöriges Stück näher gekommen – praktisch leider nicht. Das liegt auch an der Linken selbst, an ihrer Unfähigkeit und Unwilligkeit, zu lernen. Mehr noch aber liegt es wohl an den herrschenden Verhältnissen, gegen die Linke zu Recht aufbegehren.
Monetas Idee und Forderung einer neuen Anthropologie ist aber nur ein Aspekt des Essays von 1952, in dem sich sein Leben und Werk exemplarisch verdichtet. Ein weiterer Aspekt ist sein schon dort zutage tretender Anti-Neoliberalismus. Es ist kein Zufall, dass sowohl Moneta wie Kofler die Notwendigkeit einer anthropologischen Grundlegung sozialistischer Politik in direkter Auseinandersetzung mit den neoliberalen Vordenkern Röpke, Eucken und auch Hayek begründen, und auch in direkter Auseinandersetzung mit den stalinistischen Sozialismusformen. Wer sich wie die beiden um eine ernsthafte, auch politisch-philosophische Kritik des bürgerlichen Liberalismus bemüht und deren einfache Negation in Form eines ebenso mechanistisch-vulgären wie autoritär-despotischen Sozialismus-Verständnisses scheut, wird nicht um die Frage nach einem Maßstab seiner doppelten Kritik herumkommen. Und wer ein Sensorium entwickelt hat für das spezifisch neo-liberale Menschenbild und seine ideologische Verführungskraft, der kann sich mit einer rein ökonomietheoretischen Kritik des Neo-Liberalismus nicht zufriedengeben. Es ist heute leider Mode geworden, den Streitern gegen den Neo-Liberalismus zu unterstellen, sie würden ja gar nicht gegen den Kapitalismus an sich rebellieren, sondern nur gegen den neo-liberalen Kapitalismus. Nun, bei Moneta kann man lesen und lernen, warum der Kampf gegen den Neoliberalismus immer auch ein Kampf gegen den Kapitalismus an sich ist.
Damit bin ich beim dritten Aspekt, bei Monetas Radikalismus im besten Sinne des Wortes. Moneta strebte gern an die Wurzel der Dinge (ohne dabei die Bodenhaftung an der gesellschaftlichen Oberfläche zu verlieren) und kritisierte die Halbheiten bürgerlich-demokratischer Emanzipation ebenso scharf wie er die Halbheiten einer proletarisch-sozialistischen Emanzipation kritisierte. Moneta kannte seinen Marx und auch die Geschichte der Emanzipationskämpfe. Er wusste, dass die Rezepte der Marktwirtschaft keine emanzipativen Lösungen bieten, ebenso wenig wie die Rezepte einer sozialistischen Bürokratie Wege nach Utopia weisen. Und so verbinden sich in dem Essay Monetas Antikapitalismus und sein Antistalinismus mit der Idee einer neuen Anthropologie zu einem radikaldemokratischen, sozialistischen Humanismus, der nicht zum schlechtesten Erbe des 20.Jahrhunderts gehört. Monetas sozialistischer Humanismus kam aber unaufdringlich daher und war gleichermaßen Zielvorstellung wie auch persönlich gelebtes Ethos. Moneta war entsprechend empfänglich für die bei den meisten Linken noch immer vernachlässigten Fragen einer emanzipativen Ethik und er nahm die radikal-demokratischen Versprechen der frühbürgerlichen Aufklärungstradition ebenso ernst wie die Emanzipationsversprechen des alten Arbeiterbewegungsmarxismus. Niemals hat er sich darauf verlassen, dass wo Demokratie drauf steht auch Demokratie drin ist, oder, dass wo Sozialismus drauf steht auch Sozialismus drin ist, denn beide gehörten für ihn untrennbar zusammen. Ein konsequenter Demokrat müsse eben auch Sozialist sein, wurde er nicht müde zu betonen. Und kein Sozialist verdiene Glaubwürdigkeit, der nicht verstanden habe, dass demokratische Freiheiten eine Errungenschaft sind, die man für keine noch so schön gemeinte Erziehungsdiktatur suspendieren kann. Sich von dieser radikal-demokratischen Aufgabe nicht bürgerlich vereinnahmen zu lassen, das hat er verstanden – nicht zuletzt, weil er nicht vergessen hat, dass demokratische Fortschritte in den letzten beiden Jahrhunderten nur gegen jene bürgerliche Klasse durchzusetzen waren, die doch gleichzeitig als deren vermeintlich natürlicher Exponent betrachtet wird.
Wir finden weitere Aspekte in dem Essay von 1952. In der für die damalige Zeit ausgesprochen bemerkenswerten Kritik am liberalen carpe diem, das im Angesicht der menschlichen Grabhügel der jüngsten Geschichte geradezu gespenstisch anmute, findet sich das Erbe eines enttäuschten jüdisch-marxistischen Messianismus, in der ernsthaften Rede von der ›Sünde wider den Menschen‹ das christliche Erbe. Im Insistieren, dass die Mittel der Emanzipation alle vorhanden sind, und dass man nur den Mut haben müsse, sie anzuwenden, finden wir seinen ebenso trotzigen wie tatkräftigen Optimismus. Und in der im Essay gleich zu Beginn zu Tage tretenden Wertschätzung eines deutschen Juden und Sozialisten für den deutschen Erbfeind, für die französische Grande Nation und deren Lebensart drückt sich sein ganzer Internationalismus aus. Nur wenige Monate, nachdem dieser Essay veröffentlicht war, ging Moneta als Botschaftsattaché nach Paris und vermischte dort Diplomatie mit internationalistischer Subversionsarbeit für die algerische Revolution. Für ihn waren Grenzen zum Überschreiten da, auch und gerade die nationalen. Das war die gelebte und gepflegte Erfahrung eines wirklichen Internationalisten und eines selbstbewussten Deutschen, dem ›Deutschland‹ – in einer Formulierung Peter Brückners – ebenso sehr ein objektiver Schuldzusammenhang war, aus dem Antifaschismus und Dissidenz nicht entließen, wie er einen Horizont künftiger gesellschaftlicher Praxis bezeichnete. (1987, S. 151)
Ein weiterer hier zu benennender Aspekt der essayhaften Verdichtung von Leben und Werk ist Monetas politisch-journalistischer Stil. In der Essay-Form von 1952 finden wir bereits jene Kunst des Kolumnisten, mit der er später seinen Ruf als politischer Journalist begründen sollte, ob als Chefredakteur der IG Metall-Zeitschriften oder, noch später, als Kolumnist bei der was tun und bei der SoZ. Bereits in diesem frühen Essay verbindet sich der spezifisch journalistische Blick mit der politisch-philosophischen Methodik. Auf angenehme Weise belehrend mischte Moneta auch in seinen späteren Kolumnen aktuelle Fragen mit grundsätzlichen, Alltagsbegebenheiten mit politischen Großwetteranalysen, Deutsches mit Internationalem, politische Argumente mit sozialgeschichtlicher Aufklärung. Und immer wieder finden wir bei ihm die emphatische Betonung der Arbeit am Bewusstsein. Ob als Journalist und Publizist oder als Gewerkschafter und Intellektueller, ob als Herausgeber und Übersetzer oder als Mitglied der SPD und, unter der Hand, der Gruppe Internationaler Marxisten (GIM), ob als späteres Mitglied der Vereinigten Sozialistischen Partei (VSP) oder der nun gesamtdeutschen Partei des demokratischen Sozialismus (PDS) – Jakob Moneta hat immer Position bezogen, sich eingemischt und Bewusstsein angestoßen, sei es im direkten Gespräch oder in Gremiensitzungen, sei es auf Tagungen und bei Vorträgen oder mit seinen zahllosen publizistischen Texten und Kolumnen. Politischer Journalismus war ihm vor allem die aktive Veränderung von Bewusstsein, der ewige Kampf um die Köpfe der Menschen. Er hatte was zu sagen. Und er hat gerne angestoßen und gefördert, konnte aber auch zuhören und das Gehörte und Erlebte verarbeiten. Sektierertum, die selbstgewählte Abschottung gegen andere, waren ihm fremd, obwohl er sich seines gesellschaftlich marginalisierten Standpunktes immer bewusst blieb. Ihm war klar, dass er nicht in Zeiten des Barrikadensturmes lebte. Doch ein Grund, deswegen nicht mehr alles zu wollen, war auch dies für ihn nicht. So nahm auch Moneta etwas von jenem Geist geistloser Zustände an, den man nicht nur von Marx, sondern auch aus der populären Kultur kennt: »Man gets tired, Spirit don’t / Man surrenders, Spirit won’t / Man crawls, Spirit flies / Spirit lives when Man dies / Man seems, Spirit is / Man dreams, Spirit lives / Man is tied, bound, torn, Spirit free / What Spirit is, Man can be!« (The Waterboys*)
Damit komme ich zum letzten Aspekt des Essays, in dem sich für mich Monetas Leben und Werk verdichtet – zu einer Eigenschaft, mit der ich von seiner politischen zu seiner menschlichen Haltung überleite. Ich habe erwähnt, dass er die Idee einer ›neuen Anthropologie‹ in gemeinsamen Diskussionen mit Leo Kofler erarbeitet hat. Und das ist nicht untypisch für Moneta gewesen. Er hatte nämlich eine seltene Fähigkeit, originelle Menschen und Denker zu entdecken, sich von ihnen beeinflussen zu lassen und sie auch weiterzudenken. Er hatte eine seltene Fähigkeit, junge Talente in der politischen Theorie wie in der politischen oder journalistischen Praxis zu erkennen und zu fördern, und er ging dabei auf eine bemerkenswerte Weise ebenso selbstbewusst wie selbstlos vor. Moneta war ein Trüffelschwein und ein Vermittler, er suchte zeitlebens nach dem Neuen im Alten, suchte nach neuen Trends und Talenten und vermittelte diese geschickt in die Milieus, in denen er sich gerade bewegte. Er war deswegen ein großer Anreger und Förderer und gelegentlich auch ein Mahner. Sein Organisationstalent war dabei vor allem ein Talent zur Vermittlung, ein Netzwerk-Talent. Wie viele Menschen, namhafte wie weniger namhafte, hat Moneta in seinem langen Leben selbstlos gefördert, und zwar gefördert, ohne sie dabei an der Messlatte seiner eigenen politischen Meinung scheitern zu lassen? So suchte er in den Menschen, die seinen Lebensweg kreuzten, die spezifische Individualität und beförderte deren Entfaltung, wo immer er konnte. Er wollte das ganze Leben, er wollte Brot und Rosen – nicht nur für sich allein, sondern für alle.
Mit dieser Haltung hat er vielen Menschen nicht nur geholfen, sondern sie auch verändert. Auch mit der Veränderung von Menschen kann man die Welt ein Stück weit verändern. Monetas Parteinahme für die Ohnmächtigen dieser Welt war die Vorbereitung einer nicht nur ihm eigenen Zukunftsvision und hatte dabei viel von einem geduldigen Bohren dicker Bretter. Mag er im Stillen auch manches Mal dabei schwach geworden sein – wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich ist es doch –, so hat er sich diesem geduldigen Bohren dicker Bretter nichts desto trotz zeitlebens verschrieben. Die Ausdauer und der optimistische Elan, mit der der linke Aufklärer diese Arbeit verrichtete, sind bewundernswert. Die meisten seiner linken Zeitgenossen haben diese Standhaftigkeit im Zeitalter des Skeptizismus nicht aufzubringen vermocht. Sie haben irgendwann aufgegeben oder sind bürokratisch oder sektiererisch erstarrt. Nicht so Jakob Moneta – und das macht ihn so besonders! Im stolzen Alter von 97 Jahren ist Jakob Moneta am 3. März 2012 in einem jüdischen Altenheim in Frankfurt/M. gestorben.
Literatur:
PETER BRÜCKNER: Das Abseits als sicherer Ort. Kindheit und Jugend zwischen 1933 und 1945 (1980), Berlin 1987
CHRISTOPH JÜNKE: »Wann ist der Mensch ein Mensch? Leo Koflers anthropologische Utopie«, in Verena Di Pasquale u.a. (Hrsg.): Grenzüberschreitungen – zwischen Realität und Utopie, Münster 2006, S.70-78 (Online-Fassung unter: http://www.linksnet.de/de/artikel/20294)
CHRISTOPH JÜNKE: Sozialistisches Strandgut. Leo Kofler – Leben und Werk (1907-1995), Hamburg 2007
LEO KOFLER: Perspektiven des revolutionären Humanismus, Reinbek bei Hamburg 1968 (Neuauflage Köln 2007) LEO KOFLER: Aggression und Gewissen. Grundlegung einer anthropologischen Erkenntnistheorie, München 1973 ERNEST MANDEL: Marxistische Wirtschaftstheorie, Frankfurt/M. 1962/68 (Neuausgabe Köln 2007)
JAKOB MONETA: »Schweizer Erfahrungen oder das Unbehagen in der Sattheit«, Erstveröffentlichung in: aufklärung, II. Jahrgang, Heft 3, Oktober 1952, S.180-189. Nachdruck in Utopie kreativ, Heft 109/110 (November/Dezember 1999), S.30-38 (online unter: http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Utopie_kreativ/109-10/109_10_Moneta.pdf); außerdem erschienen, und mit einem aktualisierenden Nachwort Monetas versehen (»Ein halbes Jahrhundert danach: der rückschrittliche Fortschritt«), in Christoph Jünke (Hg.): Am Beispiel Leo Koflers. Marxismus im 20.Jahrhundert, Münster 2001, S.78-95. Zitate nach dieser Ausgabe
JAKOB MONETA: Mehr Macht für die Ohnmächtigen. Reden und Aufsätze, Frankfurt/M. 1991
JAKOB MONETA: Solidarität im Zeitalter des Skeptizismus. Kommentare aus drei Jahrzehnten, Köln: SoZ-Verlag 2004 - darin befindet sich eine kleine Auswahl der im Text erwähnten Kolumnen
JAKOB MONETA: Gesprächsbeitrag in: »So war er eben: unbeugsam« zum Buch Begegnungen mit Leo Kofler. Ein Lesebuch (hrsg. von Uwe Jakomeit u.a.), Köln 2011, S.65-73
JAN-WILLEM STUTJE: Rebell zwischen Traum und Tat. Ernest Mandel (1923-1995), Hamburg 2009.
* »Der Mensch ermüdet, der Geist nicht / Der Mensch kapituliert, der Geist wird es nicht / Der Mensch kriecht, der Geist fliegt / Der Geist lebt, wenn der Mensch stirbt / Der Mensch ist Schein , der Geist ist Sein / Der Mensch träumt, der Geist lebt / Der Mensch ist gebunden, eingebunden und zerrissen, der Geist frei /Was der Geist ist, kann der Mensch sein!« The Waterboys: Spirit, 1986.