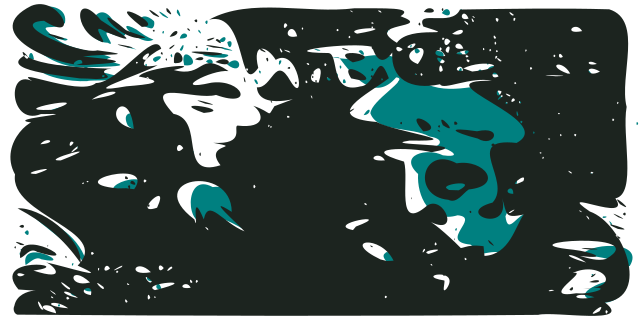von Ulrich Schödlbauer
Historische Darstellungen beruhen auf zwei Fragestellungen:
1. Was hätte passieren können, wenn…?
2. Was waren die auslösenden Faktoren für…?
Auf beide kann es, wie leicht einzusehen, nur hypothetische Antworten geben – im ersten Fall, weil die Frage selbst hypothetisch, im zweiten, weil der Gegenstand virtuell unendlich ist: historische Realität wird nur in Schichten zugänglich, Schichten verlangen Schnitte, Schnitte bedeuten Willkür – das heißt, spätestens an dieser Stelle fließen Interessen ein, irgendwann auch die Frage nach Schuld und Gerechtigkeit und damit das Problem der Monokausalität: Man will wissen, wer’s getan hat, und dieses Wissen ist bei komplexen historischen Vorgängen nicht zu erlangen. Das heißt, man setzt den Teil fürs Ganze und bleibt Gefangener einer Perspektive. Geschichte, so betrachtet, ist eine perspektivische Wissenschaft.
Bleibt die erste der beiden Fragestellungen. Die meisten Historiker werden sie ins Reich der Spekulation verbannen und energisch darauf beharren, dass Geschichte eine Tatsachenwissenschaft sei und nichts als aus Dokumenten Belegbares in ihr zu Wort kommen dürfe. Das ist der Grund, aus dem die Frage selten so gestellt wird, es sei denn, man bewegt sich im Fahrwasser der alternativen Geschichtsschreibung und damit der Spaßwissenschaft. Was nicht heißt, dass sie nicht in praktisch jeder historischen Untersuchung, die ihren Namen verdient, unterschwellig am Werke wäre, weil anders die Relevanz der Daten sich gar nicht ermitteln ließe.
Um zu wissen, ob ein Faktor tatsächlich an einer Entwicklung beteiligt war, muss zuallererst die Frage geklärt sein, ob diese Entwicklung auch ohne ihn hätte stattfinden und welche andere im Fall der Fälle an ihre Stelle hätte treten können. Eine solche Überlegung mag auf den ersten Blick banal wirken, aber sie bringt die hypothetische Grundlage zum Vorschein, die aller historischen Darstellung jenseits der bloßen Berichtsebene vorausliegt. Nur geht es dabei in der Regel nicht bloß um Sein oder Nichtsein, sondern in erster Linie ums Anderssein. Schließlich belassen es die historischen Akteure selten beim einfachen Tun oder Unterlassen, sondern denken und handeln in Alternativen, die nur in Ausnahmefällen dokumentiert sind. Es sind die Historiker, die einspringen und sich Alternativen ausmalen, für deren ›Existenz‹ sie tunlichst nach Belegen fahnden – Belegen, nicht etwa Beweisen.
1.
Warum sollte ein Nichthistoriker mit durchschnittlichen Geschichtskenntnissen sich Helmut Roewers dreibändiges Geschichtswerk Unterwegs zur Weltherrschaft einverleiben, das mehr oder weniger akribisch Amerikas Weg zur Weltmacht von 1914 bis ins 21. Jahrhundert beschreibt, also einen Stoff, der in vielerlei Beschreibungen (und Beschreibungsschnipseln) allgegenwärtig erscheint? Nun, ein Grund ist einfach: Roewer ist weder Fachhistoriker noch Journalist, er ist Jurist mit ausgedehnten Praxiskenntnissen auf dem Feld der Geheimdienste, der in die einschlägigen Archive gegangen ist und sich aus den Dokumenten kundig gemacht hat. Das lässt die Aussicht zu, dass seine Darstellung eine Schicht des Geschehens freilegt, die sonst eher stiefmütterlich behandelt wird. In der Tat: Klüngelei und Geheimdienste spielen in seiner Geschichte eine bedeutende – und Laien eher unvertraute – Rolle und seine Darstellung lässt einen mit leichtem Bedauern nach einem nicht existierenden vierten Band greifen – schließlich möchte man, einmal auf den Geschmack gekommen, wissen, wie die Sache weitergeht. Einschneidender allerdings ist der zweite Grund: Roewer schreibt die Geschichte zwischen Amerika und Deutschland aus deutscher Sicht ohne die bei deutschen Fachhistorikern so oft anzutreffende Befangenheit gegenüber den Mythen der Sieger und ohne der Versuchung zu erliegen, sich und seine Generation gegenüber den Erlebnisjahrgängen auf einen Podest zu stellen – sei es der Moral, sei es der historischen Besserwisserei.
2.
Man kann dergleichen nicht notieren, ohne zugleich selbst den Befangenheitsreflex auszulösen: Darf man das? Wer das komplette Opus gelesen hat, der kann darauf getrost antworten: Ja, man kann. Ob er darf, muss jeder mit sich selbst abmachen. Ich bin kein Historiker und werde mich daher auf keine Detailauseinandersetzungen einlassen. Aber ich muss gestehen, selten ein Werk über jenen Zeitraum in Händen gehalten zu haben, das im Verzicht auf whitewashing, aufs Beschönigen, Verschweigen und Verteufeln am falschen Ort so weit gegangen – und gekommen – wäre (denn dass von einigen Teufeln in dieser Periode die Rede sein muss, ist unbestreitbar). Dabei ist Roewer keineswegs ängstlich im Aufstellen ›gewagter‹ Hypothesen. Vielen werden die seinigen nicht schmecken, obwohl er mit seinen Schlüssen keineswegs allein auf weiter Flur steht. Damit muss leben, wer sich ins Spannungsfeld politischer Indoktrinationen begibt, die von ihrer Brisanz bis heute wenig verloren haben. Roewer betreibt keine antiquarischen Studien um ihrer selbst willen, sondern will das Seinige zum Verständnis der Mächte und Interessen beitragen, welche die gegenwärtige Welt dominieren. Es fällt schwer, eine knappere und prägnantere Zusammenfassung der Hauptthesen (und damit des Inhalts) der drei Bände zu geben als diejenige, die der Verfasser selbst ihnen voranstellt. Daher sei sie hier wörtlich (und ohne Abstriche) zitiert:
»Dieses Buch schildert die zentralen politischen Aspekte der Auslösung des Ersten Weltkriegs sowie den Prozeß der Entscheidungsfindung bis zum Kriegsende. Es verwirft die These vom berühmt berüchtigten deutschen Griff nach der Weltmacht, denn hierbei handelt es sich um eine anglo-amerikanische Propaganda-Lüge, die in zwei Schritten — nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg — als Maßnahme der Sieger in Deutschland durchgesetzt wurde. Deren Ziel war es, eine Befassung mit den wahren Gründen der Kriegsvorbereitung, -auslösung und -führung zu verhindern.
So konnte erstens
ein Jahrhundert lang verschleiert werden, daß eine Clique in der britischen upper class den Ersten Weltkrieg 1914 vorsätzlich auslöste, und wie sie hierbei vorging. Durch mutwillige Falschdarstellungen wurden diese Personen geschützt und der Öffentlichkeit ihre Motive und ihre Tricks vorenthalten. Es blieb verborgen, daß die britischen Kriegsmacher bezüglich ihres Wunschgegners Deutschland beträchtlichen Fehlvorstellungen unterlagen, so daß ihre Planung nicht aufging, einen maximal drei Monate andauernden wirtschaftlichen Vernichtungsfeldzug zu führen.
und es konnte zweitens
ein Jahrhundert lang verschleiert werden, wie und warum ein knappes Dutzend führender Investment-Banker der USA von Anfang an Großbritannien durch illegale Kriegshandlungen unterstützte. Dies war nur möglich, weil diese Leute kurz vor Kriegsbeginn mit Hilfe eines von ihnen installierten US-Präsidenten das Währungssystem der USA in einem Staatsstreich an sich gebracht hatten und damit die Entscheidung über Krieg und Frieden. Es wurde das Faktum unterdrückt, daß die projektierten Kriegsgewinne sich in eine riesige Pleite zu verwandeln drohten, weil die Alliierten den Krieg aus eigener Kraft nicht gewinnen konnten, so daß die USA deshalb Deutschland mit militärischen Mitteln angriffen.
ınd so konnte schließlich drittens
ein Jahrhundert lang verschleiert werden, daß Deutschlands Schicksal nicht durch angeblich moralisch überlegene Staaten, sondern erst durch gravierende Fehler der deutschen Führung besiegelt wurde. Hierbei war hilfreich, die Mär vom Dolchstoß von innen und einer gegen Deutschland gerichteten jüdisch-freimaurerischen Verschwörung anzuheizen, die beide einer Überprüfung nicht standhalten, aber Jahrzehnte vom Kern der Ereignisse abgelenkt und in einen zweiten Weltkrieg geführt haben.«
(Band 1, Seite 16f.)
3.
Wer deutsches Weltmachtstreben und deutsche Schuld für die Quintessenz der neueren Geschichte hält, der wird an diesen drei Bänden wenig Freude finden. Nicht dass geleugnet würde, was nicht geleugnet (oder relativiert) werden kann. Dass es deutscher Unfähigkeit, die Zeichen der Zeit zu lesen und die richtigen Schlüsse zu ziehen (für die exemplarisch die Reihe blasser Reichsregierungen nach Bismarcks erzwungener Demission steht), sowie im späteren Verlauf der Geschichte deutschen Aberwitzes in Gestalt des ›Führers‹ und seiner Speichellecker bedurfte, um die Politik der Gegner zum Erfolg zu führen, kommt in der Darstellung nicht zu kurz. Als vereinzelter Lichtpunkt leuchtet da die Gestalt Walther Rathenaus auf, des ›von rechts‹ gemeuchelten Weimarer Außenministers, der der deutschen Außen- und Wirtschaftspolitik ein anderes Format hätte geben können. Im Kern aber geht es Roewer darum zu zeigen, wie die USA das kurze weltpolitische Intermezzo des (Zweiten und Dritten) Deutschen Reiches als Hebel nützten, um die globale Vormachtstellung Englands und Europas zu unterminieren und schließlich zu Fall zu bringen, indem sie sich selbst als Erbe des britischen Weltreiches und Welthegemon einsetzten. Wem das alles zu krass vorkommt, der greife zu G. Edward Griffins Longseller The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (dritte Auflage 2021), vor allem aber zu Michael Hudsons Studie von 2003 (dritte Auflage 2021): Super Imperialism. The Economic Strategy of American Empire – deutsch: Finanzimperialismus. Die USA und ihre Strategie des globalen Imperialismus, Stuttgart (Klett-Cotta) 2017, die sich über weite Strecken wie eine ökonomische Unterfütterung der Roewerschen Thesen liest.
4.
Was Roewer, vielleicht ohne es zu wollen, auch zeigt – oder zu zeigen scheint –, ist eine prinzipielle Unbegabtheit der Deutschen für nationalstaatlich motivierte Politik, die durch den Willen zur ›großen Politik‹ (Nietzsche), sprich zu ideologisch motiviertem Handeln kompensiert und – manchmal verbrecherisch – überkompensiert wird. Insofern bot ein Staat von der Größenordnung und in den Abhängigkeitsverhältnissen der alten Bundesrepublik ideale Voraussetzungen, das in Jahrhunderten der Kleinstaaterei angesammelte Verwaltungstalent seiner Bewohner unter Beweis zu stellen. Das gilt nicht zuletzt für die Bewahrung der ›deutschen Freiheit‹ im Bereich des Einzelnen und der Länder. Fasst man dagegen die sogenannte Berliner Republik ins Auge, dann liegt der Argwohn, hier sei eine kritische Grenze überschritten worden, auf der Hand. Die Rückkehr des Erziehungsstaates hat wenig mit gewachsener Souveränität, viel hingegen mit Sicherheitsbedürfnissen zu tun, die, zu Ende gedacht, der Absicherung von Partikularinteressen dienen, also der Angst vor dem Zerrinnen der Macht, auf welcher Ebene auch immer. Der neueste Ärger über den Hegemon im Westen, der seine schützende Hand abzuziehen droht und dem ›Schützling‹ eine Politik der Selbständigkeit abverlangt, spricht da Bände. Deutschland kann heute, medial und mental, als eine Satrapie der Vereinigten Staaten betrachtet werden. Solche Züge ergeben sich nicht einfach aus psychischem oder pseudoreligiösem Unvermögen, sondern verweisen, abseits der Wirkungen moderner Propaganda, auf die tiefe Kultur eines Landes, die Longue durée, deren Erforschung im Mittelmeerraum sich einst Fernand Braudel widmete.
Helmut Roewer: Unterwegs zur Weltherrschaft. Band 1: Warum England den Ersten Weltkrieg auslöste und Amerika ihn gewann, Zürich (Scidinge Hall) 2016, Zweite Auflage, 363 Seiten.
Band 2: 1918-1945. Warum eine anglo-amerikanische Allianz Deutschland zum zweiten Mal angriff und die Rote Armee in Berlin einmarschierte, Zürich (Scidinge Hall) 2017, zweite, korrigierte Auflage 2018, 398 Seiten.
Band 3: 1945 bis heute. Warum das US-Imperium so lange bei uns Erfolg hatte, jedoch bei der Umerziehung der Ostdeutschen scheiterte, Zürich (Scidinge Hall) 2018, 487 Seiten.