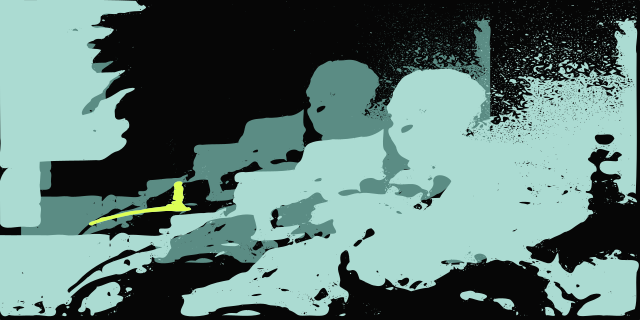Im Jahr 2020 jährt sich zum 170. Mal der Geburtstag des bedeutenden sozialdemokratischen Theoretikers und Politikers Eduard Bernstein. Am 6. Januar 1850 im damals noch eigenständigen Schöneberg bei Berlin geboren, avancierte der auch als Historiker und Politikwissenschaftler hervorgetretene Sohn eines Lokomotivführers zu einem der wirkungsmächtigsten Vordenker der SPD nach dem Ende des ›Sozialistengesetzes‹ und zur Identifikationsfigur mit jener Strömung, die als ›Revisionismus‹ in die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung einging. Der Aufstiegswille des preußischen Reformjudentums in der Tradition der Haskala prägte auch den jungen Eduard, der mit 16 Jahren aus finanziellen Gründen das Gymnasium verlassen musste und eine Banklehre absolvierte. Doch die Erfahrungen der ›Gründerkrise‹ nach 1871 brachten den zunächst linksliberal Orientierten an die Seite der Sozialdemokratie. Im Frühjahr 1872 trat er den ›Eisenachern‹, also der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) August Bebels und Wilhelm Liebknechts bei und wirkte für sie als Agitator. Sein Onkel war übrigens der in Berlin weithin bekannte linksliberale Publizist, 1848er Revolutionär und Autor der Berliner Volkszeitung, Aaron Bernstein (1812-1884).
Seit 1895 verfasste Eduard Bernstein, zunächst aus dem Londoner Exil, wo er zum Freund von Friedrich Engels wurde, seine kritischen Texte zum offiziellen Parteimarxismus der SPD. 1888 hatte die Schweiz den Privatsekretär des sozialdemokratischen Mäzens Carl Höchberg ausgewiesen, ein preußischer Haftbefehl gegen ihn hinderte Bernstein bis 1901 an der Rückkehr nach Berlin. Nachdem Engels am 5. August 1895 in London verstorben war, nahm er seine kritische Auseinandersetzung mit der offiziellen Parteitheorie der SPD, wesentlich verkörpert von Karl Kautsky, in seiner Artikelserie in Kautskys Neuer Zeit von 1896-1898 auf. Damit verband sich der große ›Revisionismusstreit‹ in der deutschen Sozialdemokratie um 1900. Auch an der zweiten bedeutenden Debatte, jener über den Massenstreik (1905-1910), beteiligte sich Bernstein engagiert und prononciert. Doch führte die Revisionismusdebatte vor allem zur Stigmatisierung Bernsteins als eines ›nicht-mehr-Sozialisten‹ und ›Opportunisten‹ und letztendlich kleinbürgerlichen Demokraten, vor allem auch durch Rosa Luxemburgs Sozialreform oder Revolution? Die kommunistisch geprägte Historiographie nach der Oktoberrevolution von 1917 machte aus Bernstein eine Wurzel allen Übels, das man in der westeuropäischen Sozialdemokratie zu erblicken glaubte. Diese wiederum, besonders die deutsche, eignete sich den Kritiker der ›Zusammenbruchstheorie‹ kautskyanischer Provenienz vor allem während der Jahre der sozialliberalen Koalitionen Willy Brandts und Helmut Schmidts wieder an, denn es ging um den ›Orientierungsrahmen 1975-1985‹ bzw. um eine Transformationsdebatte in der SPD-Linken und bei den Jusos sowie den sozialistischen Hochschulverbänden Juso-HSG, SHB und HDS.
Heutzutage zeigen sich erste Ansätze einer erneuten Hinwendung zu ›Ede‹ Bernstein, der am 15. Dezember 1932 in Berlin-Schöneberg verstarb. Die Ursache dafür liegt vor allem in den Reflexionen über die Möglichkeiten einer transformatorischen Politik in Richtung einer solidarischen, man könnte auch klassisch formulieren, sozialistischen Gesellschaft in Zeiten neoliberaler Hegemonie. Was könnten rot-rot-grüne Bündnisse leisten, die sich einer Politik verpflichteten, die das Wohl der großen Bevölkerungsmehrheit im Blick hätte und nicht die Ansprüche und Bilanzen der Reichen und der Kapitalbesitzer globaler Verwurzelung. Schließlich sprach sich auch der angebliche ›Sozialismusverräter‹ Bernstein gegen den ›Absolutismus des Kapitals‹ aus. Nach dem Scheitern des staatssozialistischen Transformationsmodells gemäß der leninistischen Vorstellung eines abrupten Bruches über eine revolutionäre Umgestaltungspraxis von oben rückt immer mehr die Überlegung ins Zentrum, wie es den politischen Vertretern der Beherrschten gelingen könnte, den Herrschenden schrittweise das Herrschaftsterrain abspenstig zu machen, was vor allem auf eine kämpferische evolutionäre Entwicklungsstrategie hinausläuft, von der man aber nicht wissen kann, ob sie nicht doch auf einen entscheidenden Bruchpunkt mit der Logik der neoliberalen und zunehmend autoritären Herrschaftspraxis zuläuft. Diese Unbestimmtheit lässt, das kann hier nicht unerwähnt bleiben, noch genügend Platz für Handlungsoptionen, die sich auf die Schulen von Rosa Luxemburg bis W. I. Lenin und L. Trotzki stützen können, wenn es die kontingente historische Situation gebietet. Eskalation zu verhindern aber war stets ein moralisches Anliegen des Pazifisten und Sozialisten Bernstein.
Dieser Perspektivierung folgt Tom Strohschneider als Herausgeber mit seinem ausführlichen Essay Bernstein: »Kritisches Denken in Bewegung« (S. 9-65). Dabei treibt ihn der Anspruch, dass »in der Geschichte des bisherigen Umgangs mit ihm ebenso wie in der Art seines Herangehens an die Wirklichkeit […] etwas freizulegen sein [könnte], was linkem Nachdenken noch heute weiterhilft« (S. 10). Strohschneider gründet seine diesbezügliche Auseinandersetzung auf die historische Verortung Bernsteins im Mainstream als Gründervater einer praktizistischen, theoriefernen und systemstabilisierenden Sozialdemokratie, als deren praktischer Sieger und theoretischer Verlierer gleichermaßen. Darin steckt der Vorwurf, seine Kritik an Theorie und Praxis der Bebelschen Sozialdemokratie allein habe die Spaltung der SPD nach 1914 und den ihr vorausgegangenen Sieg des ›Revisionismus‹ bzw. ›Reformismus‹ verursacht. In dieser Zuschreibung wie auch in jener gemäßigt sozialdemokratischen, die sich auf Bernstein beruft, sieht Strohschneider eine Art von »Traditionspflege (…), die sich ihren Vordenker das erinnerungspolitische Holzschnittkabinett gebastelt hat« (S.11). Und so rekonstruiert Strohschneider die programmatisch-ideologische Kulisse, vor der die großen erwähnten Strategiedebatten der Sozialdemokratie sich vollzogen. Diese Kulisse war gezimmert aus einem deterministisch-mechanistischen, beinahe teleologischen Geschichtsbild, das von der ›Naturnotwendigkeit‹ des großen Zusammenbruchs des Kapitalismus ausging, dem eine organisatorisch gefestigte und für diesen Moment gerüstete Sozialdemokratie mit ihrer gesamten organisatorischen Breite und Kraft gegenüberstehe: Bereit sein ist alles! Schon der erste Abschnitt des Erfurter Programms von 1891 ist hierin eindeutig. Die Praxis sah hingegen ›reformistisch‹ aus: Seit 1890 häuften sich die Versuche der Reichstagsfraktion, Kontakte zu den fortschrittlichen Parteien im Reichstag aufzunehmen, Unterstützung für diese zu signalisieren, um auch eigene (Teil-)Forderungen durchzusetzen. Aus den Debatten etwa über das BGB im Jahr 1896 kann man diese eindeutig parlamentarisch angelegte, auf kleinschrittige Erfolge z. B. in der Rechts- und Sozialpolitik abzielende Praxis nachweisen. Das war die typische Politik der SPD, und Marxisten wie Arthur Stadthagen oder Paul Singer und August Bebel deren typische Repräsentanten, Karl Kautsky ihr programmatisches Sprachrohr. Bernstein stieß in diesen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis hinein und versuchte in Anlehnung an Friedrich Engels eine Neujustierung. Strohschneider nennt den Kern dieses Ansatzes eine »umfassende Demokratisierung« und grenzt dies so von einer unterstellten Verabsolutierung der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie ab (S. 15). Dies galt für alle Sphären der Gesellschaft, für Wirtschaft und Politik ebenso wie für die in diesen ablaufenden und von der Arbeiterbewegung zu forcierenden Prozesse. Die Veränderungen des Kapitalismus im ausgehenden 19. Jahrhundert schufen die Voraussetzungen für die Überwindung eines frühkapitalistisch-autoritären Systems hin zu »immer komplexer werdenden ökonomischen und gesellschaftlichen Realitäten des modernen Kapitalismus«. Doch konstatiert auch Strohschneider, dass Bernsteins Sozialismuskonzeption, »bei dem demokratischer Reformismus die praktische Methode bildete, aber umfassende gesellschaftliche Veränderung das Ziel blieb (…) illusionär für die Zeit, in der er die entsprechenden Überlegungen vorstellte«, war (S. 16). Dies galt sowohl hinsichtlich der Stabilität des Kapitalismus als auch der Macht des Proletariats und der sozialdemokratischen Gegengesellschaft. Bernstein sei »zu früh gekommen«, lautet Strohschneiders Zwischenbilanz, die er mit der Hypothese kontrastiert, dass dann Rosa Luxemburg zu spät gekommen sei, weil ihr Transformationsmodell noch auf die vorausgegangenen Strukturzusammenhänge des Kapitalismus rekurriere und die Verhältnisse in Russland von 1905-1918 zu stark verallgemeinert habe. Doch nimmt Strohschneider nicht dann andererseits einen Blickwinkel ein, der zu stark von heutigem Wissen, das die beiden Konkurrenten Bernstein und Luxemburg gar nicht besitzen konnten, ausgeht? Kann es nicht vielmehr daran liegen, dass auch die Musterpartei der II. Internationale, die SPD, erst lernen musste, pluralistisch zu sein und den Nutzen vielfältiger Diskussions- und Deutungsansätze zu begreifen und anzunehmen? Verschloss nicht genau deshalb der damit verbundene Profilierungszwang parteileitender Ideologen und Strategen den Weg zur Öffnung des Blickes für notwendige Integrationsprozesse? Und vielleicht ist es kein Zufall, dass sich Bernstein und Luxemburg gerade in der Massenstreikdebatte auf der gleichen Seite wiederfanden mit ihrer Befürwortung des politischen Streiks – und dessen eingedenk, dass August Bebel ›vorwiegend nach rechts gesprochen‹ hatte – wenngleich von unterschiedlichen Ansatzpunkten ausgehend, aber von transformatorisch relevanten?
Es durchdringt wichtige sozialistische Positionsdebatten jener Zeit bis weit an die Gegenwart heran der informelle Geist des Rousseauschen ›volonté générale‹ als Markenzeichen sozialistischer Identität. Abweichendes galt häufig als ›Sonderwillen‹, in den Zerwürfnissen um den 4. August 1914 und der folgenden Jahre war der Vorwurf der ›Sonderbündelei‹ ein scharfes Schwert. Soziologisch betrachtet könnte dahinter die Diskrepanz zwischen erwarteter Homogenität der Arbeiterklasse und der sozialen Realität ihrer zunehmenden Heterogenität, auch der des sozialdemokratischen Funktionärskörpers durchschimmern. Dann spiegelten die großen Debatten der Sozialdemokratie um die Jahrhundertwende nicht allein theoretische Differenzen wider, sondern vor allem unterschiedliche Wahrnehmungen von Veränderungsprozessen einer komplexer werdenden Realität mitsamt sich ausdifferenzierender Klassenstrukturen und Klassenfraktionen sowie übergreifender Klassenbündnisse. Dann würde auch verständlicher, weshalb es je kontingente Transformationsstrategien (Kautsky, Luxemburg, Bernstein, später Lenin) gab. Doch anstatt ihre jeweilige wissenschaftliche Relevanz zu akzeptieren und zu versuchen, komplexe und nicht standpunktlogische Resultate in der Diskussion herbei zu führen wurde per Mehrheit abgestimmt im Sinne einer Selbstbestätigung. In diesem Sinne wäre dann Bernstein seiner Zeit weit voraus, und schaut man auf die Binnendiskussionen bei SPD und Linkspartei heute, so stehen auch diese in Bernsteins Schatten. Betrachtet man ergänzend Bernsteins Abhandlungen über Völkerpolitik, Völkerrecht und Völkerbund aus den Jahren 1917-1919, so setzt er nämlich Volk mit der Summe der Beherrschten eins; die herrschenden Klassen sind bei ihm die Besitzenden und die Reichen, die den Staat unter ihrer Fuchtel bzw. in ihrer Gewalt haben. Wem jetzt das Bild breiter antimonopolistischer Bündnisse ins Blickfeld gerät, liegt also auch bei Bernstein überhaupt nicht falsch. Hierin steckt womöglich Erkenntnispotenzial, das Strohschneider antippt, leider ohne es zu diskutieren. Aber dann wären sich an verschiedenen Punkten Bernstein und Luxemburg näher als bislang interpretiert. Ihre Widerspiegelung fände eine solche Feststellung nicht zuletzt in den Juso-Strategiedebatten und den Theoriediskussionen in SPD, SPÖ, PSF usw. in den sechziger und siebziger Jahren, in denen über eine Kette systemüberwindendender Strukturreformen und breite Bündnisse oder über Mindestschwellen von Vergesellschaftung und ›Systemgrenzen‹ gestritten wurde. Und schon vor 40 Jahren lagen die Positionen enger beieinander, als sie heißgeredet wurden. Zwischen Horst Heimann und Thomas Meyer einerseits und Wolfgang Abendroth und Detlev Albers andererseits lag in jedem Falle auch 1980 Trier, um Karl Kautsky zu zitieren.
Was an Strohschneiders Essay besticht ist vor allem die Rekonstruktion von Bernsteins Wirken aus dem Geist von Marx und Engels heraus und sein Hinweis auf die für ihn nicht beantworteten Fragen des Werkes von Marx, z. B. der Werttheorie. Dies zeigt m. E. deutlich, dass es Bernstein nicht um eine ›Revision‹ des Werkes von Marx und Engels ging, sondern um eine Fortentwicklung der theoretischen Positionen durch Überprüfung an der sozialen Praxis. Keine Abkehr vom Sozialismus, sondern eine Inventur. Es wird sich zeigen, ob Strohschneiders Bestreben, Bernsteins Aktualisierung zu forcieren, Erfolg haben wird. Will eine breit gefächerte Fortschrittsalternative Erfolg haben, kann sie gern auch bei Eduard Bernstein nachschlagen, der sicher einiges zu bieten hat, was eine umfassende Demokratisierung als Ziel und Methode beinhaltet. Seine Rezeption als Geschichte einer Verfemung jedenfalls dürfte an ihr Ende gekommen sein.
Das Essay ergänzen drei umfangreiche Aufsätze Bernsteins aus den Jahren 1901 bis 1911. Sie wurden vom Herausgeber deshalb ausgewählt, weil er darin gewährleistet sieht, Bernsteins Grundansätze am repräsentativsten vorzustellen. Es sind dies »Der Revisionismus in der Sozialdemokratie« (1909), »Wie ist wissenschaftlicher Sozialismus möglich?« (1901) und »Von der Sekte zur Partei« (1911). Im ersten Text, einem in Amsterdam gehaltenen Vortrag, erläuterte Bernstein den Hintergrund seiner viel zitierten Aussage, dass ihm das Endziel nichts und die Bewegung alles bedeute, näher: »Denn grundsätzlich hat meines Erachtens die marxsche Theorie die Idee vom Endziel gestürzt. Es kann für eine Gesellschaftslehre auf der Grundlage des Entwicklungsgedankens kein Endziel geben, die menschliche Gesellschaft wird nach ihr beständig dem Entwicklungsprozess unterworfen sein. Es kann aufgrund ihrer große Richtungslinien und Ziele, aber ein Endziel kann es nicht geben« (S. 81). Als Beleg führte Bernstein zwei Zitate aus dem Kommunistischen Manifest und aus dem ersten Band des Kapitals an. (Siehe Fn 17, Seite 81, und Fn 19, S. 83 im vorgestellten Text.) Es folgt anhand der Darstellung des Konzentrationsprozesses des Kapitals und der zunehmenden übernationalen Verflechtung mitsamt ihren Folgen eine Auseinandersetzung mit der ›Zusammenbruchstheorie‹, die sich aus der nach 1891 programmatisch fixierten Verelendungsvorstellung ergab. Nicht jedoch dieser Krisenverlauf sei eingetreten, vielmehr hätten die Krisenzyklen die Wirtschaftsentwicklung intensiviert und der Arbeiterbewegung durch deren Kämpfe eine stärkere Position in Wirtschaft, Gesellschaft und Recht ermöglicht. Bernstein leitete hieraus keinesfalls eine Abkehr vom Sozialismus ab, sondern lediglich die Feststellung, das der Weg dorthin stetiger und womöglich langsamer, aber sicherer verlaufen könne, wenn die Arbeiterschaft ihre Gesamtbedeutung durch Einigkeit weiter stärken könne. Zwar hat sich diese Erwartung spätestens 1914 bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges als viel zu optimistisch erwiesen, aber Bernstein stellte zu keiner Zeit die Rolle der Arbeiterbewegung und ihrer ›Internationale‹ als völkerbefreiende und dem Fortschritt verpflichtete Kraft in Frage, auch nicht mit Blick auf den Sozialismus. Allein eine Vorstellung, nach der der Weg in den Zukunftsstaat über ein »rotes Meer‹, also über Erlösungserwartungen, erreichbar sei, verwarf er (S.106).
Auch im zweiten Text, als Vortrag gehalten im Mai 1901 in Berlin, bemühte sich Bernstein um eine differenzierte Auseinandersetzung mit Analysen und Methoden von Marx und Engels. Er blieb stets nahe an den Originalen und unterzog deren Stellungnahmen einer Betrachtung aus dem historischen Abstand mit Blick auf die realen Entwicklungen. Die Frage »Wie ist wissenschaftlicher Sozialismus möglich?« beantwortete er mit dem Fazit: »Es ist soviel wissenschaftlicher Sozialismus möglich als nötig ist, d.h. als man vernünftigerweise von der Lehre einer Bewegung verlangen kann, die grundsätzlich Neues schaffen will« (S. 138). Dabei gelte: »Die Wissenschaft ist tendenzlos, als Erkenntnis des Tatsächlichen gehört sie keiner Partei oder Klasse an. Der Sozialismus dagegen ist Tendenz, und als die Doktrin einer für Neues kämpfenden Partei kann er sich nicht lediglich an schon Festgestelltes binden. Aber weil das Ziel, dem er entgegenstrebt, auf der Linie der gesellschaftlichen Entwicklung liegt (…) kann die Partei des Sozialismus, die Sozialdemokratie, mehr als jede andere ihre Ziele und Forderungen in Einklang setzen mit den Lehren und Anforderungen der für sie infrage kommenden Wissenschaften« (ebd.).
Bernstein lehnte es ab, mit a priori Interpretationen an Erkenntnisse heranzugehen, vielmehr befürwortete er ihre Aufnahme in Theorie und Praxis der Arbeiterbewegung. Darin bestand eine tatsächliche Differenz zu anderen Strömungen wie z.B. zur leninistischen, nach der Erkenntnis an sich schon klassenspezifisch zu gewinnen sei. Das zugrundegelegt, kann man heute besser nachvollziehen, weshalb z.B. leninistische Auffassungen vom Recht oder von der Natur eine Tendenz zur Ambivalenz oder Zirkelschlüssigkeit aufwiesen, denken wir z. B. an die sowjetischen Atomkraftwerke oder an die behauptete Alternativlosigkeit der ›Diktatur des Proletariats‹.
Der dritte Text »Von der Sekte zur Partei«, veröffentlicht in der Zeitschrift für Politik 1911, in dessen Zentrum u.a. das ›Erfurter Programm‹ steht, zeichnete Bernstein die Entwicklung der Sozialdemokratischen Partei seit den Nachbeben der Französischen Revolution nach, vom klandestinen Sozialismus eines Gracchus Babeuf über die utopischen Sozialisten von 1848 bis hin zur SPD seiner Gegenwart. Eine Kernaussage dieses Textes lautet: »Gewiss ist der Staat bei uns noch immer in hohem Grade zur Niederhaltung der arbeitenden Klassen, aber doch nicht in gleichem Grade und in gleicher Weise wie früher; wir sehen ihn auch am Werk, in seiner Gesetzgebung besitzenden Klassen Zügel anzulegen. Er ist, wie das Karl Marx im Vorwort zum ›Kapital‹ von der Gesellschaft sagt, kein fester Kristall, sondern ein der Wandlung fähiger Organismus«. Zur sozialdemokratischen Politik schrieb er, dass sie zu »neun Zehnteln« Reformarbeit ist. Diese habe »nie nach dem Satz gehandelt, dass es erst noch schlechter werden müsse, damit es gründlich besser werde« (S. 204-205). Bernstein beschloss seine Ausführungen mit der Bemerkung: »Die Sozialdemokratie ist die Partei der Arbeiter, aber nicht ausschließlich die Partei von Arbeitern. Es kann ihr jeder angehören, der ihre Grundsätze unterschreibt. Aber er muss begreifen, dass die Politik der Sozialdemokratie zum Leitfaden hat und haben muss die sozialen Bedürfnisse der Klasse, die kraft ihrer Lebensverhältnisse und Entwicklung heute der stärkste Träger dieser Grundsätze ist, und das ist die moderne Lohnarbeiterschaft« (S. 213-214).
Eduard Bernstein blieb stets Sozialist bis zu seinem Tode. Wie Tom Strohschneider in seinem Essay und in den ausgewählten Texten belegt, ist kein Verdammungsurteil gerechtfertigt. Vielmehr bietet Bernstein für eine zeitgemäße sozialistische Reformpolitik methodisch und inhaltlich qualifizierte Ansätze, die neuer Scheuklappen nicht bedürfen.