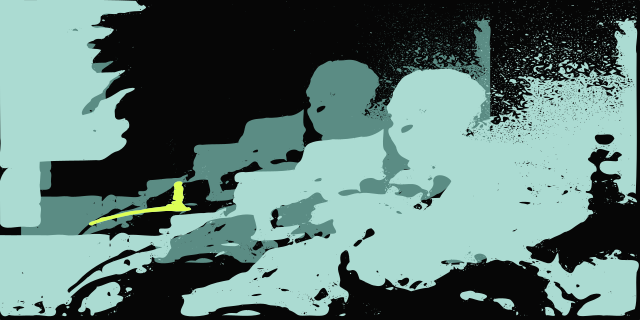von Frauke Geyken
«Ich selbst war auch in die Vorbereitungen zum 20. Juli verwickelt», so formulierte es Annedore Leber in einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1947. In ihren Augen war sie eine Widerstandskämpferin aus eigenem Recht und nicht nur die Witwe des hingerichteten Sozialdemokraten Julius Leber.
Eine Darstellung, die sich, das liegt in der Natur der Sache, nicht eindeutig überprüfen lässt, die aber als sehr plausibel gelten kann. Die Kohlenhandlung ihres Mannes in der Torgauer Straße in Berlin bot sich an als idealer Treffpunkt unzähliger Besprechungen, die dem Attentat des 20. Juli vorausgingen. «Aber auch das Telefon meines Büros [im Deutschen Verlag] diente als Mittler mancher Verabredung», so formulierte es Annedore Leber in einem Lebenslauf im dem Jahr 1945. Überliefert ist, dass Fritzi von der Schulenburg, einer der Mitverschwörer Stauffenbergs, Annedore Leber in der Schnittmusterabteilung des Deutschen Verlags besuchte, ihr Arbeitsplatz seit 1938, so dass auch andere Informantenbesuche oder -gespräche dort vorstellbar sind. Sie selbst sei «in alle Besprechungen eingeweiht und aufs höchste gefährdet gewesen». «Sie war eine Frau, die ihre Bedeutung nicht einfach daraus zog, dass sie die Ehefrau eines Mannes war. Sie war vollgültig», sagt Peter Brandt, der sie als Sohn von Willy Brandt, dem politischen Ziehsohn Julius Lebers, in Berlin kennengelernt hatte. Und Karl Dietrich Bracher bestätigte, dass sie ihr Schicksal als Witwe nicht vor sich hertrug. Es war, so scheint es, viel eher ihr Fundament.
Die Lebers waren genauso ein Powerpaar des deutschen Widerstands wie Helmuth James und Freya von Moltke; wie sie schlossen sich Julius und Annedore Leber in der gemeinsamen Überzeugung, für die richtige Sache zu kämpfen, eng zusammen und koste es das Leben. In einer Phase tiefer Trauer, die der Hinrichtung Julius Lebers am 5. Januar 1945 folgte, hatte Annedore Leber einen Entschluss gefasst: Sie würde die Nachlassverwalterin des Widerstands werden. Der Tod ihres Mannes durfte nicht umsonst gewesen sein, die Ziele, für die der Widerstand gekämpft hatte, sollte jetzt umgesetzt werden. In einer Rede vor der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit kurz nach dem Krieg formulierte Leber selbstbewusst: «Ich glaube also, daß ich den Anspruch habe, jetzt meine Stimme erheben zu dürfen.»
Und das tat sie. Unermüdlich. Als Journalistin, Politikerin, Autorin und Verlegerin war sie in der deutschen Nachkriegsgesellschaft präsent. Sie wollte ihre «Mitbürgerinnen und Mitbürger, die es in der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft» verlernt hatten, Verantwortung zu übernehmen, wieder zu mündigen Menschen erziehen. Dabei kam es «auf die Tat, die Gesinnung und Spannkraft des Einzelnen an». In einer Rede vor Parteigenossen, die aufgrund des brüchigen, braunen Papiers, auf dem sie gedruckt ist, auf die ersten Nachkriegsjahre zu datieren ist, machte sie dies an einem Beispiel deutlich. Leber berichtete von der Begegnung mit einer Frau, die in einem mit Flüchtlingen überfüllten Güterzug den Männern die Organisation ‹entriß› und das Chaos, so gut es ging, zu beseitigen verstand. Die Frau habe ihr erzählt, dass auch sie ein Opfer des Faschismus sei und sehr gelitten habe. Nun sei sie froh, dass die Zeit vorbei sei und sie werde jetzt an ihrem Platz das tun, was ihr möglich sei. «Aber Politik, nein, niemals wieder. Mögen sich die Männer darum kümmern, ich nicht.» Dies habe Annedore Leber zu leidenschaftlichem Widerspruch herausgefordert: «Gerade Sie besitzen doch Energie, Umsicht und noch dazu eine Überzeugung.» Da sei es geradezu ihre staatsbürgerliche Pflicht, Verantwortung zu übernehmen.
Frauen waren Lebers besondere Zielgruppe. In zahllosen Reden und Zeitungsartikeln appellierte sie an ihre Zeitgenossinnen, sich ihrer Kraft und ihrer Verantwortung bewusst zu werden. Ein Artikel im Telegraf, einer der ersten deutschen Zeitungen in Berlin, deren Lizenznehmerin sie war, trug den Titel ‹Nur Mut!› Mut und Selbstvertrauen für die politische Arbeit waren gemeint. Sie wandte sich dabei auch an diejenigen, die «Heim und Lebensglück in einer sinnlosen Katastrophe verloren» hatten. Denn dem Leben dieser Frauen könne, ganz so wie bei Annedore Leber selbst, die konstruktive Wiederaufbauarbeit einen neuen Sinn geben, umso mehr, als ihre Situation, anders als bei Annedore, aus einer ‹sinnlosen Katastrophe› resultierte. Sie drückte es zwar im Text nicht explizit aus, aber die Wahl dieser Formulierung verrät, dass sie sich außerhalb dieser Gruppe von Frauen stellte, diesmal nicht durch die Ablehnung der anderen, sondern in selbstgewählter Abgrenzung, denn das Opfer, das sie gebracht hatte, hatte einen Sinn. Diese Trennung war irreversibel und unaufhebbar. Annedore Leber stand schon seit 1933 auf der ‹anderen Seite› und hatte dies seitdem immer empfunden: «Nicht aber ist bei meinem Erleben zu unterschätzen, dass ich immer eine Abgestempelte, eine Ausgestossene war, gezeichnet durch den Mann, der im Konzentrationslager sass, zweifellos dadurch in der Gegnerschaft gegen Hitler verharrend.» Gerade deshalb, das hatte sie klar erkannt, erhielt die gemeinsame Arbeit für eine bessere Zukunft einen integrativen Charakter.
Frauen waren denn auch in erster Linie die Adressatinnen des Magazins Mosaik. Sehr früh, schon im Oktober 1947, erschien die erste Nummer dieser Zeitschrift, die Frauen ermuntern sollte, aktiv an der Gestaltung des neuen deutschen Staates mitzuwirken. Monat für Monat mischten sich Information, politische Bildung, Unterhaltung, Literatur mit höchst praktischen Fragen wie einem Fahrplan durch die Kinderkrankheiten (Mosaik Mai 1948). Man wolle diese ‹Zeit anpacken› und genauso pragmatisch wie es klingt, so war es auch gedacht. Man wollte Lust am Aufbruch vermitteln.
Jedes Heft begann mit einer Seite politischer Meldungen aus aller Welt und aus Deutschland. Es folgte die Rubrik ‹Wir debattieren› z.B. über Gewerkschaften (Mosaik Jan. 1948) oder über die Frage ‹Warum bin ich in meiner Partei?› (Mosaik Mai 1948). Neben Leber selbst schrieben hier die Akteure der Berliner Nachkriegspolitik wie Ernst Reuter, die darüber hinaus Essays verfassten zu Themen wie ‹Über die Freiheit› (Mosaik Nov. 1947) oder über ‹Politik und Gewissen› (Mosaik Nov. 1947). Natürlich durfte zum Jahrestag des Attentats ein Artikel über den Widerstand nicht fehlen: ‹Vor vier Jahren. Der Hintergrund der Verschwörung gegen Hitler und letzte Briefe› (Mosaik Juli 1948). Er stammte aus der Feder von George Bell, des Bischofs von Chichester, ein Freund von Dietrich Bonhoeffer und Gerhard Leibholz und einer der wenigen Unterstützer des deutschen Widerstands in Großbritannien.
Den Leserinnen wurden gezielt Vorbilder präsentiert u.a. mit der Biographie einer der prominentesten politisch aktiven Frauen der Zeit, ‹Eleanor Roosevelt›; aber auch die ‹Betrachtungen über Parlamentarierinnen›, die Annedore Leber anstellte (Mosaik 3/1949) dienten diesem Zweck, oder die Besuche bei den Gattinnen der alliierten Repräsentanten ‹Mrs. Clay› (Mosaik Okt. 1948), ‹Lady Robertson› (Mosaik Nov. 1948) und ‹Madame Koenig› (Mosaik Dez. 1948).
Probleme, mit denen Leber als Politikerin konfrontiert war, griff sie als Herausgeberin auf, hier vor allem die schwierige Situation der vielen Kriegerwitwen. Wie konnte den alleinerziehenden Frauen, die gezwungen waren, zu arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, aber oft viele Kinder hatten, geholfen werden? Eine praktische Lösung bot der Artikel ‹Frauenstadt - Frauenstaat?› (Mosaik Juni 1948), in dem ein Architekt einen Stadtteil für Frauen entwarf. Dieses ‹Bauprojekt als soziale Hilfsmaßnahme› sah eine für uns höchst modern anmutende organisierte Wohngemeinschaft für alleinstehende Frauen mit Kindern vor, in dem Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Kinderbetreuung nah beieinander liegen sollten. Ähnliche Gedanken machte sich Max Taut wenige Monate später im Beitrag ‹Billig bauen – praktisch wohnen› (Mosaik Okt. 1948). Den Verkauf befördern sollten sicherlich die jedem Heft beigelegten Schnittmusterbögen, Annedores altes Metier, und Texte wie der ‹Modebrief aus New York› (Mosaik Jan. 1948), der Vorschlag ‹Gestrickt und gehäkelt› (Mosaik Feb. 1948) und die Forderung ‹New look für alle› (Mosaik Dez. 1948).
Im Sommer 1949 erschien die letzte Nummer der Zeitschrift. Warum der Betrieb eingestellt werden musste, ist nicht ganz klar. Möglicherweise hatten die Umstellungen der Währungsreform 1948 das Unternehmen in Schwierigkeiten gebracht. Aber Annedore Leber ließ sich nicht entmutigen. Wenige Jahre später gründete sie ihren eigenen Verlag, den Mosaik-Verlag, um auf diesem Weg ihr Ziel, das Erbe des Widerstands für die junge deutsche Demokratie fruchtbar zu machen, weiterzuverfolgen.
Ganz am Anfang dieses Projekts standen jedoch keine politischen Publikationen, sondern Broschüren, die in sehr hohen Stückzahlen aufgelegt werden konnten, um dem Verlag eine finanzielle Ausgangsbasis zu schaffen. Neben einer Broschüre ‹Der Bürger und sein Stadtparlament› (1951, 100.000 Exemplare) und einem 32-seitigen Heft ‹Olympische Augenblicke› (1951, 100.000 Exemplare) waren das auch so schöne Titel wie ‹Huhn und Ei›, der 1951 mit 3.000 Exemplaren auf der Grünen Woche in Berlin verteilt wurde und insgesamt auf eine Auflage von 100.000 Stück kam. In der Zeit vom 13. September 1951 findet sich eine Anzeige des Mosaik-Verlags: «Ein ‹Tagebuch für Bauer und Landfrau› zum Preis von 1,25 DM. Es verlangt täglich fünf Minuten Zeit und bietet dafür eine Fülle von Erleichterungen.» Das Tagebuch schickte man, je 150 bzw. 100 Stück, so geht es aus den Akten hervor, an Landwirtschafts- und Landfrauenschulen in ganz Deutschland.
Das erste Buch, das 1952 im Mosaik Verlag erschien, war ‹Ein Mann geht seinen Weg›. Zusammen mit dem ehemaligen sozialdemokratischen Weggefährten und Widerstandskämpfer Gustav Dahrendorf gab Annedore Leber Schriften, Reden und Briefe von Julius Leber heraus: Leber sollte Vorbild sein für die junge Generation. Julius Leber hätte, davon war seine Frau fest überzeugt, in der bundesdeutschen Nachkriegspolitik eine herausragende Rolle gespielt: «Ich glaube, dass seine Person die ist, die der deutschen Geschichte bisher gefehlt hat.»
Ob allerdings die Widerstandskämpfer, hätten sie überlebt, in der Politik nach 1945 so erfolgreich geworden wären, wie Annedore Leber sich das vorstellte, ist keineswegs sicher. Denn ein umfassender Mentalitätswandel hatte in Deutschland noch nicht stattgefunden. Diejenigen, die ihre Leben geopfert hatten für diesen neuen deutschen Staat, galten in den Augen vieler Zeitgenossen als Landesverräter: Sieben Jahre nach dem Attentat sprachen sich nur 45% der deutschen Bevölkerung für eine positive Bewertung der Männer des 20. Juli aus, 34% dagegen und die restlichen 21% waren unentschlossen in ihrer Beurteilung der Vorgänge vom Sommer 1944. Differenziert man die Umfrage vom August 1951, so fällt auf, dass es vor allem Männer (40%) waren, die diese ablehnende Haltung einnahmen, der Frauenanteil aber nur 28% betrug. In der Aufschlüsselung nach Alter ist festzustellen, dass sich junge Leute zwischen 16 und 29 Jahren auf die Frage: ‹Wie soll man Ihrer Ansicht nach die Männer vom 20. Juli beurteilen?› zu 40% negativ äußerten, während diejenigen, die 60 Jahre und älter waren, nur zu 31% diese Einschätzung teilten. (Allensbach-Umfrage). Einen Monat zuvor, im Juli 1951, fand sich ein kurzer Text auf der Titelseite der Wochenzeitung Die Zeit, der diese Stimmung mit folgenden Worten bitter kommentierte: «Sieben Jahre – und die ‹Verräter› von damals gelten beinahe schon wieder als ‹Verräter›. Vergessen sind die Zeiten, da das Leben und der Tod dieser Männer vereinsamt in der Aktiva-Spalte des Hauptbuches deutscher Geschichte standen, einem unermeßlichen Schuldkonto gegenüber. In Deutschland geht es wieder aufwärts. Der Neo-Nazismus marschiert. Generäle, die 1944 in jenem ‹Ehrengericht› saßen, das die Kämpfer gegen den Tyrannen mit Schimpf und Schande aus der deutschen Armee stieß, führen wieder das große Wort. ... Wenn diese Entwicklung weitergeht, werden die Überlebenden des 20. Juli spätestens den zehnten Jahrestag ihres Aufstandes gegen die Diktatur als Emigranten im Ausland erleben.»
Wie Annedore Leber kämpfte auch Die Zeit, allen voran Marion Gräfin Dönhoff, um die Anerkennung der Leistungen des Widerstands. Beide Frauen waren fest entschlossen, diese negative Haltung ihrer Mitbürger durch journalistische Aufklärung zu verändern. Jedes Jahr zum 20. Juli erinnerte Dönhoff mit einem großen Artikel an die Ereignisse, ein Gedenken, das schließlich 1964 in dem Satz gipfelte: «Hat irgend ein Volk größere Helden als diese?»
Einen offiziellen Fürsprecher hatte der Widerstand in der Bundeszentrale für Heimatdienst, die 1952 gegründet wurde (ab Mai 1963 Bundeszentrale für politische Bildung). Die Bezeichnung nahm Bezug auf die Reichszentrale für Heimatdienst, die es in der Weimarer Republik gegeben hatte und deren Vorläufer die Zentrale für Frontdienst gewesen war. Deren Aufgabe hatte in staatlich gelenkter Propaganda für die Stärkung des Durchhaltewillens der Bevölkerung im Ersten Weltkrieg bestanden. Diese Propaganda war wohl der einzige Anknüpfungspunkt, der die Verantwortlichen zu dieser Namensgebung veranlasste, für eine Institution, die jetzt «den demokratischen und den europäischen Gedanken im deutschen Volke [...] festigen und [...] verbreiten» sollte. Jedoch gab man sich seitens der Regierung keiner Illusion hin, die Arbeit der Bundeszentrale «sei gewiß im Augenblick kaum mehr als ein Versuch, doch müsse er gemacht werden, weil es darauf ankomme, auf längere Sicht die allzu vielen Abseitsstehenden im Volk in unauffälliger Weise für den Staat zu gewinnen oder doch für ihn zu interessieren». Von den insgesamt 57 Publikationen, die hier in den nächsten elf Jahren erschienen, befassten sich sechs mit dem 20. Juli 1944.
Obwohl die breite Anerkennung des Widerstandes noch jahrzehntelang ausblieb, gab es ein deutliches Interesse am Thema selbst. Als die ersten Bücher darüber erschienen, die anfangs nur in der Schweiz hatten publiziert werden dürfen, fragte man, was möglich gewesen war, wie Widerstand hätte aussehen können. Bereits 1949 war der ursprünglich auf Englisch erschienene Band von Hans Rothfels, ‹Die deutsche Opposition gegen Hitler›, in einem Krefelder Verlag herausgekommen. 1952 erschien Inge Scholls Buch ‹Die Weisse Rose›, mit dem sie zu ihrer großen Erleichterung den bis dahin sehr erfolgreichen Roman ‹Es waren ihrer sechs› des Emigranten Alfred Neumann vom Markt verdrängte. 1953 brachte Günther Weisenborn ‹Der lautlose Aufstand› heraus. Das Buch, mit dem Untertitel ‹Bericht über die Widerstandsbewegung des deutschen Volkes, 1933 – 1945› basierte zum Teil auf den Vorarbeiten von Ricarda Huch, die schon 1945 damit begonnen hatte, ein Erinnerungsbuch über die ‹Märtyrer› des deutschen Widerstands zu schreiben, das sie jedoch nicht mehr fertigstellen konnte. Sie starb 1947. 1954 erschien eine Sammlung von Abschiedsbriefen, ‹Du hast mich heimgesucht bei Nacht›. Käthe Kuhn, die zusammen mit ihrem Mann, dem Philosophen, Helmut Kuhn 1949 nach Deutschland zurückgekehrt war, gab diese Anthologie gemeinsam mit dem Schriftsteller Reinhold Schneider und dem Theologen Helmut Gollwitzer heraus. Wie Ricarda Huch, so bekam auch Käthe Kuhn 1954 nach dem Erscheinen ihres Buches zahllose Briefe von Angehörigen, die ihre große Dankbarkeit bezeugten. Die berührenden Texte sprechen für sich, und so konnte das Buch eine positive und überzeugende Stimme des Widerstandes werden, die der Verleumdung entgegentrat. Die Vorsitzende der Bahnhofsmission schrieb aus Hannover an Kuhn: «Meine Schwester sagte so schön: Es ist für mich wie eine Bibel, in der ich lese und voller Anbetung mich hinein vertiefe.»
1958 wurde schließlich auch das Buch des ehemaligen Mitarbeiters von Henning von Tresckow, Fabian von Schlabrendorffs ‹Offiziere gegen Hitler›, publiziert. Es war, wie Rothfels` Buch, zunächst in Deutschland nicht zugelassen worden und erlebte, wie alle genannten Werke, zahlreiche Auflagen mit großen Stückzahlen, die in die Zehntausende gingen.
So erging es auch Annedore Lebers ‹Das Gewissen steht auf›. Es erschien 1954 und war sofort enorm erfolgreich, die Auflagen gingen schließlich in die Hunderttausende. Schon kurz nach dem Krieg hatte man Leber die Fotos angeboten, die in Goebbels Auftrag während der Verhandlungen am Volksgerichtshof von den Angeklagten gemacht worden waren. Es ist sehr gut möglich, dass der Fotograf, der an diesen Aufnahmen beteiligt gewesen war, Widerstand mit Annedore Leber verband, der Nachlassverwalterin des Widerstands, und deshalb versuchte, sie gerade ihr zu verkaufen. Dieser Fundus gab Leber die Idee ein, daraus ein Buch mit kurzen biografischen Skizzen von Widerstandskämpfern und -kämpferinnen zu machen, die schließlich noch über das Ursprungsmaterial hinausgingen. Leber nahm Kontakt mit Widerstandsfamilien auf, um weitere Photos und Informationen zusammenzutragen. In Zusammenarbeit mit Willy Brandt und dem Politikwissenschaftler und Historiker Karl Dietrich Bracher entstanden Lebensläufe, die persönlich gehalten werden und keine Heroen darstellen sollten. «Als Leitmotiv möchte ich den Gedanken durchziehen lassen: Es ist der Wert unserer abendländischen Kultur, dass der Einzelne aus der Reihe tritt, um für das Recht, Leben und die Seele des Mitmenschen einzustehen.» In den sieben Kapiteln des ersten Bandes werden 64 Männer und Frauen vorgestellt (68 im zweiten, s.u.). Ein kurzer Einleitungstext beschreibt jeweils Situation, Motivation und Ziele der Widerstandskämpfer. Dann folgt eine zusammenfassende Lebensbeschreibung der Einzelnen, Darstellung der Widerstandstätigkeit, bisweilen Briefe, Dokumente und abschließend ein ganzseitiges Foto des oder der Betreffenden.
«Denken Sie nur, die zweite Auflage unseres Buches war diesmal schon in 10 Tagen vergriffen», konnte Annedore noch im Erscheinungsjahr dem Schriftsteller Kasimir Edschmid berichten.
Nur einem gefiel dieser Erfolg überhaupt nicht, dem Publizisten Walter Hammer, und zwar aus einem besonderen Grund: Annedore Leber war ihm zuvorgekommen mit ihrer Publikation. Hammer verfolgte ähnliche Ziele wie Leber, wollte als Journalist aufklären und erzieherisch wirken. Er hatte selbst im Konzentrationslager gesessen, war anschließend zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, die er in Brandenburg-Görden verbrachte. Nach Kriegsende blieb er zunächst im Osten, weil man ihn beauftragt hatte, ein Archiv und Museum zu Ehren der politischen und religiösen Opfer des Zuchthauses aufzubauen. Nachdem er sich mit den Auftraggebern überworfen hatte, floh er in den Westen unter Zurücklassung fast seines gesamten Materials. 1956, zwei Jahre nach Lebers ähnlich konzipiertem Buch, veröffentlichte er mit ‹Hohes Haus in Henkers Hand› eine «Rückschau auf die Hitlerzeit, auf Leidensweg und Opfergang deutscher Parlamentarier». Er ließ keine Gelegenheit aus, sich abfällig über die Konkurrenz zu äußern. So schrieb er an die Autorin Käthe Kuhn: «Über das grausige Machwerk von Annedore Leber hat es nach anfänglicher Begeisterung eine große Ernüchterung gegeben. Ich bin nach wie vor der Meinung, daß es an Leichenschändung grenzt, die Bilder der Hingerichteten nach dem Geschmack des Kurfürstendamms zurechtzumachen.» Walter Hammer bekam 1953 das Bundesverdienstkreuz für seine Verdienste um die Erforschung des Widerstandes. Annedore Leber hat nie einen Orden erhalten. Hammer blieb allerdings einer der wenigen Kritiker von Lebers Buch; es wurde 1954 zum schönsten Buch des Jahres gekürt, und die Rezensionen lobten es überschwänglich. Marianne Leibholz, die Nichte Dietrich Bonhoeffers, sagt rückblickend: «Das hätte man in jedem Wartezimmer auslegen müssen.»
1957 erschien der zweite Band der biographischen Sammlung ‹Das Gewissen entscheidet›. Ab 1956 arbeitete Annedore Leber zusammen mit Freya von Moltke an einem Schulbuch, das 1960 unter dem Titel ‹Für und Wider› erschien. Es war eine Darstellung der jüngsten Vergangenheit für junge Leser und behandelte die Weimarer Republik und die Zeit des Nationalsozialismus.
Inzwischen war Leber Bezirksverordnete von Berlin-Zehlendorf (1954–1962), nachdem sie von 1946-1950 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Berlin gewesen war; ab 1963 bis 1967 war sie schließlich Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Seit 1955 war sie auch im Personalgutachter-Ausschuss für die Streitkräfte, außerdem Mitglied der deutschen UNESCO-Kommission.
Mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln setzte sie sich für den Aufbau der neuen deutschen Demokratie ein. Neben den Frauen galt vor allem den Jugendlichen ihr besonderes Augenmerk. Insofern war es nur folgerichtig, dass sich Annedore Leber entschloss, den Vorsitz des Vereins Handwerker-Lehrstätte e.V. in Berlin-Britz zu übernehmen, denn Ausbildungs- und Arbeitsplätze waren für sie Grundlagen, um die Demokratie zu festigen. Ab Juli 1953 konnten 140 Jugendliche in Berufen der Metall- und Holzverarbeitung ausgebildet werden, 60 Mädchen erhielten Hauswirtschaftsunterricht. Nachdem sich die Ausbildungssituation in Berlin verbessert hatte, wurde die Lehrstätte zu ihrem zwanzigjährigen Jubiläum 1969 in ‹Annedore-Leber-Ausbildungsstätten Britz› umbenannt. Es kam zu einer Schwerpunktverlagerung, fast 400 behinderte Jugendliche konnten jetzt hier handwerklich ausgebildet werden. 1974 wurden die Werkstätten als ‹Annedore-Leber-Berufsbildungswerk› neu gegründet.
Zu diesem Zeitpunkt war Annedore Leber bereits sechs Jahre tot. Ihr kompromissloser Einsatz, den sie unbeirrt von sich forderte, obwohl gesundheitliche Probleme sie zu mehr Rücksichtnahme auf sich selbst hätten veranlassen müssen, führte wohl dazu, dass sie am 28. Oktober 1968 mit nur vierundsechzig Jahren starb. Eine große Beerdigung mit vielen Trauergästen auf dem Berliner Waldfriedhof Zehlendorf war die letzte Ehrung, die der Widerstandskämpferin zu Teil wurde, wenig später war der Name Annedore Leber fast völlig in Vergessenheit geraten. Die – notwendige und überfällige - Konzentration der post-1968er-Gesellschaft auf die Erforschung der NS-Täter drängte das Thema Widerstand zunächst in den Hintergrund. Als man sich im Zuge einer allgemeinen Neuorientierung der Erforschung des Nationalsozialismus im Laufe der 1980er Jahre auch dem Widerstand neu und anders näherte, war Annedore Leber schon zu lange tot. Aber es lohnt sich, diese authentische, überzeugte und aktive Demokratin neu zu entdecken.