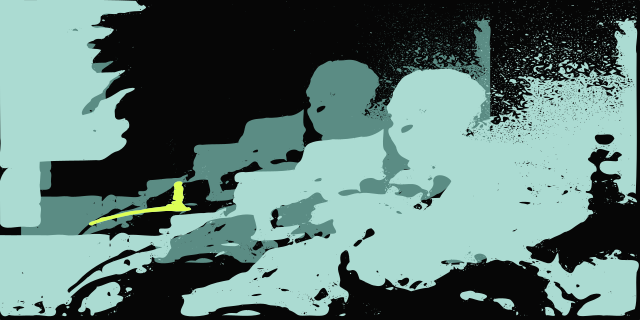von Ulrich Siebgeber
Marian Adolf: Die unverstandene Kultur. Perspektiven einer Kritischen Theorie der Mediengesellschaft, Bielefeld (transcript) 2006, 286 S.
Steigerung des Bewusstseins
Ein Hauch von Schlichtheit umweht dieses bei transcript erschienene, hübsch verpackte Büchlein, das vollmundig eine kritische Medienwissenschaft fordert und mit einiger Emphase einmal mehr die irgendwie kritische These von der (Medien-)Kultur als »sozialem Prozess« - gegen wen? die Konsumenten? - zu deklinieren verspricht. Kritisch wirkt aber vor allem die Häufigkeit, mit der das Wörtchen ›kritisch‹ den schlecht redigierten, von redundanten Zitatketten wie von tückischen Wasserläufen und Sickerzonen durchsetzten Text heimsucht. Die intendierte Anknüpfung an die Kritik der Kulturindustrie alter Frankfurter Provenienz und die marxistischen Wurzeln der Cultural Studies findet mangels eigener theoretischer Masse nicht statt, ebenso wenig eine begriffliche Auseinandersetzung mit dem radikalen und weniger radikalen Konstruktivismus, der, wie in kritischen Kreisen üblich, als Beschreibungsfundus herhalten muss, um den Ernst der Lage zu unterstreichen. Das Abnicken alter und neuer Befunde ergibt keine Theorie.
Weiterlesen …