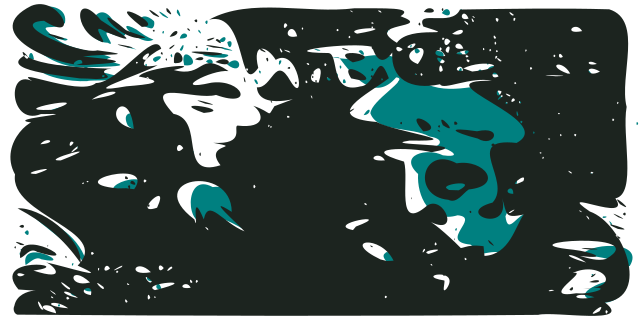von Ulrich Siebgeber
Für die Nüchternen kam die Botschaft von der totalen Überwachung der digitalen Datenflüsse durch staatliche Informationsbeschaffer der westlichen Hemisphäre nicht überraschend. Diese Nüchternheit, die sich mit ein wenig Herablassung gegenüber den in ihren Überzeugungen weniger solventen Zeitgenossen paart, ist vielleicht bereits ein Teil des Problems und nicht einmal das geringste, da sie ebenso wenig auf Wissen beruht wie das schlichte Vertrauen auf die rechtliche Sinnesart der staatlichen Organe, also vorgreifend nur die Empörung abschöpft, die sich an solchen – notwendig vage bleibenden – Einsichten der Öffentlichkeit bildet.
Mit der Nüchternheit geht es nicht anders als mit den Metadaten der digitalen Medien. Wo immer Bedarf entsteht, kommt es zu Weiterungen: einem Mehr an (inhaltlicher) Informationsabschöpfung im einen, an diversen Modi politischer Dissonanz im anderen Fall. Niemand täusche sich da: das virulente ägyptische Dilemma – Demokratie oder Freiheit – ist auch der Überwachungsfrage inhärent. Wenn eine Mehrheit, zufrieden oder nicht, es ganz der Ordnung entsprechend findet, in ihren Alltagsverrichtungen nicht bloß an den üblichen neuralgischen Punkten, sondern, wie der Ausdruck lautet, ›flächendeckend‹ kontrolliert zu werden, dann hat sie die betreffende Ordnung – in Gedanken und in praxi – bereits in etwas transponiert, das sie, in der Ordnung rechtlich-staatstragender Gedanken, nicht sein darf. Das Einverstandensein mit dieser Form der Überwachung bezeugt Gesinnungen, die es verdienen, überwacht zu werden. Darum sind die üblichen Weisen des Einverstandenseins im politisch-sozialen Sinn paranoid. Und zwar gleichgültig, ob sie sich als Nichteinverstandensein (»natürlich nicht!«) maskieren oder ob sie die Karte des braven Bürgers ausspielen, der nichts zu verbergen hat (und dies auch von den lieben Mitbürgerinnen erwartet), aber selbstverständlich beim Gedanken an Wirtschaftsspionage von der Sorge um die heimische Ökonomie geschüttelt wird und sofortige Gegenmaßnahmen verlangt. Nein, die Wirtschaft hat nichts zu verbergen, der Staat übrigens auch nicht, Betriebsgeheimnisse ausgeschlossen, die stehen auf einem anderen Blatt.
Dass die private Ausspähung lange als Ärgernis aufgefasst werden konnte, hatte ja nichts damit zu tun, dass die werten Mitmenschen sich in ihrem Innersten ertappt gefühlt hätten, sondern damit, dass ihnen die gegen unendlich schwappende Werbeflut vor der eigenen Haustür und im Mail-Eingang lästig wurde. Seit es Programme gibt, die Browser und Mailbox halbwegs clean halten, hat sich bekanntlich auch die Privacy-Bewegung in ihr Gegenteil verkehrt, und die atemberaubende Offenherzigkeit des Web 2 resultiert nicht zuletzt aus der Lust der Ausgespähten, selbst auszustellen, was als Archivmaterial sonst im Zugriffsbereich unbefugter oder befugter Unbefugter vor sich hindümpeln würde.
Gäbe es nicht diese Fähigkeit der Massen, Friktionen aller Art in Lebensgefühl zu verwandeln und private Bedrückung über kollektiven Ausdruck abzufackeln, dann könnte neben dem sogenannten Fortschritt auch die kommerzielle Popularkultur einpacken. Ähnliches gilt für die Akzeptanz einer Regierungskunst, der beim Ritt auf dem Tiger die Gehwerkzeuge verkümmerten, so dass sie nun nicht mehr herunterkommt. Es könnte ihr auch niemand herunterhelfen. Wo die Machbarkeitsstudien den Folgenanalysen davonlaufen, fällt es schwer, Technikern den Zutritt zum Allerheiligsten zu verwehren. Der Mensch ist das Wesen, das sich arrangiert.
Gern möchte man Zeitgenossen, die, Arroganz in der Stimme, ihren Mitbürgern Netzabstinenz empfehlen, um das Problem zu entschärfen, den Spiegel ihres eigenen, ins Halbbewusste hinabreichenden Konsums, vor allem aber der Produktion vorhalten, als deren Rädchen ihre Stimmchen vernehmlich werden. Hauptsache, ihr Vermögen ruht in gehärteten Tresoren, an denen kein Informationsfluss nagt. Eine seltsame Vorstellung geben bei alledem die sogenannten Printmedien, die mit mehr oder weniger ökonomischem Erfolg ihre Dependancen im Netz betreiben und seit Jahrzehnten herunterquatschen, was so lange nicht als tragfähig gelten darf, bis der Wind des Wandels ihnen die letzten Krücken wegbläst. Sie haben gewarnt: soll heißen, ihre professionellen Warner haben neben den üblichen Artikeln bunt dekorierte Bestseller geschrieben und über die üblichen Netzkanäle vertrieben, in denen eine mehr oder weniger umfangreiche Dämonologie des Informationszeitalters auf das eingeschüchterte Publikum losgelassen wurde - alles nach dem Motto: besser, die Dämonen sind los, als dass die Bevölkerungen ihren Regierenden auf die Finger schauen. Richtig ist, dass es schwer fällt, jemandem auf die Finger zu sehen, der sie verdeckt hält. Aber auch das wäre keine ganz neue Erfahrung.
Niemand kommt um die Einsicht herum, dass, was in diesen Wochen ans Licht getreten ist und jedem Nicht-Blasierten die Sprache verschlägt, in der Zentrale entschieden wurde und weiterhin wird. Die USA haben sich – u.a. mit Hilfe des Patriot Act – eine begrenzte, jedoch wirkungsvolle Form des Ausnahmezustandes geschaffen und es ist wohl keinerlei Regung in Sicht, die darauf hindeutete, dass sie sich dieses Instruments so bald wieder entledigten. Das Wahlvolk ist dabei kaum mehr als Publikum. Niemand, der nicht über Spezialkenntnisse verfügt, kennt die Regeln, nach denen das weltumspannende Spionagespiel heute gespielt wird. Auch auf dem Feld der Bedrohungsanalysen sehen die Bewohner dieser Hemisphäre keineswegs klar. Insofern fehlt ihnen eine wesentliche Grundlage für Urteile, die auch auf diesem Feld der politischen Willensbildung vorausgehen müssten. Andererseits sollte keiner so tun, als hebelten die neuen Kommunikationsmedien und ihre technischen Eigenheiten per se Prinzipien aus, deren Geltung über Jahrhunderte, darunter in blutigen Weltkriegen und friedlichen Revolutionen, erkämpft und bekräftigt wurden. Der begrenzte Überwachungsstaat ist eine Notwendigkeit und ein Übel, der unbegrenzte ganz sicher ein Übel, in dem die Notwendigkeit sich in ihr Gegenteil verkehrt: eine Anomalie der Geschichte, solange sie auch andauern mag.
Abb.: Spigget, Dispersive Prism Illustration. Quelle: Wikimedia Commons