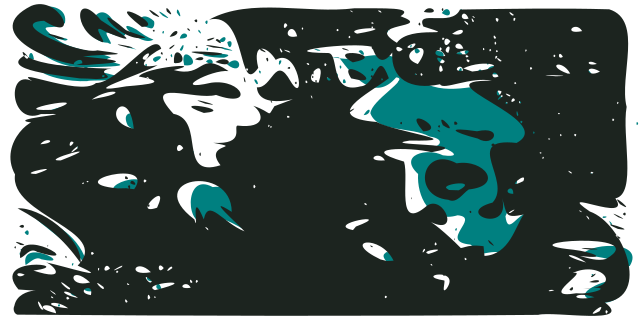von Heinz Theisen
Der Westen braucht eine neue Strategie
Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 und den gescheiterten Versuchen zum Aufbau einer von den USA geführten liberalen Weltordnung steht die Welt ohne erkennbare Ordnungsstrukturen da. Henry Kissinger sieht uns zwischen drohendem Chaos und einer noch nie dagewesenen Interdependenz lavieren (Henry Kissinger, Weltordnung, München 2014, S.10).
Die Staaten stehen nicht mehr nur anderen staatlichen Mächten, sondern einer Vielzahl von transnationalen Prozessen, global agierendem Kapital, asymmetrisch kämpfenden Terroristen, Schleppern, Drogen- und Menschenhändlern gegenüber, die sich der staatlichen Autorität zu entziehen trachten. Im 21. Jahrhundert ist nicht mehr ihre Stärke, sondern ihre Schwäche das Problem. Umso mehr wird eine Neuordnung der Staatenwelt gebraucht.
Der Westen hat sowohl durch neoliberale Globalisierung als auch durch neokonservativen Imperialismus und zudem durch idealistischen Universalismus, dem Glauben an die weltweite Gültigkeit unserer Werte und demokratischen Strukturen, erheblich zur heutigen Weltunordnung beigetragen. Diese denkbar große Koalition des Universalismus hat den Westen zunächst nach außen und zunehmend nach innen überdehnt, andere Kulturen und viele ihrer eigenen Bürger überfordert.
Dialektisch ist es leicht erklärbar, dass darüber Rufe nach neuen Begrenzungen aufkommen. Linke und rechte Globalisierungskritik, der grassierende kulturelle Identitätswahn im Orient und die Angst um die eigenen sozialen Interessen im Westen sind Folgen von Überdehnung und Entgrenzung. Die Versuche, die Ängste durch Ausgrenzung aus dem Diskurs zum Schweigen zu bringen, drohen in deren zunehmender Radikalisierung zu enden.
Mit dem Brexit und Trump ist diese Strategie gescheitert. Von der angelsächsischen Welt hatte die neuere Globalisierung ihren Ausgang genommen und von dort könnte sie auch ihr Ende nehmen. Statt multilateraler Freihandelsabkommen, ob innerhalb Europas oder der USA mit asiatischen Staaten, wollen Briten und die USA in Zukunft vornehmlich bilaterale Abkommen abschließen. Sie sollen jeweiligen Verhältnissen besser angepasst sein, könnten aber auch in den Nullsummenspielen nationalen Vorteilsdenkens enden.
Im Übergang von Obama zu Trump drohen Internationalismus und Universalismus in ihr Gegenextrem eines neuen Partikularismus umzuschlagen. Jenseits des letztlich utopischen Universalismus drohen regressive Nullsummenspiele durch Nichtbeachtung der Interdependenzen die derzeitige Weltunordnung ins Chaos zu treiben.
Die Sackgasse des Universalismus
Das Scheitern des Westens jenseits seiner Grenzen spricht nicht gegen westliche Werte, aber gegen unsere Fähigkeit, diese Werte zu universalisieren. Sein Universalismus hat den Westen in die Gegnerschaft zu den vielen Mächten getrieben, die seinen Werten nicht gerecht werden. Trotz aller ökonomischer Interdependenzen (Stichwort: ›Chimerika‹) verschlechtern sich die politischen Beziehungen zwischen den USA und China fortwährend, weil die USA auch China immer noch keine Einflusssphäre in Südostasien zugestehen, sondern es eindämmen wollten.
Weite Teile der Welt sind längst der amerikanischen Einflusssphäre entglitten. Abstiege einer Weltmacht sind in der Geschichte oft in Abstürze übergegangen. Es wäre viel erreicht, wenn der relative Niedergang des Westens in einer multipolaren Ordnung aufgehoben würde. Barack Obamas Wahl aus dem politischen Nichts heraus ist erklärbar als Gegenthese zur neoimperialen Überdehnung des ›weißen Mannes‹. Er war einer der wenigen Senatoren, die gegen den Irakkrieg gestimmt hatten. Zum Helden des Rückzugs ist er nicht geworden.
Mit der Dämonisierung der säkularen Diktatur Baschar al-Assads entlang der normativen Alternative ›Demokratie oder Diktatur‹ wurden erneut westliche Kategorien in den Nahen Osten getragen, in dem in Wirklichkeit die Konfessions- und Machtkriege zwischen Sunniten und Schiiten oder auch zwischen Stämmen und Ethnien ausschlaggebend sind. Die zwangssäkularisierten Staaten konnten nur unter Diktaturen zusammen gehalten werden. Schon durch Versuche zu ihrer Demokratisierung zerfallen sie entlang ihrer partikularen kulturellen Identitäten. West-östliche Verstrickungen bringen allzu oft das Gegenteil von Ordnung, nämlich blanke Absurdität hervor.
Zur Tragik einer Weltpolizistenrolle gehört auch, dass ein vorzeitiger Rückzug den Schaden noch weiter vergrößert: Dies war bei Amerikas Rückzug aus Europa nach dem Ersten Weltkrieg der Fall und wiederholt sich heute im Nahen Osten. Jetzt müssen die USA zusehen, wie das Machtvakuum in der Levante sowohl von totalitären Islamisten als auch von Russland und vom Iran gefüllt wird.
Obamas Versuche, das interkulturelle Narrativ mit dem liberalen Universalismus des Westens zu verbinden, wären die Quadratur des Kreises gewesen. Sie führten ihn und den Westen zwischen alle Stühle, in Syrien kämpfen amerikanische Piloten gegen den Islamischen Staat, aber nicht für Assad, neben, aber nicht mit Russland und auch nicht mit dem Nato-Partner Türkei, sondern zugunsten ominöser ›demokratischer Rebellen‹, die zahlenmäßig kaum eine Rolle zu spielen scheinen. Es ist auch im nachhinein keine klare Strategie jenseits einer größeren Zurückhaltung zu erkennen.
Die Rückkehr der heutigen Türkei in despotische Politikformen signalisiert das Scheitern von interkulturellen Hoffnungen. Doppelstaatler wie die Deutschtürken drohen sich zwischen den Kulturen zu verstricken, sie können etwa im Falle einer Verhaftung in der Türkei keinen vollen konsularischen Schutz beanspruchen. Der interkulturelle Staatsbürger führt im Falle der gleichzeitigen Zugehörigkeit zu einer säkularen und einer integristischen Kultur zu unauflösbaren Loyalitätskonflikten zwischen staatlichem Gesetz und Gottesgesetz. Damit steht nicht weniger als die Trennung dieser Sphären in der säkularen Gesellschaft auf dem Spiel. Die Realität ist global wie innergesellschaftlich nicht interkulturell, aber multikulturell.
Das daraus erwachsende Dilemma zwischen der multikulturellen Vielfalt der Gesellschaft und der notwendigen Einheit des Rechts lässt sich nur durch Differenzierung der Funktionssysteme bewältigen. Je liberaler wir hinsichtlich kultureller Unterschiede in der Gesellschaft sind, desto wichtiger wird die politische Integration in die Leitstrukturen der staatlichen Ordnung. Dazu zählen neben dem Gesetzesgehorsam der Respekt vor staatlichen Institutionen, Schulen und Gerichten, unabhängig davon, ob man deren Inhalte, Werte oder Urteile teilt.
Mehr Selbstbehauptung mit Trump?
Der widersprüchliche, zugleich universalistische und interkulturelle Ansatz hat den Westen in eine strategische Sackgasse geführt. Dies macht den Erfolg von Donald Trump erklärbar. Er hatte die Defizite der westlichen Politik angesprochen und zwar sowohl hinsichtlich der Überdehnung nach außen als auch hinsichtlich der mangelnden Selbstbehauptung nach innen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass er auch schon eine neue Strategie hätte.
Klar ist bisher nur, dass er das alte Verhalten des Westens ändern, die Weltpolizistenrolle beenden, das Verhältnis zu Russland verbessern und mehr Gegenseitigkeiten im Handel mit China erzwingen will. In der Tat kann man China vorwerfen, mit seiner staatlich gelenkten Wirtschaft den freien Wettbewerb zu unterlaufen, etwa durch Manipulation des Wechselkurses ihrer Währung und sich generell die Rosinen aus der Globalisierung zu picken. Die Forderung nach mehr ökonomischer Gegenseitigkeit ist daher verständlich. Dass Trump mit der Einladung der taiwanesischen Delegation zu seiner Amtseinführung politisches Öl in die ökonomische Rivalität schüttet, steht einer Multipolarität wiederum im Wege.
Eine liberale Weltordnung gehört nicht zu den Prioritäten von Donald Trump. Die USA würden – so verkündete er in seiner Antrittsbotschaft – nicht mehr versuchen, anderen Staaten ihre Lebensweise aufzudrängen, sondern künftig ein Beispiel setzen, dem andere nacheifern können. Trump feiert den Rückzug der USA als Befreiung von moralischen Sonderlasten. Er will die USA nicht mehr als exzeptionelle Macht, sondern als eine Macht, die wie andere Völker auch nach dem eigenen politischen Vorteil sucht.
Mit Universalismus und Multilateralismus endet das amerikanische Jahrhundert, genau 100 Jahre nach dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg (Adam Tooze, Abschied von den USA. Wie Amerikas Anspruch auf globale Herrschaft entstand – und warum er mit Donald Trump zu Ende geht, in: Die Zeit v. 12.1.2017). Trumps Pläne sind nicht isolationistisch, sondern nationalistisch. Ein neuer Isolationismus wäre auch nicht möglich. Bei Digitalisierung und Big Data sind die USA führend, Wall Street ist immer noch der Nabel der Finanzwelt, die USA werden als Fundament einer in ihrem Sinne veränderten Nato unverzichtbar.
Donald Trump hatte intuitiv recht, als er die Nato als ›obsolet‹ bezeichnete, es fehlten aber Erklärungen, Ausführungen und Verbesserungsvorschläge. Die Nato war ein erfolgreiches Defensivbündnis gegen den Sowjetblock, als Interventionsarmee nahm sie die traurige Rolle an, nur alte Ordnungen zerstören, aber keine neuen schaffen zu können.
Im Kampf gegen den Terror richtet die Nato als Militärverband nicht viel aus. Die Einsätze gegen Al-Qaida und den ›Islamischen Staat‹ in Syrien und im Irak führen die USA, Großbritannien und Frankreich auf eigene Faust (Jonathan Power, Trump hat recht: die NATO ist obsolet. Das Militärbündnis kann die aktuellen Probleme Europas nicht lösen, in: Internationale Politik und Gesellschaft, ipg-journal v. 27.2.2017). Die Bilanz vergangener Aktivitäten ist desaströs. Von den Interventionen in Afghanistan, im Irak und in Libyen bis zu Lockangeboten an die Ukraine hatte der Westen – oft genug auf Betreiben wesentlicher Nato-Mitglieder – andere Kulturen und Hemisphären destabilisiert, sich heillos in unlösbare Konflikte verstrickt, Flüchtlingsströme zu sich gelenkt, die vormalige Sicherheitspartnerschaft mit Russland ruiniert und den Kampf der Islamisten gegen den Westen angefeuert.
Im Westen glaubte man, Nationen, Religionen und Kulturen ausreichend dekonstruiert zu haben. Erstaunt müssen wir heute feststellen, dass sich Clans, Ethnien und religiöse Identitäten außerhalb des Westen nicht dekonstruieren lassen wollen und sie umgekehrt die oft zwangsimportierte Demokratie nur als Mittel für ihre vorrangigen ethnischen oder religiösen Ziele nutzen. Ob die Nato ›obsolet‹ bleibt, wird davon abhängen, welchen Aufgaben sie sich in Zukunft widmet.
Selbstbegrenzung und Selbstbehauptung in einer multipolaren Weltordnung
Russland wird als Sicherheitspartner gegen den Islamismus gebraucht. Mit der schon provozierenden Ankündigung der Aufnahme Georgiens und der Ukraine in die Nato wurde der Herausbildung einer multipolaren Ordnung Schaden zugefügt. Im Sicherheitsrat der UNO genügt ein Veto Russlands oder Chinas, um ihre Handlungsfähigkeit zu rauben. Eine neue Weltordnung kann nicht gegen Russland und China, sondern nur mit ihnen, also im multipolaren Kontext entstehen. Trumps Außenpolitik führt weg vom Multilateralismus zu bilateralen Deals und Einzelkontrakten. Es fehlt aber der Ausblick auf eine multipolare Weltordnung. Dafür müsste er offen und klar Russland und China Sphären des privilegierten Einflusses zugestehen, frei nach dem Motto: ›Jedem sein Mittelamerika‹. Welche Gefahren drohen, wenn dies nicht geschieht, zeigte die Kubakrise.
Eine Ordnung beruht auf Hegemonie oder Gleichgewicht. Da die Hegemonie einer Macht derzeit nicht möglich ist, müssen wir uns in einer neuen Weltordnung um ein möglichst tragfähiges Gleichgewicht der großen Mächte bemühen. Auch angesichts wirtschaftlicher und technischer Verflechtungen werden politische Grenzen als Grundlage einer Gleichgewichtspolitik gebraucht.
Koexistenz der Kulturen und Mächte
Laut dem chinesischen Politikwissenschaftler Xuwu Gu geht es bei den Antithesen – Primat des Individuums oder Primat des Kollektivs, mehr Menschenrechte für eine freie Gesellschaft oder mehr Menschenpflichten für eine stabile Staatsordnung –, um einen Paradigmenstreit darüber, was der Mensch ist und sein sollte, eine Frage, die kaum absolut und damit universell zu klären sein dürfte. (Vgl. Xuewu Gu, Die große Mauer in den Köpfen. China, der Westen und die Suche nach Verständigung, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2014, S.120f.)
Beim Kampf zwischen Säkularismus und Integrismus geht es sogar um unterschiedliche Menschen- und Gottesbilder. Sie sind weder durch die Universalisierung eines Standpunktes noch durch interreligiöse Dialoge aufhebbar, sondern nur durch politische Abgrenzung der Kulturen und ihrer unterschiedlichen Logiken, was individuelle und ökonomische Austauschbeziehungen keineswegs ausschließt.
Die wichtigste Voraussetzung für eine multipolare Ordnung wird der Übergang vom Universalismus zur Koexistenz der verschiedenen politischen Strukturen und Kulturen sein. Für eine multipolare Ordnung muss der Westen nach zweihundertjähriger Dominanz seine Selbstbegrenzung einleiten, ohne seine Selbstbehauptung preiszugeben.
Minimalkonsens: Kampf um die Zivilisation
Der Kampf des dschihadistischen Islam ist nicht nur gegen die ›Freiheit des Westens‹, sondern gegen die ausdifferenzierte Zivilisation überhaupt gerichtet. Im Umkehrschluss könnte ein zivilisatorischer Minimalkonsens aus der Abwehr des neuen Totalitarismus erwachsen. Die Bekämpfung des Islamismus wäre ein Minimalkonsens zwischen allen säkularen Mächten.
Trump will den Islamismus ausradieren, den sein Vorgänger nicht einmal wahrnehmen wollte, weil er nicht in sein interkulturelles Weltbild passte. Angesichts der neuen totalitären Herausforderung kann sich der Westen die Ausgrenzung autoritärer Regime wie insbesondere Russlands nicht länger leisten. Auch die säkulare Militärherrschaft in Ägypten, die Monarchie in Jordanien und das autoritäre China stünden uns näher als demokratisch gewählte Muslimbrüder. In solchen Bündnissen sind zwar keine Wertegemeinschaften, aber Sicherheitspartnerschaften möglich. In ihnen ginge es nicht mehr um ›die Beziehungen‹, sondern nur um eine spezifische Funktion.
Die große Spaltung des Nahen Ostens zwischen Schiiten und Sunniten wird ähnlicher Grenzen und Mauern bedürfen wie des Ost-West-Konfliktes zwischen inkompatiblen politischen Systemen. Wie zwischen den Mächten im Kalten Krieg oder heute zwischen Israel und den Palästinensern sind Grenzen oft die letzte Möglichkeit, den Frieden durch Trennung des Inkompatiblen zu erzwingen. Fragen nach ›der Gerechtigkeit‹ sind damit nicht beantwortet, aber ein Minimum an zivilisatorischer Stabilität ist auch im Interesse subordinierter kultureller Identitäten. ( Vgl. Heinz Theisen, Der Westen und sein Naher Osten. Vom Kampf der Kulturen zum Kampf um die Zivilisation, Reinbek 2015)
Die Selbstbehauptung der Europäischen Union
Die Europäische Union wird durch Trump gezwungen, eine eigene Rolle in der Weltordnung zu finden. Unter der Prämisse der notwendigen Stabilisierung ergäben sich neue konsensfähigere und populärere Aufgabenbeschreibungen als bisher. Wer ein staatsähnliches Gebilde anstrebt, kann sich nicht vor der Hauptaufgabe jeder Staatlichkeit drücken: dem physischen Schutz der Bürger. Diese wollen nicht am Hindukusch, sondern an den eigenen Grenzen und im eigenen Land verteidigt werden. Die Ernsthaftigkeit dieses Anliegens würde die EU zugleich von ihren Erziehungsattitüden bei Raucherschutz und Glühbirnen entlasten.
Aus der neuen Priorität ließen sich die ansonsten unbeantwortbaren Fragen nach der richtigen Größe und nach den notwendigen Grenzen der Europäischen Union beantworten. Die angemessene Größe der EU ergäbe sich immer auch aus den Beiträgen der Beitrittskandidaten zur Sicherheit Europas.
Jenseits aller moralischen Imperative wären aus dem Stabilitäts- und Sicherheitsimperativ Kriterien für die Aufnahme von Migranten und Flüchtenden ableitbar. Diese wären nur in dem Maße verantwortbar, wie sie von Polizei- und Geheimdiensten kontrollierbar bleiben.
Innere Grenzen zwischen Funktionssystemen sind etwa zur Verhinderung einer ökonomischen Kolonialisierung der Lebenswelt oft noch wichtiger als zwischen den Staaten. Gesetze für den Binnenmarkt sollten daher keine Aufhebung von sozialen oder kulturellen Grenzen bedeuten. Der Binnenmarkt kann für alle, die Währungsunion und eine Politische Union nur für wenige gelten, eine Sozialunion darf es nicht geben, solange wirtschaftliche Voraussetzungen zu unterschiedlich sind. Die wichtigste europäische Aufgabe wäre die Selbstbehauptung nach außen und innen.
Die EU wäre in ihren Mehrebenensystemen an sich gut geeignet, den falschen Gegensatz zwischen Internationalismus und Nationalismus in Gegenseitigkeiten aufzuheben. Ohne starke Nationalstaaten kann es keine erfolgreiche inter- oder supranationale Arbeit geben. Ohne die Dominanz Deutschlands wäre die EU nicht existenz- und handlungsfähig.
Umgekehrt brauchen viele europäische Nationalstaaten schon aufgrund mangelnder Größe eine inter- und supranationale Agentur. Internationale Organisationen bedürfen starker Nationalstaaten und diese starker internationaler Organisationen. Nationalstaaten und EU müssten sich gegenseitig ergänzen statt sich wechselseitig aufeinander zu verlassen. Effizienter Internationalismus hätte bedeutet, den Flüchtenden aus dem Nahen Osten in den bereits existierenden Unterkünften vor Ort zu helfen. Dies wäre für die Flüchtenden und für die ansonsten überforderten Nationalstaaten Europas hilfreicher gewesen.
Mittelwege gesucht
Es hat keine Notwendigkeit zu einer überstürzten Schwächung des Nationalstaates gegeben, dem wir Entwicklungen zur Demokratie, Gleichberechtigung und sozialen Sicherheit verdanken. Nationen – so Paul Collier – sind legitime moralische Einheiten, die gerade ihren ärmeren Bürgern Rechte verleihen, deren Interessen vom ›globalen Nutzen‹ oft unberührt bleiben (Paul Collier, Exodus. Warum wir Einwanderung neu regeln müssen, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 2014 S.31f.) Nationen werden zur Selbstbehauptung gerade der schwächeren, nicht wettbewerbsfähigen Teile der Bevölkerung gebraucht. In dem Maße, wie sie sich auf ihre eigenen Räume begrenzen, stehen sie dabei der Selbstbehauptung anderer nicht im Wege.
Eine Nation ist eine Nation, weil sie eine sein will und dieser Wille sollte möglichst nüchtern aus den Notwendigkeiten der Problembewältigung gebildet werden. Ein Beispiel für eine solche Willensnation über alle inneren national-kulturellen Identitäten hinweg ist die Schweiz, die ihre jahrhundertelange Selbstbehauptung nicht zuletzt ihrer klugen Selbstbegrenzung auf ihre Eigeninteressen verdankt. Im Rahmen der neuen Weltordnung sollte es um eine zunehmende Verschweizerung auch der Weltmächte gehen.
Die Ideologie der Weltoffenheit bedeutete auch Offenheit gegenüber dem reinen Wettbewerb und gegenüber negativen transnationalen Prozessen. Auch sie ist ambivalent. In Zukunft darf es daher nicht um Gegenextreme der Abschottung, sondern um begehbare Mittelwege und Ergänzungen zwischen Internationalismus und Nationalismus, Universalismus und Partikularismus, Entgrenzung und Abgrenzung gehen. (Vgl. Heinz Theisen, Der Westen in der neuen Weltordnung, Stuttgart 2017, im Erscheinen)