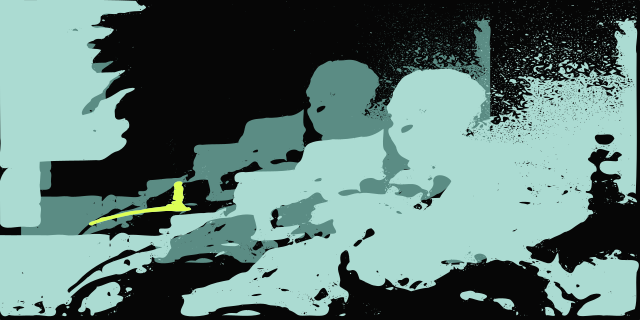von Ralf Willms
I. Axel Sanjosé: Gelegentlich Krähen
In den Gedichten Axel Sanjosés kommen immer wieder Spuren extremer Gewalt zum Vorschein, nicht selten recht unverhüllt, so wie in diesem titellosen Gedicht (S. 51): »Es war in den letzten Ritzen der Sprache, / ein Unzeichen [...] / Man fand Worte, es nicht mehr zu nennen, / Satzfetzen, man fand Zitate, Zwang und Zärtlichkeit, / sagte Unsagbares, lallte Unlallbares, / riss die Eingeweide mit bloßer Hand aus dem Rücken [...] gab Kindern Draht, sich Nabel zu bohren, / teilte Spinnen aus und Splitter / zu gurgeln, zu gurgeln.« Die Gewalt, die einerseits bis in die »letzten Ritzen der Sprache« dringt, und andererseits nicht mehr genannt wird, erscheint, wie man weiß, stets in immer neuen und alten Gewändern:
»Das Spiel geht weiter / mit verbesserten Steinäxten / und Blut unter dem Augenlid, / den Kindern vorsorglich eingeträufelt.« Die Kinder jeder weiteren Generation, denen die Gewalt »vorsorglich eingeträufelt« wird, kommen dann – determiniert – nicht umhin, mit ihr zu kollidieren und entsprechende Funde zu machen (»Im Abendlicht schimmert durchs Gebüsch / die letzte Bierdose / des Mongolenfürsten.«). Das Einzige, was vom Kontext solcher Funde oft noch spürbar ist, ist die Gewalt, die von ihm ausgeht.
Auf der Rückseite des schmalen Gedichtbandes heißt es: »Nach einer Lesung sagte ein Zuhörer, er habe bei jedem Gedicht den Eindruck, es sei zuvor etwas Schreckliches geschehen, man wisse nur nicht was.« Für die Frage nach dem »was« (danach, was geschehen ist), die, konkreter gefasst, nicht unbedingt zu den Aufgaben von Lyrik gehört, bietet sich einmal ein weiter Rahmen an. Die ›Mimetische Theorie‹ von René Girard bietet einen grundlegenden Erklärungsansatz: Nach Girard basiert jede Kultur auf Gewalt bzw. entsteht jede Kultur durch Gewalt. Sie beginnt mit der Krise, die wesentlich durch Rivalität gekennzeichnet ist. Diese Rivalität – oder reziproke Gewaltanwendung zweier oder mehrerer Rivalen – hat nichts Originäres, sondern beruht prinzipiell auf Mimesis. Die vermeintliche Lösung der Krise erfolgt durch den Sündenbockmechanismus. Er bezeichnet den Umschlagpunkt, in dem sich die verschiedenartigen Kräfte (nicht selten diejenigen, die zuvor noch in erbitterter Rivalität zueinander standen) einmütig zusammenschließen und gegen ein Opfer oder gegen eine Opfergruppe richten. Das Opfer wird – zugrunde gerichtet. Woraus sich die neue oder erneuerte Identität derjenigen, die nun als Kollektivtäter angesehen werden können, ergibt, letztlich also eine neue Ordnung. Diese ›neue Ordnung‹ (bald schon: symbolische Ordnung) verschleiert die eigentlichen Schwierigkeiten und Implikationen, die der Krise zu Eigen waren, weshalb sie ›nicht wirklich‹ gelöst wird, sondern sich – scheinbar endlos – fortsetzt. Im Zuge der jeweiligen Verschleierungen wird es zunehmend schwieriger, die Ursachen und eigentlichen Realismen der Krise, sofern nur überhaupt jemand um sie bemüht wäre, auszumachen, bis sie womöglich ganz verwischt sind. Eine Möglichkeit der Verschleierung der ausgeübten Gewalt besteht in der Divinisierung des Opfers. Nach diesem Schema bildet sich, so Girard, die jeweilige neue Kultur heran, die ihre Entstehungs(ab)gründe aus dem Bewusstsein zu bannen sucht und zugleich ihre Vorstellungen und Schlussfolgerungen in Form von Verboten bzw. Gesetzen manifestiert. Solche Spuren abgedrängter und scheinbar unkenntlich gewordener Gewalt sind es, die sich in Axel Sanjosés Gedichtband in sehr ausgeprägter Weise finden.
Im Licht der ›Mimetischen Theorie‹ erscheint dann manche Zeile ›sprechend‹ (so etwa S. 13): »Da, / wo später Fenster schließen sollen, / klafft durch Gerüste Loch an Loch. / Der Wind (ja, er) weht abends / recht kühl ums Gemäuer, / und wir, wir lernen nichts daraus. / Wir halten das Licht in unruh'ger Hand / und schürfen uns dauernd die Wunden neu auf / an jedem Sims, / an jedem Eck [...].« Sprechend erscheinen die Zeilen dann, wenn man das ganze Textgebilde metaphorisch bzw. metonymisch liest. So lässt sich sagen: Etwas soll geschlossen werden, vielleicht weniger Fenster als vielmehr Wunden. Doch es klafft »Loch an Loch«. Die Folgen der Gewaltanwendungen sind offensichtlich zu gravierend. Der Wind, »(ja, er)« – warum dieser bekräftigende Einschub?, vielleicht doch eher: nicht der Wind – weht wohl nicht nur »recht kühl ums Gemäuer«. Das ist kein meteorologisches Frieren, »und wir, wir lernen nichts daraus«.
Kontrastiv zu den (verdeckten wie offenen) Spuren solcher Gewaltanwendungen und ihren Folgen, hebt die – vordergründig sehr einfache – Sprache Axel Sanjosés manchmal zu etwas wie einem Lied an. Dann kann es vorkommen, dass fremd-vertraute Landschaften, die jedem bekannt sein dürften, durchscheinen, wie im Gedicht Nachhut (S. 8): »Vorbei an den Weiden, / der früh'ren, der späten Allee, / vorbei an dem Tümpel, vorbei, vorbei / an Kinderverstecken. Und singen: / am Gaumen klebt Staub. / Im Tümpel sind Frösche und quaken / – kein Blick mehr, kein Zittern –, / vorbei an den Zäunen, / die Sonne scheint länglich durchs Schilf, / wir roden, wir rodeten, haben gerodet. / Kein Zeugnis: das ist es, was bleibt. / Sie quaken viel lauter und schöner als sonst, / wir sahen sie niemals.« In diesem Sinne haben die Gedichte etwas Volkstümliches. Aber wenn sie denn überhaupt vom Volk sprechen, so gehen sie zugleich scharf auf Distanz zu ihm. Denn der Autor kennt dessen verräterischen und trügerischen Aspekt. Durchzogen werden die Gedichte von universellen Themen mit eigener Tönung: Vergänglichkeit, Wehmut, Gewalt, ein Memento mori. Die Gestalten, die diese Gedichte bevölkern, entstammen zumeist ›einfachen‹ Milieus: Jäger, Bauer, Maurer, um nur einige zu nennen. Die Orte: ein Bauernhof, ein Schützenfest, Klinikum und Universität. Und immer wieder – zieht man die ›Mimetische Theorie‹ hinzu, möchte man sagen: vorprogrammiert – wird das Leben an diesen Orten »schlecht«. Unmissverständlich erscheint dies im zweiten Zyklus des ersten Gedichtbandes des Autors von katalanischer Herkunft, den Emslandgedichten. Dort heißt es im vierten Gedicht Ländliches Sonett (S. 32): »[...] ein Lied, das nur Refrain, nicht Strophen hat. / Was sich zusammenbraut zu einem Bild / liegt wie ein schlechter Film auf meinen Augen / mit falschem Dialog, falscher Musik, / erlaubt hinter die Hügel keinen Blick / und kann für Wirklichkeit und Traum nicht taugen.« Es lässt sich »übersetzen«: Es herrschte nur noch Gewalt, keine Differenzierungen mehr (»nur Refrain, nicht Strophen«). »Was sich zusammenbraut zu einem Bild / liegt wie ein schlechter Film auf meinen Augen / mit falschem Dialog [...].« Die Gewalt wurde also absolut gesetzt: »erlaubt hinter die Hügel keinen Blick«. Das jeweilige Ich wurde auf eine Stelle hin fixiert. Gerade in den Emslandgedichten wird spürbar, dass der Autor sich und dem Textsubjekt die maximale Verarbeitungszeit einräumt – die Zeilen schreiten langsam daher, hoch bewusst und fast überdeutlich; gegen das Verdorbene, das an vielen Stellen aufscheint, vermögen sie jedoch kaum anzukommen. Das zweite Gedicht des Zyklus, Winteralltag (S. 30), nimmt definitiv ein Ende vorweg: »Hinterm Hof liegt begraben / die Zukunft, ein Hund.«
II. Walle Sayer: Den Tag zu den Tagen
Auch in Walle Sayers Den Tag zu den Tagen, spielt die Gewalt eine zentrale Rolle. Der Band beginnt mit dem Gedicht Gesuch, seine ersten Zeilen: »An der Steige, / hinter der Kurve gleich, / Schauplatz, auf dem nichts geschieht, / außer daß Dachsparren sich versteckt halten [...].« Ein Schauplatz, auf dem nichts mehr geschieht. Die Welt erscheint – wie nach einem Kahlschlag, der vor langer Zeit stattfand – leergeräumt, das Innere maximal weit oder eng auf sich zurückgezogen. Von da aus wird die Wahrnehmung und schließlich das Gedicht organisiert. So das kurze Gedicht Türschild (S. 60), dessen Titel einen Ort für grundlegende Benennung und Grenzziehung darstellt: »Vorsicht bissige Stille, einzig / ein paar verzogene Jahresringe knarzen, / die Königssuite einer Bruchbude ist dahier / und vierundzwanzig Überstunden hat mein Tag.« Die Stille im Textsubjekt erscheint so konzentriert, dass sie – nähert sich jemand ihr – scharf, »bissig« wird. Verzogen hat sich weniger die Tür, sondern »einzig« ein paar Jahresringe, die mit jeder Näherung »knarzen«. Die »Bruchbude« erscheint geheiligt (hier kann man auch an die Divinisierung des Opfers nach seiner Zugrunderichtung bei Girard denken), avancierte zur »Königssuite«. Und das Textsubjekt wurde seiner Gesellschaft, seinem Kontext ganz entbehrlich. Gerade hier findet sich die ebenso subtile wie deutliche, die fundamentale Kritik.
Dass der oder ein gewichtiger Ausgangspunkt dieser Gedichte ›Leiden‹ ist, und dieses Leiden (auch) auf Gewalterfahrungen verweist, belegt ein Gedicht wie Zimmerarrest (S. 51): »Ichquarantäne, Zeigefingerrichtungen, / am Himmel aufgeflogene Lehrerhäkchen. / Von nahfern ziehen Schiedsrichterpfiffe / akustische Striche durch den Nachmittag. / Daliegen, an einen Nesthalm nur geklammert, / nichts werden wollen: die größte Ambition. / Das Zimmer paßt in ein Setzkastenfach, / im Sand der Sanduhr lebt ein Wüstenfloh.« Die Gegenstände werden in ihrem Kontext notwendigerweise noch wahrgenommen, aber zugleich ihres Kontexts enthoben, ohne dass sie in einen neuen Kontext gestellt werden könnten – der neue Kontext ist das Gedicht selbst. Die Gedichte insistieren auf dem Zustand, das Übliche verlassen zu haben und etwas Neues nicht oder noch nicht gefunden zu haben. In diesem Raum, der gewöhnlich gemieden wird, siedeln sich die Gedichte an: »Lehrerhäkchen« fliegen auf, entblößen ihre Hohlheit, »Schiedsrichterpfiffe« ziehen durch den Nachmittag noch als »akustische Striche« etc. Dennoch, die Wurzeln dieser Gedichte dürften nicht geradewegs im französischen Symbolismus zu suchen sein. Walle Sayer geht es, dies dann doch, um reale Zustände, um die Auslotung eigener Zustände, »übersetzt« ins kunstvoll geformte Gedicht. »Eigen« meint: Was menschenmöglich ist, wird durch die Koexistenz des Mediums immer auch zur Versuchsanordnung. Nicht nur hier greift der Autor zwangsläufig auf eine reiche Tradition zurück. Eingedenk ihrer erscheinen die Gedichte als Variationen. Die »Ichquarantäne«, das erste Wort des Gedichts nach dem Titel, mag an Beckett erinnern oder nicht: Es verweist u. a. auf die Zerbrechlichkeit, auf die Reinheit des Zustands. Das »Daliegen« sicher auch auf die Kraftlosigkeit, auf die Lähmung unter dem (teils unfreiwilligen, teils freiwilligen) Verzicht auf Ziele (»nichts werden wollen: die größte Ambition.«). Nicht nur hier erscheinen die Zeilen (allerdings) trügerisch: Walle Sayer ist Lyriker, und es lässt sich erst oder zunehmend »nichts werden«, wenn ein Gewordensein, ein (lyrisches) Werk vorliegt. Ein »nichts werden wollen« – und hier tritt die hohe Mehrdeutigkeit der Sprache hervor – bietet dazu einen gewissen Schutz, und ist wohl nur möglich, wenn jemand bereits etwas »ist«. Indessen verkleinert sich die Welt, verschwindet im »Setzkastenfach«. Das Wort Arrest (als Teil des Kompositums »Zimmerarrest«), das all dies übertitelt, deutet dabei auf die verdeckten »Ursprungsereignisse«, auf die immer wieder angespielt wird.
Es sind – auch hier knüpft Walle Sayer wohl mehr oder weniger bewusst an die bereitstehenden Traditionen an – die allerkleinsten Ereignisse, die ins Zentrum des Gedichts rücken. Oft sind es Relikte aus Kindheit und Jugend, die ersten und zugleich letzten Erinnerungsreservoire, es sind die atmosphärischen Relikte mit Verweischarakter: so ein »angenagter Bleistift« (S. 55), ein »angespitztes Streichholz« (S. 50) oder gar die mit »Kinderspucke zusammengepappten Jahre« (S. 65).
Das letzte Wort des Gedichtsbands ist das Wort »Opfer«, das, in dürftiger Metaphorik, die – dies dann doch – kein Einzelfall ist, immerhin der prinzipiellen Mehrdeutigkeit überlassen wird: »Eine wolkenlose Schieferplatte / will für den Himmel gehalten werden. / Klarheit: durchsichtige Augenbinde. / Meine schwarzen Bauern, deine weißen, / hoffen auf ein Königsopfer.« Es wird kein Zufall sein, dass die »schwarzen Bauern« mit dem Possessivpronomen ›meine‹ verknüpft wurden, sie verweisen auf den Tod. Während »deine« – als Platzhalter für alle und alles, was weniger versehrt anmutet – »weiß« sind. »Weiß« verweist auf neues Leben, auf Reinheit. Der Gedichtband fordert zuletzt eine andere Welt ein – eine Welt, die ihr Verhältnis zur Gewalt grundlegend überdenkt – und spricht, ja, ihr aus der Stille zu.
Axel Sanjosé: Gelegentlich Krähen, Weilerswist (Landpresse) 2004, 80 S.
Walle Sayer: Den Tag zu den Tagen, Tübingen (Klöpfer & Meyer) 2006, 100 S.