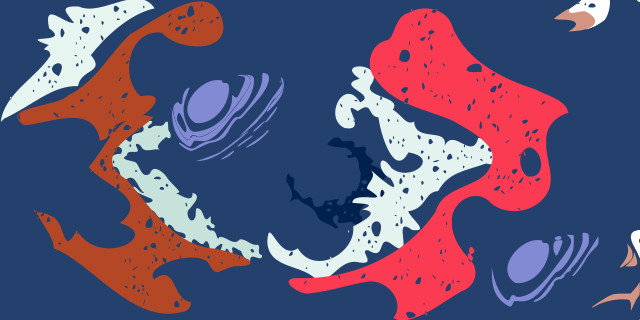von Ralf Willms
Silke Scheuermanns Gedichte in Über Nacht ist es Winter sind zusammenhängend (und zugleich unzusammenhängend) genug, dass sie sich wie ein Text lesen lassen: begünstigt vom Verzicht auf Interpunktion, wenngleich jedes Gedicht übertitelt ist. Die Texte sind gezielt heterogen angelegt und, so mein Eindruck, weisen immer wieder Elemente auf, die ihnen (und dem Leser) wenig Gutes tun. Gedichte und generell gute Kunst, das ist bekannt, beinhalten immer auch einen gewissen Unschärfegrad; die Grenzen etwa zu einer schlechten Positionierung eines ›Gegenstands‹ sind – bei genauerer Betrachtung – nicht unbedingt fließend, sondern können deutlich, sichtbar werden.
So heißt es (S. 56): »Die Katze setzt rechts zum Sprung an / landet etwa in Höhe des üblichen Beistelltisches«. Dann: »Sind das die Bilder die du mal behalten wirst / dass sie den Vogel fängt / die Speisekarte der Evolution existiert / und der Würgeengel in dir zu wohnen beginnt?« Es wird nicht klar, wo die Katze zum Sprung ansetzt (dafür ein ›leeres‹ Wort wie »rechts«), und dass sie »etwa in Höhe des üblichen Beistelltischs« landet, ist es der Erwähnung wert? Abgesehen davon, was überhaupt ein »üblicher Beistelltisch« sein könnte, es gibt da sicher ein breites Sortiment. Und warum sollte es eines der Bilder sein, »die du mal behalten wirst«? Es fehlt jede Vorbereitung und Anbahnung des Bildes, dazu wird es kaum ansatzweise ausgeführt, der Kontext wird nicht einmal mehr angedeutet. Das – als Stilmittel...? – das ist mehr als (dargestellte und beabsichtigte) »Zerrissenheit«, es ist Oberflächlichkeit und schlechte Ausarbeitung, möglicherweise Resultat post-postmoderner Geschwindigkeit. Der leicht schnoddrige Ton, der sich immer wieder einschleicht, scheint Teil davon: »Sind das die Bilder die du mal behalten wirst? Mal? Wovon ist eigentlich die Rede? Doch zweifellos von Gewichtigem?
Die Liste, aufzuzeigen, was an diesem Gedichtband ›nicht stimmt‹, würde lang. Sicher kann es reizvoll sein, wenn zwei Sätze aneinanderstehen, die nichts miteinander zu tun zu haben scheinen, aber langsam doch erkennbar wird, dass sich Teile von ihnen (klanglich oder inhaltlich) ineinander verschränken, miteinander korrespondieren und dadurch etwas Neues oder Anderes ergeben. Anders im Gedicht Museum der stillen Engel, wenn es heißt: „Ich würde dir gerne die Stille erklären / doch kann nicht / bewegte Flügel kommen kaum vor / in diesem Museum«. Diese beiden Sätze bieten untereinander keine Möglichkeit einer Korrespondenz. Sie stehen vielmehr holprig nebeneinander – das kann man, wie alles im Gedicht, tun, aber man kann es auch lassen. Dazu kommt ein selbstüberschätzerisch anmutender Ton, der sich implizit zu einer Art Autorität aufzuschwingen scheint, mit welchem das Gedicht beginnt und durch Wiederholung (auch noch) bekräftigt wird: »Ich sage dir das von den / Engeln nicht ungern«.
Das ist die eine Seite. Ihr gegenüber steht eine größere Zahl überwältigender Beobachtungen und Erkenntnisse, die sehr wohl vorbereitet werden und für sich genommen ausreichend Bedeutung (oder Bedeutungsgebungsmöglichkeiten) bereitstellen. Freilich gibt es Gedichte (z. B. solche, die unter sogenannte Konkrete Poesie subsumiert werden können), die erst gar nicht auf Bedeutung angelegt sind – die vorliegenden aber gehören nicht dazu. Da ist das Ich (S. 7), das mit einem Du »zwischen der Kerze und den Sternen« stand, Musik hörte, »nur eben von rechts und links des Recorders«, und aus dem immer gegenwärtiger werdenden Dunkel, das als etwas Ganzes erlebt wird, sich dem Du zuwenden möchte und »in einen Spiegel hinein fliegen [würde] / der nicht splitterte«. – Die Entfernung vom Du, wenn sie sich auch noch in einem gewissen Rahmen zu halten scheint, wird ausgeschritten (S. 10): »und musste in den Schnee schreiben / was der Schnee gesagt hat / [...] / selbst eingefroren noch ungerecht«. Erhellend ist auch das Gedicht Mimikry mit der grundlegenden Erkenntnis, dass Liebesverhalten lediglich übernommen und zu einem gewissen Teil simuliert wurde: »längst bevor wir uns trafen / war das ausgemacht / mit der Umgebung die so / farbenfroh war das ich / keuchte mich anstrengte / aufpumpte / wie eine Raupe / kroch ich über den grünen / Rand der Welt / [...] / Ich tanzte / Ich traf dich / platzierte / imitierte Worte in deinen Verstand / chirurgische Schnitte in dein Herz / kalkulierte das Wort / [...] / Ich imitierte den Schmerz / von dem ich spürte / er war in dir / einzigartig [...]«. Solche Aufrichtigkeit ist schonungslos, auch gegenüber sich selbst, und die kleinen Eitelkeiten, sich selbst in dieser Weise als Täter zu erkennen geben und zu profilieren wissen, erscheinen verzeihlich. Das Gedicht ist Teil des Eingangszyklus Das Museum der falschen Anfänge, und dieser Titel trifft.
Die Sprache tritt immer wieder hervor aus dem Fühlen, das noch einen wunderbaren Kontakt zur Kindheit hält: »ihre Zukunft schwebte noch / eine blassblaue Skizze / Tinte war die natürliche Sprache deines Gefühls« (S. 27). Gesprochen wird (S. 33) von der »Winter-Romanze der Schränke / eine Wohnung voll frierender Kleider« – mit der Frage (S. 38) »Wie kamst du / in diesen Käfig ohne Märchen« / [...] / ich lebe hier nur in den Nächten / die ich immer noch wie ein Kind umarme«. Es bedarf keines weiteren Worts.
Freilich ist es der Eros, der sich immer wieder Themen und Formulierungen erschafft, die im Gedächtnis bleiben können: »Wir sind mächtige Magneten die den Mond anspringen« (S. 41). Und (S. 46): »Der Weg der ums Ziel kreiste / führte natürlich durchs Feuer«. Und (S. 48) »dass ihre Liebe ein Fisch war / und willens dem wildesten Schwimmer zu folgen«. Das Ich dieses Gedichts muss »zusehen wie überall / verrückte Frauen Schuhe kaufen« und fragt: »Hatten sie wirklich sämtlich / beschlossen nie mehr den Tränen / nach unten ins Tiefe zu folgen?« Einige Seiten danach (S. 59) tritt ein »Tätowierer« auf, der sowohl eine Erklärung für das eigene Verhalten wie für »Verwandlungen« generell an die Hand gibt: »Doch was ist Leben sonst / als umfunktionierte Verletzung«.
Die Gedichte in Über Nacht ist es Winter sind vor allem der Versuch, den Kontakt zum Leben zu halten, bevor alles erfriert. So beneidet das Ich (S. 61) ein vom Ahornbaum fallendes Blatt, »das niemals zum Boden / gelangt weil ein Hauch / immer einspringt«. Doch das Blatt wird zu Boden fallen – und das Ich fragt weiter (S. 73): »Was geschieht wenn [...] / jemand mich [...] nur so / zum Test treulos und blind in den Winter schickt? / Wenn es so kalt wird dass ich brenne / und strample und unter meinen / Füßen Asphalt flüssig wird?« Diese Art Wundsein sieht indessen, wie bereits erwähnt, auch die eigene »Täterschaft« (S. 74): »Kaum taten wir einen Schritt / heulte der Hund auf oder eine Ameise wurde / zertreten«.
All diese Stellen bilden eine Art Seelentext im Sinne einer seelischen Bewegung und seelischen Verfassung, die in Sprache ›übersetzt‹ wurde, und seine eingangs erwähnten Schwachstellen (die weiteren, heterogenen Elemente) haben die Funktion, ihn nicht allzu nackt erscheinen zu lassen. Dennoch (bzw. deswegen) möchte ich die Qualität dieses Gedichtbands in zwei völlig unterschiedlichen Anteilen sehen. Das Buch schließt mit Reflexionen, die sich auf den Schreibprozess selbst beziehen: »Die Art wie Gedichte arbeiten / ist zufällig / mutwillig / und von gleißend heller / Selbstverständlichkeit«. ›Selbstverständlich‹ im Sinne von ›natürlich‹ und ›ungekünstelt‹ dürfen Gedichte, ihre Eigenbewegung betreffend, gerne auftreten. Aber weiteres, das heißt sorgfältige(re)s Feilen an Stimme bzw. Sprache, am Gesamttext, scheint, m.E., wünschenswert.
Wie schwach und ergiebig die Gedichte im Einzelnen sind, kann beispielhaft das nachfolgende zeigen. Manche Zeile verrät das ›Wohlstandskind‹, das Motiv der Langeweile. Ein guter Lektor, das ist dem Verlag vorzuwerfen, hätte das Gespräch gesucht:
Das Appartement
In meinem zweiten Zimmer schlief zuckersüß
ein Friedhof als ich am Abend zurückkam
Die Möbel sind blass und längst ziemlich kühl
Sie atmen immer noch etwas
Lavendel aus
Ich achte auf Zimmers Krisen
seit langem nicht mehr
Ständig stellen Räume sich tot
sie mögen nicht einmal
meine Bäume zurück
ins Fenster verfrachten
weigern sich standhaft
mir mehr zu bieten
als die Winter-Romanze der Schränke
eine Wohnung voll frierender Kleider
plissierter Vorhänge
und Motten in Massen
Ausgerechnet diese Insekten
Ich muss mich begnügen
mit ihren kleinen Morden
im Gewebe der Zeit
kann solange selbst
ab und zu
so ein Insekt totschlagen
das sich in den Stoff frisst
Ich werde morgens mit
meinem zweiten Zimmer
aufwachen mich umsehen
und wieder einschlafen
Die Zeit reist ohne
mich weiter
Silke Scheuermann: Über Nacht ist es Winter, Frankfurt am Main (Schöffling & Co.) 2007, 88 S.