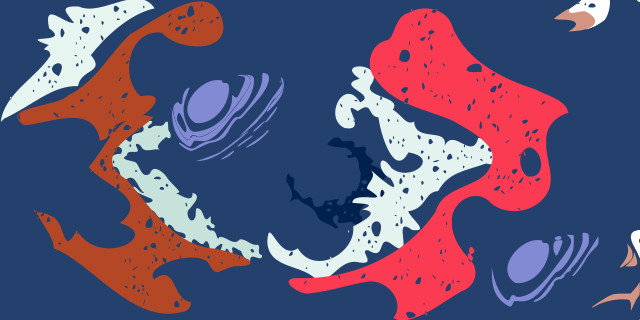Gedanken zu Eric Voegelins Ordnung und Geschichte*
von Ulrich Schödlbauer
1.
Am Ende einer langen Reformperiode, wenn der Begriff der Reform selbst brüchig geworden ist und sich zum xten Mal gegen seine ›ursprüngliche Intention‹ zu kehren beginnt – eine Volte, die nur rhetorisch zu verstehen ist und doch die Konstanz offenlegt, mit der die Verschiebung der gesellschaftlichen Dinge ins Neue betrieben wird –, an einem solchen Ende, das vielleicht weniger durch den unübersehbaren Wechsel
der Konzeptionen als durch Fadenscheinigkeiten aller Art auffällig ist, stehen Ordo-Denken und Reformdenken nicht mehr unverbunden oder feindselig neben- und gegeneinander. Stattdessen tauchen sie, unvermutet oder nicht, im Rücken des jeweils Anderen auf. Die Reform des Heiligen wird dann zu einem ebenso rigide zu bedenkenden Thema wie die im Reformparadigma zu denkende anthropologische Konstanz. Das alles ist nicht sonderlich neu, aber es geht entschieden hinter eine Konfrontation zurück, die den Alltagsstreit der Fraktionen polemisch absichern darf, solange jede Seite sicher zu sein glaubt, dass sie ihre Pappenheimer kennt und der grundsätzlichen Argumente genug getauscht sind.
Eric Voegelin: Ordnung und Geschichte, 10 Bde, München (Fink) 2002-04
Praxisbedingt besteht vor allem die Reformfraktion, die gerade am Zug ist, darauf, dass die Positionen bekannt sind und jede weitere Diskussion sich erübrigt. Auch dafür gibt es einen Grund, der jenseits der Überzeugungen liegt. Wer im Ernst glaubt, in einer Gesellschaft ›sammle‹ sich Reformbedarf ›an‹ wie Straßenkehricht, der dann in großen Aktionen zusammengefegt und entsorgt werden muss, setzt sich ebenso souverän über die Dynamik gesellschaftlicher Prozesse hinweg wie über die Konstanz der in ihnen erkennbaren Motive. Der Grund an ›Verstörung‹, der – je länger desto deutlicher – in und hinter dem, was seine Verächter gern ›Reformeifer‹ nennen, zum Vorschein kommt, sagt am Ende mehr über den unstillbaren Bedarf nach Veränderung in einer geschichtlichen Periode aus als alle exekutierbaren Programme. Dieser Bedarf ist manipulierbar. Was man im Westen dieses Landes einmal ›Reform‹ nannte und eine unverdrossene Linke weiterhin nennen möchte, kollidiert energisch mit einem Sprachgebrauch, der von der Transformation der bürokratischen Systeme des Ostens in marktwirtschaftliche Systeme genommen wurde und hinter dem die energische Durchsetzung neoliberaler Konzepte steht. Die ›Sorge um die Arbeitsplätze‹ hilft das eine wie das andere zu motivieren, manipulationsfähig ist sie auf alle Fälle. ›Die Reformpolitik muss weitergehen‹, sie muss weiter gehen, darüber besteht kein Zweifel, auch wenn es zweckdienlich sein mag, den Bevölkerungen gelegentlich eine Atempause zu verschaffen – schließlich sind es die Bevölkerungen selbst, die seit Jahrzehnten der Überzeugung gefragt und ungefragt Ausdruck verschaffen, dass es ›so‹ nicht weiter gehen kann, was immer ›es‹ und ›so‹ dabei bedeuten mögen.
Der Grund der Verstörung ist damit nicht benannt. Wie aus den Wunden der vorangegangenen Epoche das ›Trauma‹ wurde und aus dem Trauma der Wunsch nach einer – gleichwohl energisch zurückgewiesenen - ›Normalität‹, dieser verwickelte und in der Mischung von Opfer- und Täterperspektiven verstörende Vorgang grundiert zuletzt die Geschichte der Reformen im Westen wie im Osten und macht sie entzifferbar wie die Beschriftung einer Uhr, die man ohne hinzusehen zu kennen glaubt. Letzteres ist vermutlich sogar richtig, da der Beobachter notgedrungen immer Teil der Bewegung ist, aber es enthält auch eine spezifische Form der Blindheit, die auffällt, haben erst einmal andere Akteure die Bühne betreten, die anders traumatisiert sind oder zur Abwechslung einmal mit dem Begriff ›nichts anfangen‹ können. Dann besinnt man sich auf ›Identität‹ – was immer da Besinnung heißen und welche Resultate sie auch zeitigen mag. Das galt im Westen, als der Osten dazustieß, es galt ein wenig zeitversetzt im Osten, als das Ausmaß der Übernahme durch den Westen sichtbar wurde. Im Zeitalter der neugewonnenen Normalität hat man es vielleicht eher mit einer vagabundierenden Identität zu tun, einem Bedürfnis ohne Anker, das sich dem Medienrummel an die Brust wirft, um sich von ihm abstoßen zu lassen. Nation, Religion, ›Kultur‹ - jedes Stichwort ist aufrufbar und versinkt umgehend in einem Meer falscher ›Erinnerungen‹, von dem allerlei Leute sich Aufschluss erwarten und das doch nichts weiter ausspuckt als das Altbekannte.
2.
Unter den liegengebliebenen Schriften, deren Ansehen nach Jahrzehnten der Vernachlässigung unaufhaltsam zu wachsen scheint, zählt Eric Voegelins monumentale Studie Order and History zu den alten Bekannten. Das englischsprachige Original war stets greifbar und viele Studenten mögen die Bände in den Händen gewogen und wieder ins Regal gestellt haben, weil der Seminarbetrieb eine Lektüre nicht nahelegte und man angesichts der wenig zeitkonformen Sprache nicht recht wusste, woran man damit war. Es ist das Los der Glücklichen und der Begabten, gleichsam unverständigt auf gesellschaftliche Grundwellen zu stoßen und auf lange Zeit hinaus verschollen zu sein, obwohl gerade dann jedem Einsichtigen die Brisanz ihrer Überlegungen verständlich sein sollte. Sie ist es nicht oder höchstens in einer merkwürdig kraftlosen Form, die den Arbeiten das bloße Überleben sichert, aber keine fruchtbaren Debatten hervorbringt. Eric Voegelins Überzeugung, die Moderne als eine Periode ›gnostischen‹ Denkens dingfest machen und kritisieren zu können, hat lange Zeit jenes erasmische Lächeln auf die Gesichter der Auguren gezaubert und mehr oder minder zuverlässig verhindert, dass der kritische Hauptgedanke, von religionspädagogischen Zusätzen gereinigt, in die Köpfe derer hätten eindringen können, die damit außerhalb des Seminars gesammelte Erfahrungen verbunden hätten. Voegelin war lange Zeit so sehr ›out‹, dass sich die Frage nach dem Sachgehalt seiner These von selbst erledigte, weil er ebenso offenkundig wie tot zu sein schien.
Man kann das noch immer verstehen, wenn man den achten Band der in den letzten Jahren unter dem Titel Ordnung und Geschichte erschienenen deutschen Ausgabe mit dem Titel Das ökumenische Zeitalter – die Legitimität der Antike (herausgegeben von Thomas Hollweck, aus dem Englischen von Wibke Reger) mit Blumenbergs seinerzeitigem Abräumer, Die Legitimität der Neuzeit (1966), zusammenliest. Blumenbergs gegen die Säkularisationsthese gerichteter Vorstoß räumte den Weg frei für ein trotziges Bekenntnis zur Moderne, das den christlichen Traditionalismus, der in der Moderne nur einen Irrweg, ein Selbstmissverständnis des abendländischen Menschen zu erkennen glaubte – nach dem vehementen Glaubwürdigkeitsverlust teleologischen Geschichtsdenkens die naheliegendste Vorstellung – in die Schranken wies und die Geschichte der Welt- und Geschichtsdeutungen selbst als offenen Prozess beschrieb. Anders Voegelin, den die Überzeugung von der Illegitimität der Moderne am Legitimitätsdenken selbst zweifeln lehrte. Was bei ihm, in vielfachen Anläufen erläutert, ›Gnosis‹ heißt, der Verlust der platonischen »Seinsspannung«, produziert grosso modo jenen säkularen Geschichtsbegriff, durch dessen heilsgeschichtliche Dekonstruktion Löwith seinerzeit den Nachkriegs-›Modernediskurs‹ in Gang gesetzt hatte und den seither die Theorie des kulturellen Gedächtnisses aufzulösen trachtet, die auf der Distanz zur identitätsbildenden Geschichtserzählung bestimmter Gesellschaften beharrt, aber diese Distanz nicht anders zu begründen weiß als durch die Rekonstruktion eines kulturellen Vorwissens, das diese Erzählungen konstituiert und den in ihnen wirksamen Deformationen lesbar werden lässt. Zweifellos liegt darin eine Möglichkeit, Voegelins Perspektive ›fruchtbar‹ zu machen. Ihr Nachteil liegt in ihrer unreflektierten Ambivalenz gegenüber dem Stand des zeitgenössischen Nachdenkens: einer Metamodernität, die an diese sehr alten Dinge erinnert und in der Theorie des kulturellen Gedächtnisses unmerklich mit diesem selbst verschmilzt, da sie keinen anderen Modus des Präsentwerdens kennt. Anders gesagt: dort, wo Voegelins Unternehmen ›Kritik‹ wird – und damit die kritisierte Moderne unterschwellig mitträgt –, präsentiert sich die Theorie des kulturellen Gedächtnisses als ein Stück Zeitbewusstsein, das sich in alle gängigen Kontexte einzuschreiben sucht.
Doch Bewusstsein ist nicht nur Zeitbewusstsein, sondern vorgängig Bewusstsein in der Zeit. Vielleicht ist ›Seele‹ in nachfreudianischen Zeiten kein glücklicher Terminus für das, was der Philosoph im Blick hat, andererseits bezeichnet er ohne Umwege die lebendige Einheit unter den Bedingungen des Bewusstseins, hinter das keiner zurückgelangen kann, es sei denn um den Preis möglicher Selbstauslöschung. Das ironische Gebaren gehirn- oder systemtheoretisch Versierter, die im Bewusstsein wenig mehr als das trügerische ›Ich bin‹ zu erkennen vorgeben, das zu faul ist, sich Rechenschaft darüber abzulegen, was ›da‹ ist und welche Prozesse ›da‹ stattfinden, wird an dieser Stelle zur Dauergrimasse, die man sich auch schenken kann. Was immer sich im Bewusstsein ›abspielt‹ und wie schwer oder leicht es fällt, sich darüber zu verständigen – es liegt schon bereit und wartet geduldig, dass sich jemand mit ihm befasst. Das kann lange dauern, Bewusstsein hat Zeit. Ob es seinen Trägern deshalb allerdings auch freisteht, die menschlichen Dinge – im Sinne eines radikalen Konstruktivismus – beliebig zu entwerfen oder ob es möglich ist, sich zu verfehlen, diese Frage ist nicht nur an die klassische Philosophie zurückzugeben oder an Ethologie und Gehirnforschung zu delegieren, sondern auch – und über beide hinaus – an die Geschichte der menschlichen Ordnungsvorstellungen und Ordnungssysteme zu stellen. Für Voegelin und seine aufmerksamen Leser kommt es folglich darauf an, letztere in einen Interpretationsraum zu betten, in dem sie die ›lebendige Einheit‹ ein Stückweit enthüllen und von ihr enthüllt werden. Zwischen platter Anpassung an veränderte Umwelten und dialektischem Prozess öffnet sich hier ein Drittes, der Weg der Selbstöffnung. Seit Blumenbergs zweideutiger Rettung der Moderne, so könnte man, wenn auch nicht ohne Ironie, sagen, wurde die von Voegelin diagnostizierte Grundspannung dessen, was er ›Seele‹ nennt, in eine Art Reform-Spannung übersetzt, den Symbolismus einer Bewegung, deren Nachher ebenso imaginär wie ihr Vorher unterdeterminiert ist. Dieser Symbolismus lässt sich nicht durch den Verweis auf ein großräumiges Menschheitsgedächtnis interpretieren oder vornehm-konservativ distanzieren. Wenn er ein Problem aufwirft, dann liegt es weniger im kulturell interpretierten Vergessen als in der Art und Weise, wie legitimierende und delegitimierende Züge in ihm ineinandergreifen und die Delegitimation selbst zu einer Art legitimierender Instanz wird.
3.
Das Drama, für das die Schrift Order and History steht, ist bekannt: es besteht, nach der Toynbee und anderen folgenden Dezentrierung der europäischen Geschichte in der Dezentrierung der Geschichte selbst. Auch Voegelin ist dem geschichtsphilosophischen Dilemma nicht entgangen, alle Geschichte zur Vorgeschichte zu degradieren und im gleichen Zug dem ungreifbaren Sinn des Jetzt die Sinnhaftigkeit des Vergangenen zu supponieren. Seine Überlegungen zum »noetischen Feld«, zur »partizipatorischen Suche nach der Wahrheit«, zur »Realität der ES-Geschichte«, die sich in den Geschichten, aus denen Geschichte besteht, »selbst erzählt«, lassen das seinerzeit noch ungewöhnliche Modell eines multilinearen Ablaufs der Geschichte, das sie interpretierend erschließen sollen, in dem Maße hinter sich, in dem sie der Genese der einen Gegenwart ihre sich stets der gleichen begrifflichen Mittel bedienenden Diagnose vorziehen. Am Ende stehen gerade die Texte, deren Sinn – oder Unsinn – durch die erzählte Geschichte erschlossen werden sollte, monolithisch im Raum der Kritik, von der die historische Suche ihren Ausgang nahm. Wie weit die tragende Intention der frühen Bände in diesem theoretischen Desaster verschwindet, ist eine Frage, eine andere, wie weit das Desaster reicht und was sich an seinen Rändern erkennen lässt.
Die Preisgabe des universalhistorischen Paradigmas, der ›großen Erzählung‹, ist in den letzten Jahrzehnten ein Gemeinplatz geworden, auf dem sich Phrasendrescher aller Art ein Stelldichein geben. Das Erregende des Voegelinschen Abbruchs scheint damit in einem historischen Loch zu verschwinden: er mag als Vorläufer einer Verschiebung der Begriffe dahingehen, die im Allgemeinen wenig mehr ist als der Versuch, das abhanden gekommene, in all seiner Vielfalt rückblickend erschreckend monoton anmutende Paradigma als entrücktes im Denken festzuhalten. In seiner wissenschaftsalltäglichen Form profiliert sich dieses Festhalten – nach dem Motto ›Haltet den Dieb!‹ – gegen jeden zeitgenössischen oder hermeneutisch am Leben gehaltenen Versuch, Prämissen zu bewahren, die den weltgeschichtlichen Versuchen zugrundelagen, welche immer es gewesen sein mögen. Die durchgreifende Prämisse, jedes historische Phänomen als rätselhaft und unendlich entzifferbar zu begreifen, endet an dieser Pforte: man ist immerfort im Bilde und jeder interpretierende Gedanke nimmt die Form eines Nachtrags an, dem andere Nachträge folgen, ohne doch am Gesamteindruck etwas verändern zu können. Wir wissen, was das historische Denken der Vorfahren angeht, Bescheid und stehen außerhalb dieses Stroms, gleichsam auf dem festen Boden eines Denkens, das gelernt hat, der Metaphorik der festen Böden und zureichenden Gründe abgründig zu misstrauen.
Man hat sich angewöhnt, ›Geschichtsphilosophie‹ – also alle Arten welthistorischer Entwürfe – als ein Phänomen der Moderne zu betrachten, gleichsam als Explikation ihrer innersten Überzeugung und als Epizentrum der diversen Revolutionen, in deren Abfolge sie sich die Erde untertan gemacht hat. Kritik der Geschichtsphilosophie ist daher Kritik der Moderne oder war es einmal, wenn man dieses Geschäft platterdings als erledigt betrachten möchte. In Voegelins Kritik der Hegelschen Geschichtsphilosophie ist viel von diesem alten Streitgeist zu besichtigen, der sich im späten Nachhinein als äußerst befangen darstellt. Man kann sich auch fragen, ob jene dem platonisierenden »Zwischen« (»Metaxy«) zugewiesene Verflüssigung der Begriffe im Übergang zwischen den verschiedenen Explikationsstufen des Bewusstseins nicht selbst dem mächtigen Vorbild des verachteten Hegelschen Denken geschuldet ist. Dessen Angekommensein in der Gegenwart hat gegenüber der unverhohlenen Reaktivierung chiliastischer Potentiale bei Marx und anderen immerhin den Vorteil der Zweideutigkeit, denn diese Gegenwart ist zugleich bekannt und – in ihren Potentialen – unbekannt: sie bewegt sich, wirft also von Tag zu Tag neuen Stoff für ein Nachdenken auf, das nicht bereits in seinen Vorentwürfen verschwunden ist. Bleibt das Angekommensein selbst als Stein des Anstoßes, doch gerade das ist nicht per Beschluss, der sich theoretisch drapiert, wegzubekommen: Die Dekonstruktion selbst atmet einen finalistischen – und finalisierenden – Geist, der jedem, der noch nicht die Weihen erhalten hat, den Atem verschlägt.
Voegelins späte Identifikation der modernen Geschichtsphilosophie mit jenem alten und weitverzweigten Typus der ›Historiogenesis‹, der genetischen Rekonstruktion der Gegenwart in sorgfältig kalkulierten Schritten, die deren Legitimität – und gelegentlich, wie bei den Denkern der Moderne, Superiorität – sicherstellen sollen, gleicht, bei Licht betrachtet, einer Verzweiflungstat. Auch ihr liegt der Gestus des Nichts-anderes-als zugrunde, den Voegelin kritisiert und der das Hütchenspiel der Modernen bestimmt. Dass Bewusstsein nichts anderes sei als eine Funktion des Gehirns, diese Überzeugung hat der Phänomenologie viel von ihrem Kredit geraubt, ohne dass die Neurologie oder eine andere einschlägige Disziplin ihre Stelle einzunehmen in der Lage gewesen wäre. Dass die genetische Rekonstruktion der Gegenwart die Geschichte – alle Geschichte – zur Vorgeschichte dieser Gegenwart degradiert, ist vielleicht weniger unumgänglich als ihre Festschreibung als die eine Geschichte, wo es doch immer eine irreduzible Pluralität von Geschichten gibt, die in bestimmten Bereichen konvergieren mögen, in anderen in kaum vergleichbare Entwicklungen und Ereignisfolgen auseinandertreten. Und letzteres ist vielleicht weniger unumgänglich als die Einsicht, dass auch diese pluralen Geschichten von unterschiedlichen Standpunkten aus entworfene sind, dass es sie also keineswegs gibt, weil diese bestimmten Ereignisfolgen per se Geschichtsrang beanspruchen. Wer daraus allerdings ableiten wollte, dass die theoretische Durchdringung der gegenwartsbezüglichen und tendenziell gegenwartsverändernden Suchbewegung, die jeder nicht ausschließlich faktenorientierten oder dem Irrwitz bloßer Konstruktion folgenden Geschichtstheorie nolens volens zugrundeliegt, dem legitimierenden Gebrauch der historischen Vernunft einen zuverlässigen Riegel vorschieben könnte, der hätte die umfassende und irreduzible Präsenz von Legitimation ebenso wenig erkannt wie die Volatilität ihrer Erscheinungsformen.
Der Relativismus ist die zwangsläufige Gedankenlosigkeit der sich unheimlich gewordenen Moderne. Der Begriffsrelativismus, der darauf besteht, dass die Eindeutigkeit der Begriffe und ihre Festigkeit im Fluss der Bedeutungen ein vielleicht mit einer gewissen Zwangsläufigkeit auftretender, aber zu den Verheerungen einer falschen Wissenschaft und einer falschen Politik führender Schein sind, wünscht gerade in diesem Punkt mit Eindeutigkeit und Festigkeit aufzutreten – er leitet aus ihm das Recht zu jeder, gelegentlich auch billiger Polemik ab. Ihn gedankenlos nennen setzt voraus, dass man den Gedanken zu benennen weiß, der ihn so entkräftet oder transformiert, dass er nicht länger als zwingende Antwort auf das mit dem Konzept ›Moderne‹ verbundene Transformationsdilemma durchgeht. Worin besteht dieses Dilemma? So wie Wissenschaft als Projekt zur Erzeugung von wirklichem Wissen das wahre, sprich angenommene Wissen beiseitesetzt, so setzt Moderne als Projekt zur Erzeugung der einen Welt die Einheit der Welt von Fall zu Fall einer Zerreißprobe aus, der sie sich nicht gewachsen zeigt. Entweder gelten die Sätze der Wissenschaft oder sie sind bereits im voraus durch die Annahme entkräftet, dass irgendwann bessere, homogenere, adäquatere oder kohärentere an ihre Stelle treten werden. Entweder ist der Weltprozess beschreibbar oder er ist ein im voraus durchschautes und entkräftetes Phantasma, mit dessen Beschreibung die immer bereits im voraus gegebene Einheit der Welt zugunsten der einen oder anderen Partei missdeutet und ›aufgehoben‹ werden soll. Die erste, modernekonforme Antwort auf das Dilemma bietet der Perspektivismus, der sich die Ambivalenzen des Begriffs ›Beschreibung‹ zunutze macht: was eben noch autoritativer ›Begriff‹ war, ein Ergreifen der Wirklichkeit in Worten, ist jetzt Notat, die zeichenhafte Repräsentation von etwas Abwesendem, in der das In etwa So und das So nicht sich in produktiver Weise die Waage halten. Aber woher sollte die Waage kommen? Es gibt diese Waage nicht, der imaginierte Ausgleich ist selbst ein Stellvertreter des abwesenden Begriffs, er ist die Figur, mit dessen Hilfe der Begriff als durchgestrichener erscheint – dämmerhaft, unberufbar und mit ungewissen Konturen. So wie das Konzept ›Moderne‹ die eine Welt voraussetzt und zerstückelt, so setzt der Perspektivismus die Konvergenz der Deutungen implizit voraus und schließt sie kategorisch aus. Der Relativismus signalisiert die bleibende Ungewissheit darüber, welches Stück Welt in aller Verständigung gemeint ist und an welcher Stelle innerhalb unabsehbarer Verständigungsprozesse dieses Stück Verständigung steht. Gerade in diesem Punkt beansprucht er Gewissheit. Die Ortlosigkeit dieser Gewissheit macht ihn zu einer bequemen Berufungsinstanz, deren Nutzen paradoxerweise in ihrer Nutzlosigkeit liegt. Der Relativismus verändert keinen Begriff, kein Argument, kein Modell, keinen Anspruch – er verändert nur den Modus des Vorzeigens. Das relative Recht auf die eigene Auffassung kann eine formidablere Waffe im Streit der Repräsentationen sein als jeder Dogmatismus. Es ist die letzte, schlechthin unhintergehbare legitimatorische Gebärde: Wer zugibt, ›eigen‹ zu sein, konzediert nur, was ohnehin jeder weiß. Auch Voegelin – wie sollte es anders sein – ist ein Moderner: Wer, wie er, die Rhetorik der ›Suche‹ an die Stelle jeder Gewissheit setzt, verpflichtet sich einer delegitimierenden Bewegung, die die Frage nach der Legitimität dieses rhetorischen Beharrens hinter den Horizont des zulässigen Fragens verbannt.
4.
»Das Meinungsklima unserer Zeit hat ein soziales Feld von beträchtlicher Macht hervorgebracht. Jeder, der es wagt, innerhalb des Bereichs dieses Meinungsdruck zu denken, muß mit einer Vielfalt von Widerständen gegenüber dem Denken rechnen. Diese Widerstände sind nicht zu Ende gedacht – sonst würden sie gar nicht existieren; sie beziehen ihre gesellschaftliche Kraft aus dem Umstand, daß sie habituell geworden sind – bis zum Grad einer automatischen Reaktion. Ich nehme an, daß der Leser in seinem Bemühen, die gegenwärtige Analyse zu verstehen, unter demselben Druck leidet wie ich, wenn ich diese Analyse durchführe und sie niederschreibe.« (Bd. 10, Auf der Suche nach Ordnung, S. 30) Der ›Meinungsdruck‹ richtet sich nicht gegen die Metaphorik der Suche – im Gegenteil: sie ist in ihm weitgehend automatisiert und aufgehoben. Dass Moderne ›unterwegs‹ ist, dass sie das Ziel nicht kennt, dass es ›verhüllt‹, jenseitig, mit Bilderverboten behaftet und der Konstruktion nicht zugänglich sei, gehört zum gedanklich-verbalen Basisrepertoire, das nur um den Preis der Lächerlichkeit aufgegeben werden kann. Der Druck ist daher mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit dem Konformismus der Wörter wie dem »sozialen Feld« geschuldet, das Zeitgenossenschaft heißt, und am Ende haben beide mehr miteinander zu tun als Voegelin zugeben darf.
Dass in allen realisierten oder als ›Projekt‹ aufgelegten politischen Ordnungen, in jeder wirksamen Ordnungssymbolik die ›Ordnung der Seele‹ – das in jedem Sinn des Wortes unhintergehbare Bewusstsein – aufscheint, sich reflektiert und als Faktor der Unruhe, des Nicht-Angekommenseins bemerkbar macht, ist eine Interpretation dieser Suche, die Voegelin zwar nicht mit allen, aber doch mit mehr Zeitgenossen teilt, als das Bild des Meinungsdrucks verrät. Sie gehört zum Kernbestand einer Anthropologie, die in der Ausrichtung aller ›bestehenden‹ Verhältnisse auf den Faktor ›Reform‹ den dynamischen Ausdruck menschlichen Weltverhaltens erkannt zu haben glaubt. Wir wissen nicht, ob und wie weit Voegelin sich in dieser Reformgesellschaft angekommen gesehen hätte. Dass Ordnungssymbole mehr oder weniger defizitär sein, dass sie illegitime und damit Unordnungsanteile enthalten können, dieser mit der Überzeugung einhergehende Gedanke, dass die Unordnung in der Moderne habituell geworden ist, schließt ja den anderen ein (oder zumindest nicht kategorisch aus), dass es eine gelungene politische Symbolik geben können muss, in der die illegitimen Anteile marginalisiert und wiederum extremen sekundären Interpretationen – politischen Häresien – vorbehalten wären. Durchaus möglich also, dass das Ordnungssymbol ›Reform‹ zu den gelungeneren zählt, dass es der Grundspannung der Seele vielleicht in höherem Maße Rechnung tragen könnte als andere, mit denen der Weg in die von diesem Denker erlebten und reflektierten Katastrophen gepflastert war.
Ob allerdings zum Beispiel das neoliberale Drängen auf Reform, hinter dem ein auf Reinheit der Rahmenbedingungen zielendes Ordo-Modell steht, zu den legitimen Verwendungen des Symbols zählte, wäre dann sehr die Frage. Die immer notwendige Reform der Reform enthält die Gefahr, dass der ›unabdingbare‹ Reformimpuls paralysiert oder durch ein aggressives, zähes und gleichsam unterirdisches Vorgehen von Interessengruppen, die in langen Zeiträumen denken, willentlich fehlgedeutet und als billiger Transmissionsriemen missbraucht wird – der lange Marsch durch die Institutionen steht jedem frei, der sich zu maskieren weiß. Man kann die Frage aber auch radikaler stellen. Ist es wirklich so unproblematisch, in der primären Suchbewegung, die vielleicht jeder menschlichen Kultur zugrundeliegt, den Primat des Politischen als eine völlig unbezweifelhafte Gewissheit festzuhalten? Steckt nicht ein unreflektierter Platonismus in der Annahme, die Politik sei das Feld menschlicher Gestaltfähigkeit schlechthin und damit gleichsam die wahre Repräsentation der ›Suche nach Ordnung‹? Könnte es nicht sein, dass die Universalisierung der Politik, ihre theoriegesteuerte Unfähigkeit zur Selbsteindämmung, eine der Erscheinungsformen jener hybriden, auf Explikation und Konstruktion drängenden Moderne darstellt, gegen die Voegelin seinen theoretischen »Widerstand« wendet? Gut möglich, dass die konkurrenzlos gedachte Politik unter die Verfehlungen zu rechnen ist, zu denen eine schlecht begriffene Politik tendiert. Unter ihre Fehlleistungen könnte die liberal genannte Schaffung künstlicher ›Freiräume‹ ebenso fallen wie ihre Abschaffung oder Verlegung durch anderweitig interessierte Machthaber. Auch eine gute Politik wird zur Gefahr, wenn sie Gestaltungsfelder für sich entdeckt, die zwar kostengünstiger zu bearbeiten sind als die halbwegs gerechte Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen, deren eigentümliche Repräsentation aber unter dem administrativen Zugriff kollabiert. Theorie selbst hat die fatale Tendenz, von ihren äußeren Schicksalen – und den Strukturen, in denen sie stattfindet – als einem Tummelplatz politischer und sozialer Obsessionen zu handeln und das eigene Feld auf diese Weise zu objektivieren. Noch fataler allerdings ist ihr Hang, sich unliebsamer Konkurrenz im Kampf der Weltdeutungen und der Machtzugänge durch Irrelevanzbescheinigungen zu entledigen.
5.
Die ›Luminosität‹, die Offenheit für Einstreuungen, die sich einem ansonsten unzugänglichen Jenseits der als Funktionszusammenhang begriffenen Psyche verdanken – das ist Voegelins Gegenpol zur entwerfenden und selbstexplikativen Potenz, über dessen Anwesenheit sich die metaphysisch genannte ›Grundspannung‹ im Bewusstsein aufbaut, die letztlich darüber entscheidet, welche Handlungen gerecht oder ungerecht, welche politischen Systeme lebbar oder verwerflich genannt zu werden verdienen. Letztlich ist dies die Instanz, die der Geschichtsphilosophie als einem explikativen Verständnis vom ›Gang‹ des menschlichen Geistes und der Ausbildung entsprechender Ordnungsformationen den Garaus macht. Das meint nicht, dass Geschichte springt, dass sie aus dem gedanklich geordneten oder klug diagnostizierten Entwicklungsgang auszubrechen vermag, es bedeutet auch nicht, dass der ›Beobachter‹ resigniert feststellen muss, dass auch er nur ein Teil des Systems ist und deshalb in seiner Funktion der Systemrationalität verpflichtet bleibt. Es bedeutet eher, dass Geschichte kein Tribunal ist, vor der sich der Einzelne zu verantworten hätte. Die Sinnlosigkeit der Geschichte ist hier nicht radikal, sondern deliberativ gedacht: Wenn die Verantwortung vor den Instanzen des Bewusstseins größer ist als die vor jeder Vor-, Mit- oder Nachwelt, dann ist der Sinn, den man in der Geschichte findet, keiner, der einem selbst die Position in ihr zuweist, sondern eher die aufzunehmende Spur von Artikulationen, über die es gelingt, die eigene Transzendenzerfahrung ein Stückweit zu exponieren.
Ordnungssymbole in der Geschichte sind daher immer kompakt und explikativ. Kompaktheit im Sinne von Nicht-Explikativität ist vornehmlich dort zu erwarten, wo sich keine lebendigen Symbole für die Unhintergehbarkeit des Bewusstseins finden, also in den frühen kosmologischen Symbolisierungen vor dem »Seinssprung« sowie in den rhetorischen und begrifflichen Überblendungen des transzendenten Erfahrungssinns historisch gefundener und weiterhin verwendeter Symbolnetze. Solche Überblendungen findet Voegelin in der Antike ebenso wie in den zeitgenössischen Objektivierungen etwa der Psychoanalyse und kurrenter politischer Ordnungsvorstellungen. Unter den falschen Weichenstellern nimmt Hegel einen prominenten Nischenplatz ein: hier, in den Denkfabriken der ›Selbstbewegung des Begriffs‹ und des ›seiner selbst gewissen Geistes‹, sieht er nicht zu Unrecht den Gegenpol dessen, worum es ihm in aller theoretischen Bemühung geht. Doch wie es mit dem Bemühen so geht: es ist dem Bemühten nicht so leicht zu entkommen, wie es dem vornehmlich seiner eigenen Bewegtheit vertrauenden Gemüt vorkommen will. Man nehme – was professionellen Interpreten und Kritikern nicht schwer fällt – den differenzierten Sprachwitz, die gelegentlich tödliche, keineswegs jedoch tote Ironie aus den Hegelschen Explikationsgängen heraus und das Gebäude, das sie errichten, fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Etwas Analoges gilt in Bezug auf den Kritiker: man nehme den tiefen Ernst aus seinen Versuchen heraus, der Deformation auf die Schliche zu kommen, und sie fallen unweigerlich dem Gelächter derer anheim, die ›ihren Hegel‹ am Schnürchen haben. Dass der Witz, die paradoxe Wendung, das Spiel mit der Zweideutigkeit der Wörter, die ironische Stellung zur Sprache insgesamt den Begriff überhaupt erst hervorlockt und seine Differenz zur platten ›Begrifflichkeit‹ des Wissens markiert, dass in dem so ›konzipierten‹ Begriff die ›Grundspannung‹, an der dem Kritiker so viel liegt, vielleicht eher anzutreffen sein könnte als in der gebetsmühlenhaft wiederholten Ermahnung, sie nicht zu vergessen – eine solche Erwägung findet sich in diesem Werk nirgends. Und das ist schade.
Das Ärgernis allen Relativismus – und die Vokabel der Suche gehört zu den Basissymbolen dieser Denkrichtung selbst dort noch, wo der Verweis auf das ägyptische Totenbuch die Jenseitsfahrt als Relativierung einer verkrusteten Diesseitsordnung in Anspruch nimmt – besteht darin, dass er seinen Einsichten dieselbe Festigkeit im Ausdruck geben muss, die er kritisiert. Das gilt auf der Ebene der Wörter wie der Begriffe. Die Entwertung des gegenwärtigen Weltwissens – mitsamt dem Stand der Wissenschaften, der darin eingeschlossen ist – durch den Verweis auf künftiges entwertet sich selbst. Ebenso ergeht es der Entwertung eines bestehenden Weltverhältnisses durch den Verweis auf die innere Unbehaustheit dessen, der in ihm steht. Die Behauptung schließlich, man könne Geschichte auch immer anders schreiben als es gerade geschieht, und deshalb könne es keine große Erzählung geben, die nicht bereits obsolet sei, trägt den Irrsinn dessen, der seine Phantasie gerade dort prinzipiell herausstreicht, wo ihm nichts einfällt: Es ist nicht sein Tag. Unreflektiert bleibt in all diesen Überlegungen, dass das ›verfügbare Wissen‹ genauso unverfügbar ist wie das aufgrund der Unverfügbarkeit der Zukunft gegenwärtig nicht zur Verfügung stehende. Es ist unverfügbar, weil keine gedachte Synthese die Gegenwart vollständig integriert. Wohl aber integriert das Gedachte selbst diese Gegenwart – es ist sie in der Weise des Denkens, im Bewusstsein, von dem bei Voegelin so viel die Rede ist. Was aber gedacht ist, ist dem Denken und seinen künftigen Synthesen grundsätzlich zugänglich. In dieser Hinsicht ist die Gegenwart der Austragungsort aller Spannungen, aller Konflikte und Dissense und gleichzeitig diese Gegenwart – Inbegriff und Zusammenschau aller Menschheitsgeschichte, die als bisherige im Heute, soll heißen, in den heute aktiven Köpfen versammelt ist. Man kann auf diesen einfachen Gedanken das Etikett ›Hegel‹ kleben, man kann es auch lassen.