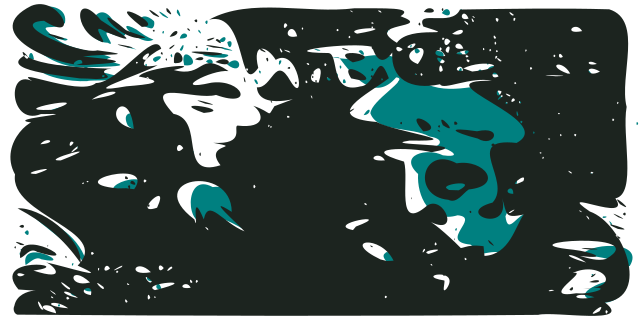Von der Kulturnation der Deutschen war in der Vergangenheit viel die Rede. Sie galt als Klammer zwischen den beiden Deutschland, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, um durch die ›Einheit‹ (die nach dem Willen ihrer Verächter keine ›Wiedervereinigung‹ sein durfte) 1990, nun ja, nicht ersetzt, doch zumindest in ihrer staatlichen Getrenntheit kassiert zu werden. Seither, vor allem während der letzten Merkel-Jahre, schwang das Pendel des nationalen Selbstverständnisses in die andere Richtung. Das ging bis hin zu der denkwürdigen Aussage einer deutschen Integrationsbeauftragten, eine deutsche Kultur sei jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar. Die Edition Europolis hat verdienstvollerweise einen ursprünglich im Jahrbuch für Kulturpolitik 2015/16: Transformatorische Kulturpolitik erschienenen Essay des Schriftstellers Friedrich Dieckmann als Separatdruck in drei Sprachen (deutsch, französisch, polnisch) herausgebracht, der Herkunft und aktuellen Gehalt des Begriffs unter verschiedenen Gesichtspunkten unter die Lupe nimmt.
Hätten Sie’s gewusst? Der Theologe Otto Zöckler hat das Wort 1879 »in die deutsche Sprache eingeführt« (5) – also deutlich nach der Gründung des Bismarckreiches, das derlei Verrenkungen, sollte man denken, eigentlich überflüssig gemacht hätte, sieht man davon ab, dass der neue Staat sich seine Legitimation in der Vergangenheit holte und das Verhältnis zur Donaumonarchie, jedenfalls ihrem deutschen Teil, gewisse Sprachregelungen erforderlich machte. Dabei hatte Zöckler wohl nichts spezifisch Deutsches im Auge – eher handelt es sich um einen analytischen, von ihm im Plural gebrauchten Begriff: so selbstverständlich sind ›Cultur‹ und ›Nation‹ im Zeichen des Nationalstaates miteinander verbunden, dass ein Begriff vonnöten ist, der ihren vor- und frühstaatlichen Zusammenhang sinnfällig macht. Den hatte zwar Herder, wie Dieckmann sachkundig ausführt, bereits mit dem Ausdruck ›Nationalkultur‹ in den europäisch-nahöstlichen Raum projiziert und damit identitätspolitische Beben ausgelöst, die unter anderem im frühen zwanzigsten Jahrhundert zur Auflösung des österreich-ungarischen Staates führen sollten. Aber der Autor wechselt klugerweise rasch zu Schiller über, der in seiner Antrittsvorlesung den erreichten ›Grad‹ der Nationalkultur samt ihren Ingredienzien (Sprache, Sitten, ›bürgerliche Vorteile‹, ein gewisses Maß von Gewissensfreiheit) anspricht: im Mai 1789, zur Zeit der Einberufung der französischen Generalstände, eine ›welthistorische‹ Geste, die – am Vorabend der bürgerlichen Revolution – das Selbstbewusstsein insbesondere des Dritten Standes herausstreicht.
Dieckmann – so jedenfalls lassen sich seine Ausführungen lesen – datiert den Beginn der deutschen Kulturnation (oder des dahinterstehenden Bedarfs) auf das von Napoleon auf dem Schlachtfeld erstrittene Ende des mittelalterlichen Reiches: eine nichtstaatliche Klammer muss her, um den Verlust zu kompensieren: »Das ist nicht des Deutschen Größe / Obzusiegen mit dem Schwert. / In das Geisterreich zu dringen, / Vorurteile zu besiegen, / Männlich mit dem Wahn zu kriegen / Das ist seines Eifers wert.« (8) Das ist, nach allen staatlichen und nichtstaatlichen Wahnzuständen, die noch kommen sollten, ein großes Wort, das selbst in Corona-Zeiten einen Hauch von Aktualität bewahrt. Es markiert auch, durch den Hinweis auf die religiöse Befreiungstat Luthers, den fortdauernden Riss, der durch die Nation geht und sich nach dem Ende der konfessionellen Auseinandersetzungen andere Themenfelder suchte. Deutschland – genauer: der deutsche, heute: deutschsprachige Kulturraum – ist und bleibt das ideologische Schlachtfeld Europas, daran haben weder Teilung noch Einheit etwas zu ändern vermocht.
Sinnfällig zeigt sich das auf dem Gebiet der Literatur. Hier präludierte die Revolution von 1989, anders als die von 1789 und 1917, einem beispiellosen Niedergang bis hin zum fast vollständigen Bedeutungsverlust. Was heute in Deutschland ›Belletristik‹ heißt, ist prolongierte Vergangenheitsbewältigung und Vorlagenproduktion fürs Heimkino. Die Germanistik hat sich von der Nationalliteratur verabschiedet und kocht ihre postnationalen Süppchen. Die Gesellschaft bedankt sich dafür mit Nichtachtung. Die Politik ist illiterat in Sprache, Gestus und Zitatenschatz und das sogenannte gebildete Bürgertum vermisst nichts. Zweifellos zeigt sich auch darin ein erreichter ›Grad‹ an Nationalkultur. Allerdings unterscheidet er sich nicht wesentlich (es sei denn durch eine gewisse Impertinenz) von dem, der sich in den benachbarten Kulturen antreffen lässt. Wen kümmern im vereinten Europa französische, italienische, spanische polnische, schwedische, tschechische oder niederländische Autoren? Die unalltägliche Literatur ist etwas für unter Rechtfertigungszwang gesetzte Spezialisten geworden, die sich furchtsam vor der allgegenwärtigen, sich als ›politisch‹ maskierenden, in Wahrheit nichts als eine primitivistische Aura verströmenden Aufpasserei verdrücken. In der Merkel-Gesellschaft stört die Nation, da stört es nicht, dass die Literatur nicht mehr stört.
Das kulturelle Europa pflegt die Illusion, populärer Schwachsinn lasse sich leichter zusammenfügen als anstrengende Differenziertheit. Er lässt sich nach Belieben zusammenschütten, das ist wahr. Genauso leicht fällt er auch wieder auseinander. Das ist vielleicht sogar beabsichtigt. Aber dieses europäisierte Europa bildet einen ironischen Chor zu Sätzen wie: »Einmal mehr zeigte sich: nur eine in der Eigenart des Volkes wurzelnde und von dieser Basis nach allen Zeiten und Zonen ausgreifende Literatur kann weltliterarisch bedeutsam werden.« (11) Kein Zweifel, so dachten die Klassiker, so dachte das neunzehnte Jahrhundert, so ratterten Germanisten des zwanzigsten Jahrhunderts es herunter, während ganz andere, drängendere Gedanken ihr Gehirn umflatterten. Aber stimmt es auch? Schon die klassische Moderne zeigte wenig kulturellen Gemeinsinn. Sie nahm die ›Eigenart des Volkes‹ mit Gesten stummer Verzweiflung in ihr Repertoire auf, aber Wurzeln schlagen wollte sie darin nicht. Wer Nietzsche kennt, kennt das Leiden am deutschen ›Geist‹. Heute ist man froh, in den Weiten des Internet einen verwandten Kopf zu finden. Die sprachlichen Schranken stören da nur. Dennoch bestehen die Kulturräume weiter, und sei es nur als ›Problem‹. Weiter bestehen auch die Staaten, die weiterhin dort am effizientesten funktionieren, wo die Nation den kulturellen Code vorgibt. Doch es ist mit der Kultur wie im Leben: Alles, was sich in zugewiesene Grenzen einpferchen lässt, atmet den Geist der Unfreiheit und der Unkultur.
Das ist nicht die Schuld Dieckmanns, der zu Recht an die Entstehungsbedingungen der europäischen Nationalkulturen, darunter insbesondere der deutschen, erinnert. Zwischen Deutschen und Deutschen zeigt sich, dass kulturelle Einheit (und ihr Gegenteil) nicht verfügt werden kann. Wer über das Unverfügbare am Menschen nachdenkt, der stößt über kurz oder lang auf Problemlagen der Kultur. Etwas vereinfacht gesagt: Kultur ist dort, wo das kulturelle Paradox des ›türkischen Deutschen‹ oder des ›arabischen Deutschen‹ mit einem Lächeln benannt und gelebt werden kann. Schon der physiognomisch irrlichternde Zusatz ›-stämmig‹ kann da für Irritationen sorgen. Wer zwischen ›Herkunft‹ und ›Stamm‹ nicht unterscheiden will, zeigt ein zivilisatorisches Defizit. Das betrifft Fragen der Integration, aber vor allem das Selbstverständnis der Menschen und das sich in ihm manifestierende Selbstbewusstsein. Vor diesem Hintergrund sollte folgender Passus zweimal gelesen werden:
»Die Kulturnation heute – der Befund muß über die Resultate ost-westlicher Transformation hinaus auf das Große und Ganze einer kulturellen Situation gehen, deren politischer Rahmen etwas Zwitterhaftes hat. Ähnlichkeiten mit den Gegebenheiten des 18. Jahrhunderts fallen ins Auge: Brüssel steht für Wien und Mainz, Straßburg für Regensburg, Luxemburg für Wetzlar, und die Europäische Union, die an diesen Orten Regierung, Parlament und Gerichtshof unterhält wie das alte deutsche Reich an den andern genannten, stellt sich so wenig als wirklicher Staat dar wie jenes strikt föderalisierte Kaiserreich, zu dessen Fürsten als Souverän der Reichsstadt Straßburg auch der König von Frankreich gehörte. Sie ist ein Gebilde im Schwebezustand zwischen Zerfall und einer Vereinheitlichung, deren Forcierung den Zerfall sofort herbeiführen würde, ein Halbstaat, dessen Glieder Gefahr laufen (oder schon mitten in dieser Gefahr stehen), von dieser Halbstaatlichkeit angesteckt zu werden.« (19)
Ist das so? Ist das wirklich so? Wäre das halb verrottete, kurz vor dem Kollaps stehende Heilige Römische Reich deutscher Nation die deutsche Blaupause für eine EU, die sich gern zusatzlos ›Europa‹ nennt? Dann wäre in der Tat der Brexit nur das Ergebnis der lange gereiften britischen Einsicht, in diesem deutschen Europa nichts verloren zu haben. Gern möchte man auch glauben, dass ein Macron oder sein Nachfolger kein Problem darin sieht, als ›Souverän der Reichsstadt‹ Straßburg in die Belange der anderen europäischen Länder hineinzuregieren. Aber dass er deshalb der altdeutschen, über den Kontinent gestülpten Reichsidee huldigt, wird wohl immer ein frommer deutscher Wunsch bleiben. Schon die Idee des Bio-Franzosen ist so lächerlich wie Macrons Wahlkampf-Idee der diversen Kultur ›und sonst gar nichts‹. Das weiß auch Dieckmann und er zitiert Juvenal, wenn er auf die Paradoxa der neueren Masseneinwanderung zu sprechen kommt. Komisch, im Sinne von ›seltsam‹, ist allerdings bereits bereits die von ›Brüssel‹ angeworfene Bewusstseinsmaschine, die Europa entzweit, so wie einst die Reformation Deutschland und schließlich Europa entzweite. Kein Wunder, dass fast alle Überlegungen zur Zukunft der Kulturnation – der Nation, die Kultur hat und nicht nur prätendiert – am Ende besorgt um die Zukunft des Schulsystems kreisen: dort entscheidet sich, was bleibt und was schon in der nächsten Generation verschwinden wird.