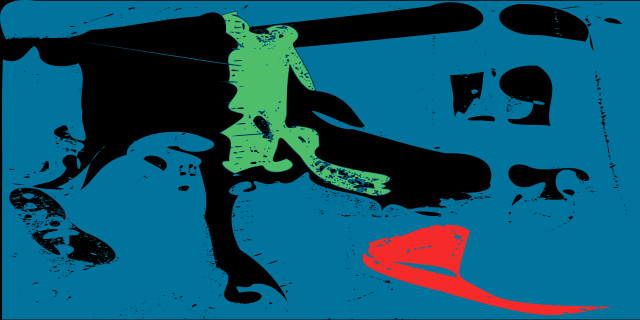von Lutz Götze
Europa ist der Kontinent der Sprachenvielfalt. Zumindest theoretisch, denn sie ist bedroht. Es zeichnet sich täglich deutlicher ab, dass die einigende Sprache der Antike und des Mittelalters, das Latein, nunmehr ersetzt werden soll durch die neue Einheitssprache, das Englische. Auf Konferenzen, in der Politik, in den Medien und Bildungseinrichtungen wird zunehmend Englisch gesprochen: zumeist schlecht. Eltern schicken ihre Kinder in englischsprachige Schulen oder gleich auf die britische Insel, weil sie der – unbewiesenen – Überzeugung sind, damit die berufliche Entwicklung der Sprösslinge zu fördern. Entsprechend verfahren immer mehr Eltern von Migrantenkindern: Wozu noch Deutsch lernen? Stattdessen Englisch von Anbeginn an, lautet das Gebot der Stunde!
Die Sprache Europas sei hingegen die Übersetzung, soll Umberto Eco einmal gesagt haben. Das ist richtig und problematisch zugleich. Richtig daran ist, dass dadurch keineswegs nur Europas Bürger in den Genuss überaus vielfältiger schöner Literatur und ganz unterschiedlicher wissenschaftlicher Publikationen gelangen. Zuvörderst die Deutschen: In keine andere Sprache wird so viel übersetzt wie in das Deutsche. Umgekehrt ist freilich eher Fehlanzeige zu konstatieren: Immer weniger deutschsprachige Literatur wird noch übersetzt und am wenigsten ins Englische. Das liegt, zugegeben, an der Qualität mancher deutschsprachiger Werke, vor allem aber an der Spracharroganz der Angelsachsen. Sie kennen nur eine Sprache, nämlich das Englische, und erwarten gediegene Kenntnisse derselben bei allen anderen Menschen auf dem Globus. Entsprechend verzeichnen die Quellen und Literaturverzeichnisse wissenschaftlicher Werke im angelsächsischen Raum nahezu ausschließlich englischsprachige Werke. Sie haben das Siegelwort der Vereinigten Staaten von Amerika – e pluribus unum –, also: aus mehreren eines, in radikaler Weise aufgegriffen. Im Gegensatz dazu sollte der europäische Leitgedanke lauten: in pluribus unum, also in mehreren eines. Oder anders: Einheit in der Vielfalt.
Problematisch an Ecos Satz aber ist, dass er dem Grundgedanken der Sprachphilosophie Wilhelm von Humboldts fundamental widerspricht. Humboldt: ›Ihre (der Sprachen) Verschiedenheit ist nicht eine von Schällen und Zeichen, sondern eine der Weltansichten selbst‹. Anders ausgedrückt: Sprachen bildeten keineswegs lediglich die Wirklichkeit ab, weil diese sowie Gedanken und Begriffe zuvor bereits gedacht worden seien: ohne Sprache. Umgekehrt würde ein Schuh daraus: Sprachen bildeten Wirklichkeit; unterschiedliche Sprachen formten je eigene Realitäten, genauer: Weltansichten. Ergo, so Humboldt, sei jede Übersetzung im Grunde ein Unding, weil sie die jeweilige Weltansicht der Ausgangssprache unreflektiert und unkritisch in die Zielsprache übertrage. Übersetzungen seien mithin Fälschungen, mindestens aber Vermischungen, besser: Verunklarungen. Humboldt schrieb 1816 in der Einleitung seiner Übersetzung der Tragödie Agamemnon des Aischylos:
Und doch braucht es Übersetzungen, freilich eher Neuschöpfungen. Texte also, die dem Lesenden vertraut und zugleich fremd sind. Vertraut, da in der Muttersprache verfasst, und fremd, weil eine andere Sicht auf scheinbar Gleiches vermittelnd. Eine Übersetzung des Wortes ›la foret‹ aus dem kamerunischen Französisch im Deutschen lautet korrekt ›Regenwald‹, vulgo ›Urwald‹. Unter ›Wald‹ verstünde der Deutsche einen vertrauten Mischwald.
Noch deutlicher wird diese Diskrepanz zwischen Kulturen, die vollkommen divergente Vorstellungen von Zeit und Raum haben. Wie sollen archaische orale Kulturen mit einem zirkulären Zeitverständnis – also etwa die indigenen Völker der Navajo oder der Maja – Texte aus einer völlig alphabetisierten Schriftkultur – beginnend bei den Hebräern etwa um 1250 v.u.Z. mit einem linearen Zeitverständnis samt der Trias von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – verstehen? Der indigene Mensch kennt das nicht: Wichtig ist ihm einzig der Moment: die Gegenwart, der er Dauer verleihen möchte.
Oralität und Wiederkehr des ewig Gleichen, also Zirkularität, gehören mithin ebenso zusammen wie Literalität und Linearität. Der selbstbestimmte Mensch tritt mit der Schrift gegen die mündlich überlieferten allmächtigen Mythen an und löscht zugleich nicht-alphabetisierte Kulturen aus. Die Geschichte der Eroberungen seit dreitausend Jahren menschlicher Geschichte ist ein bedrückender Beweis dafür. In Zeiten, in denen zunehmend über Restitution erbeuteter Kulturgüter und Rettung teilweise vernichteter und ausgestorbener Sprachen (‹Linguozid‹) nachgedacht wird, ist dies ein nicht zu unterschätzendes Problem.
Ähnlich der Raum: In alten andinischen Kulturen zeigt der Mann, wenn es um die Vergangenheit geht, nach vorn, denn die kennt er. Geht es hingegen um die Zukunft, weist er nach hinten: Sie ist unbekannt. Lokaladverbien als Übersetzungsproblem!
Am besten freilich bleibt, so viele Sprachen wie möglich zu lernen. Dazu erneut Wilhelm von Humboldt, hier in einem Brief vom 22. Oktober 1803 aus Rom an Freund Carl Gustav von Brinckmann:
Wer freilich kann schon Texte in mehr als drei Sprachen lesen, sich in ihnen mündlich oder schriftlich korrekt ausdrücken? Die Mehrsprachigkeit, einstmals als Bildungsziel gefordert, geht weltweit dramatisch zurück zugunsten des Englischen. Genauer: zugunsten der Varianten des Englischen. Englisch gebe es, so zahlreiche Anglisten, nur noch im Plural: Chinese English, Indian English, Caribbean English, African English. Segen und Fluch der Weltsprache Englisch lägen nahe beieinander. Muttersprachler des Englischen beklagen zu Recht, dass die überwiegende Mehrzahl der Englisch Sprechenden nur noch ein rudimentäres Englisch beherrsche, also Pidgin spreche und, wenn alphabetisiert, schreibe.
Sprache und Denken
An der Wiege des Abendlandes stehen die Vorsokratiker und Platon. Im Dialog Kratylos geht es um das Verhältnis von Sprache und Denken: Zunächst werden zwei Funktionen natürlicher Sprachen genannt: das kommunikative (das Gespräch ermöglichende) und das kognitive (das Sein erkennende) Werkzeug (organon): »Das Wort ist also belehrendes Werkzeug und ein das Wesen unterscheidendes und sonderndes, wie die Weberlade das Gewebe sondert«. (Kratylos 388c). Da sich die Protagonisten Kratylos und Hermogenes nicht einigen können, ob diese Funktionen nun allen Lexemen zukämen oder ob nur bestimmte Wörter Erkenntnis beförderten, schlägt Sokrates, –um sie vollkommen zu verwirren, vor, es wäre besser, die Welt – Realien und Gedanken – ohne die zumindest mit Mängeln behaftete Sprache zu denken, also das Wesen der Dinge direkt und nicht über die Vermittlung durch die Sprache zu erkennen:
Aristoteles stimmt Sokrates einhundert Jahre später zu: Sprache diene lediglich der Kommunikation, mündlich oder schriftlich, und sei entsprechend einzelsprachlich unterschiedlich. Sprache wird zu Sprachen. Sie unterschieden sich in Lauten. Mit dem Denken, also der Erkenntnis, habe das nichts zu tun. Denken sei universell, übereinzelsprachlich.
Diese Missachtung der Sprache(n) hat ihren Ursprung natürlich im Widerstand gegen die Sophisten, die Wortverdreher. Für das Abendland freilich hatte sie Folgen, bis heute. Über Jahrhunderte hinweg wurden Sprachen ›gereinigt‹, um ihre vermeintlichen Unklarheiten und Zweideutigkeiten, zumal im Falle von Synonymen, zu beseitigen und der Klarheit des Verstandes zum Durchbruch zu verhelfen. Immer wieder wurde versucht, mit nichtsprachlichen Mitteln – Zeichensprachen, logischen Formelsprachen, Graphen – Sprachen zu größerer Eindeutigkeit zu verhelfen: so die Zeichensysteme der symbolischen Logik im Wiener Kreis (Rudolf Carnap), der linguistische Strukturalismus zumal der Kopenhagener Schule (Louis Hjelmslev) und die Baumgraphen der Generativen Grammatik (Noam Chomsky). Natürliche Sprachen sollten den Gesetzen der Mathematik und der Formalen Logik genügen: Bedeutung und Gebrauch der Sprache sollten ausgeklammert bleiben und das Labor die Alltagssprache ersetzen.
Diese Ansätze und Theorien waren allesamt einseitig ausdruckssprachlich-syntaktisch und verfehlten vollkommen das Ziel, die Semantik (Bedeutung) und Pragmatik (Gebrauch) natürlicher Sprachen – mithin das Verhältnis von Sprache und Denken – auch nur annähernd zu definieren. Gleichwohl wurden sie wirkungsmächtig, brachten Schulen und Anhänger in Massen hervor, besetzten Lehrstühle an Universitäten und leiteten Akademien. Sie wirkten, über Jahre hinweg, dogmatisch und sprachregelnd, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Deutschland. Es entstand so etwas wie eine ›Sprachpolizei‹, die sich als allein wissend empfand und entsprechend regulierte. Hier liegt eine der Ursachen für die heutigen Sprachregelungen, zumal im sogenannten ›geschlechtergerechten‹ Sprechen und Schreiben.
Sprachwandel und Sprachreinigung
Sprachen verändern sich, sagt der Volksmund. Sprachwandel sei deren natürlicher Zustand. Das ist richtig und falsch zugleich. Richtig ist der ›Wandel‹, zumal im Wortschatz, weit seltener in der Grammatik. Falsch ist die Annahme, dieser Wandel geschehe gewissermaßen von selbst, autonom und automatisch. In Wahrheit sind es Menschen, die Sprachen verändern. Als handelnde Subjekte fügen sie den Sprachen neue Elemente hinzu und eliminieren andere. Manches bleibt erhalten und findet seinen Eintrag in Wörterbücher, anderes setzt sich im Sprachgebrauch nicht durch und verschwindet.
Dieser Prozess verläuft so lange kreativ und sinnvoll, wie dabei keine puristischen oder ideologischen Ziele verfolgt werden. Anders: Er wird zum Problem, sobald sich dabei Sprachwandel in Sprachreinigung verkehrt. Denn Sprache ist Macht. Wer die Sprache beherrscht, übt Macht aus. Sprachpuristen verfolgen grundsätzlich die Absicht, die Gesellschaft zu dominieren und Teile oder gar die Mehrheit abhängig zu machen. Beispiele dafür gibt es in Hülle und Fülle: So forderten die Sprachpuristen Ernst Moritz Arndt und Joachim Heinrich Campe zur Zeit der Napoleonischen Besetzung, alle französischen und lateinischen Wörter aus dem Deutschen zu verbannen, um die Moral der Jugend nicht zu gefährden, also zu ›französisieren‹. So sollte statt des lateinischen Ausdrucks Nase fortan Gesichtserker verwendet werden, statt Kloster Jungfernzwinger.
Auch im Nachbarland Frankreich entwickelte sich spätestens im 18. Jahrhundert ein eminenter Sprachpurismus, am stärksten während der Herrschaft der Jakobiner in der Französischen Revolution. Der Kalender wurde umgestellt: 1789 wurde das Jahr ›eins‹ der neuen Zeitordnung, die Sieben-Tage-Woche wurde in Dezennnien, also Zehner-Einheiten, verwandelt, die Monate hießen fortan Brumaire (Nebelmonat) für den November und Thermidor (Heißmonat) für den Juli. Nichts mehr sollte an die Zeit der Bourbonen und der katholischen Kirche erinnern. Paradoxerweise war es Napoleon, der, nachdem er sich selbst die Kaiserkrone auf das Haupt gesetzt hatte, den Gregorianischen Kalender wieder einführte. Ebenso übrigens wie Wladimir Iljitsch Lenin, der den alten Julianischen Kalender, gültig seit der Antike bis ins 20. Jahrhundert, nach der Oktoberrevolution im Sowjetreich abschaffte und den katholischen, also Gregorianischen, Kalender einführte: Die Oktoberrevolution wurde fortan am 7. November gefeiert.
Sprachreinigung geschah und geschieht vornehmlich in Diktaturen. Dolf Sternberger u.a. versammelten im Wörterbuch des Unmenschen Beispiele der Sprachreinigung der Nationalsozialisten: Einerseits waren es Neuwörter wie Blockwart, Volksgenosse, Schutzhaft und Sonderbehandlung (Abtransport in die Gaskammer). Dazu gesellten sich andererseits aber auch scheinbar harmlose Wörter des Alltags, die im ›Dritten Reich‹ neu oder missbräuchlich verwendet wurden: Auftrag, Betreuung, echt, Frauenarbeit, Gestaltung, leistungsmäßig, Kulturschaffende, Lager, Menschenbehandlung, Propaganda, Schulung, wissen um, Zeitgeschehen.
Die DDR war ebenfalls ein Ort der Sprachreinigung. Neuwörter wurden geschaffen wie Abschnittsbevollmächtigter, Antifaschistischer Schutzwall (die Berliner Mauer), Broiler, Kombine, Betriebsgewerkschaftsleitung, Brigade, Held der Arbeit, Jugendfreund, Traktorist, Spitzensportler und Klassenfeind. Andere Lexeme wurden umdefiniert wie Volksbuchhandlung, Plan, parteilich. Abkürzungen grassierten: ABF (Arbeiter-und Bauernfakultät), EOS (Erweiterte Oberschule), MMM (Messe der Meister von morgen).
Der Volksmund wiederum war ebenfalls neuschöpferisch tätig, freilich kreativ und ironisch: Ochsenkopfantenne ( (Antenne, um das Westfernsehen zu empfangen), Tal der Ahnungslosen (Raum um Dresden, wo das Westfernsehen nicht empfangen werden konnte), Bückware (Bücher oder Artikel unter dem Ladentisch) abkindern (Kreditrückzahlung reduzieren durch Geburt von Kindern), Jahresendflügelfigur (Weihnachtsengel).
Beide – NS-Staat wie die DDR – haben in der Tat einen erheblichen Beitrag zum in George Orwells Romandystopie 1984 beschriebenen Newspeak geleistet: also einer neuen Sprache, die die Herrschaft der Diktatur sichern sollte.
Geschlechtergerechte Sprache
›Gendern‹ ist das Schlagwort der Stunde. Ziel der Protagonisten – in der Mehrzahl sind sie weiblichen Geschlechts – ist es, patriarchalische Strukturen aufzudecken und zu überwinden: Sprache als wesentliches Instrument der Emanzipation durch Identifikation. Oder genauer: Identitätspolitik mit dem Ziel, die Diskriminierung einzelner Gruppen aufgrund ihrer Herkunft, Religion, Hautfarbe oder ihres Geschlechts zu beenden. Dieses Ziel ist ehrenwert: Trotz aller Verbesserungen, zumal in den Industriestaaten, werden heutzutage Frauen, Juden, Schwule und Lesben oder Schwarze benachteiligt, häufig in ihrer Würde verletzt und verfolgt.
Ist die deutsche Sprache der geeignete Ort, um diesen Missstand zu beseitigen? Im Grunde nicht. Transformationen, Reformen und soziale Veränderungen werden im politisch-gesellschaftlichen Bereich entschieden: an der Basis. Die Sprache hingegen gehört zum Überbau.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Im Streit um eine ›geschlechterdifferenzierte Sprache‹ geht es schon lange nicht mehr um Änderungen in der Rechtschreibung. Binnenmajuskel, Asterisk, Unterstrich und Doppelpunkt sind nicht das eigentliche Thema der Auseinandersetzung. Im Mittelpunkt des linguistischen Disputs steht das generische Maskulinum, das als Symbol der männerdominierten Sprache und damit als Übel schlechthin angesehen wird. Mit seiner Abschaffung erhoffen sich die Protagonistinnen eine Änderung der Gesellschaft. Es kümmert sie dabei wenig, dass die Grammatik der deutschen Sprache auf eben diesem System aufbaut: man, jemand, wer. Das generische Maskulinum existiert schon weit über einhundert Jahren, ohne dass jemand darin eine Diskriminierung von Frauen bemerkt hätte. Wenn einer zum Bäcker oder zum Friseur geht, ist es unerheblich, ob es sich bei diesen Berufsbezeichnungen um einen Mann oder eine Frau handelt. Beide sind gemeint. Ähnlich bei Arzt, Lehrer oder Professor. Will ich hingegen ausdrücklich kennzeichnen, dass es sich um eine weibliche Person handelt, nutze ich die movierte Form: Friseurin, Ärztin oder Professorin. Das generische Maskulinum ist unmarkiert, da allgemein gebräuchlich, die Movens-Form hingegen markiert, weil sie ein- und abgrenzt. Die potenzielle Mehrdeutigkeit der Maskulina ist dabei überhaupt kein Verständnisproblem, weil Kontext und Gesprächssituation relativ schnell klären, wer oder was gemeint ist.
Roman Jakobson hat diese generelle Unterscheidung in markierte und unmarkierte Sprachelemente als ein charakteristisches Merkmal von Sprachen vorgenommen. Das gilt auch für das Deutsche. Ein weiteres Beispiel, diesmal aus dem Tempusbereich, belegt das: Das Präsens ist unmarkiert: es kann sowohl Gegenwärtiges, Vergangenes als auch Zukünftiges ausdrücken; das Präteritum hingegen ist markiert, weil es grundsätzlich nur Vergangenes auszudrücken vermag. Ein drittes Beispiel: Die regelmäßigen Verben (lernen, stellen) sind unmarkiert, weil sie ihr Präteritum regelhaft durch Anfügen von –te an den Verbstamm bilden; im Gegensatz dazu sind die unregelmäßigen Verben markiert und dadurch abgegrenzt, weil ihre Tempusformen ablauten.
Nun hat man versucht, anstelle des generischen Maskulinums das Partizip 1 (fälschlicherweise auch Partizip Präsens genannt) zu gebrauchen. Das aber ist einerseits nicht immer möglich (*der Backende, *der Frisierende, *der Professorierende), verdeckt andererseits semantische Unterschiede ( Fliehende vs. der Flüchtende vs. der Flüchtling) oder führt zu Absurditäten: Die Streicher und Bläser der Berliner Philharmoniker haben Weltniveau – Die Streichenden………( Beispiel von Peter Eisenberg). Schon Johann Wolfgang von Goethe kannte im Übrigen den Unterschied von Student und Studierender: Letzterer studierte wirklich, ersterer trieb sich eher in Kneipen herum. Wird nun heute in Studienordnungen der Student durch Studierende ersetzt, wird dieser Unterschied verwischt.
Sinnvollerweise sollte man deshalb beim generischen Maskulinum bleiben. Ansonsten wird die Sprache ungenau, unästhetisch oder ungelenk. Ähnlich verhält es sich mit den Doppelformen: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Professoren und Professorinnen, Assistenten und Assistentinnen, Studenten und Studentinnen…..Texte, die dergleichen Doppelungen gehäuft enthalten, lassen die Lust am Lesen augenblicklich auf Nullniveau sinken. Zu empfehlen wäre allenfalls ein Wechsel zwischen dem Maskulinum und dem Femininum: Dichter und Schriftstellerinnen, Lyrikerin und Essayist, Verleger und Autorinnen.
Aber darum geht es im eigentlichen Sinne nicht. Es geht vielmehr um Macht. Alle diese vermeintlich sprachlichen Auseinandersetzungen haben einen zentralen gesellschaftlichen Aspekt: Transformation. Im Kern handelt es sich um einen Kulturkampf. In den USA ist er bereits weiter vorangeschritten als hierzulande. Dort wird an einzelnen Universitäten die Behandlung der Werke des ›heteronormativen Rassisten‹ William Shakespeare im Seminar ausgeschlossen: ein alter, weißer, heterosexueller Mann! Dante, Goethe, Mozart und Beethoven soll demnächst der Garaus gemacht werden. Immanuel Kant ist ohnehin längst als Rassist gebrandmarkt.
An deutschen Universitäten werden gelegentlich Examensarbeiten, die nicht in Gendersprache abgefasst worden sind, entweder nicht angenommen oder schlechter beurteilt als die ›ordnungsgemäßen‹ mit Genderstern. Die Führung des PEN-Zentrums Deutschland weigerte sich, eine von mir durchgeführte Umfrage unter Poeten und Schriftstellerinnen, die eine Ablehnung des ›Genderns‹ erbracht hatte, zu publizieren, da man Angst hatte vor dem wütenden Protest der Befürworterinnen.
Zwei weitere Keulenschläge der Identitäts-Eiferer: Die Stiftung ›Preußische Schlösser und Gärten‹ ist vor den Sprachsäuberern in die Knie gegangen und hat das ›Mohrenrondell‹ im Park von Sanssouci kurzerhand umbenannt in ›Erstes Rondell‹. Die Begründung: Das M-wort könne die Gefühle der Besucher ›verletzen und abwerten‹. Friedrich der Zweite, der einst dort die vier Büsten aus Marmor und poliertem Kalkstein aufstellen ließ, dürfte sich im Grabe umdrehen!
Einen vorläufigen Höhepunkt hat der Genderwahnsinn in Hamburg erreicht. Der gerade unterzeichnete Koalitionsvertrag von SPD und Grünen ist vollständig in geschlechterdifferenzierter Sprache abgefasst, die kein normal Sterblicher versteht!
Es handelt sich um einen Kulturkampf. Die aus den USA stammende Welle der cancel culture hat bizarre Ausmaße angenommen. Ästhetik und Klarheit der deutschen Sprache gehen im Trommelfeuer der Identitäts-Eiferer und Sprachverächter unter. Ihnen ist die vollkommene Schönheit eines Heine-Gedichts oder eines Prosatextes von Thomas Mann vollkommen gleichgültig. Auch die Warnungen der Betroffenen verhallen ungehört: »Wenn man von Jüdinnen und Juden, kurz Jüd*innen, sprechen muss, weil das Wort Juden als Sammelbegriff unzulässig geworden ist, dann bekommen Leute wie ich auf neue Weise einen Stern verpasst«, so Ellen Presser, die Leiterin des Kulturzentrums der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.
Epilog
»Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch«, schrieb Friedrich Hölderlin im großen Gedicht Patmos. Woher aber soll Rettung kommen gegen die Sprachverhunzerinnen und Sprachvergewaltiger? Wir haben keine ›Académie Française‹ mit Weisungscharakter – auf ihren Willen hin hat Frankreich bereits vor Jahren die Gendersprache im Öffentlichen Dienst verboten –, wir haben stattdessen mehrere Akademien, wir haben den Deutschen Presserat, wir haben die Kultusministerkonferenz und den Rat für deutsche Rechtschreibung. Von ihnen ist allenfalls zu hören, dass sie die weitere sprachliche Entwicklung beobachteten. Derweil wächst die Gefahr, blüht der Unsinn! Ist der deutschen Bevölkerung ihre ›Muttersprache‹ nichts mehr wert?
Literatur:
ABRAM, David (2021). Im Bann der sittlichen Natur. Die Kunst der Wahrnehmung um die mehr-als-sinnliche Welt. Klein Jasedow.
ARISTOTELES (1995): Philosophische Schriften in sechs Bänden. Bd. 1. Lehre vom Satz. Hamburg.
EISENBERG, Peter(2021):Die Genderfraktion verachtet die deutsche Sprache. In: Berliner Zeitung. 12.5.2021.
HUMBOLDT, Wilhelm von (1981): Werke. Bde: 3, 5. Darmstadt.
PLATON (2004): Sämtliche Werke. Band 3. Reinbek bei Hamburg.
StERNBERGER, Dolf/Storz, Gerhard/Süskind/W.E.(1962): Wörterbuch des Unmenschen. München.
TRABANT, Jürgen (2020): Sprachdämmerung. Eine Verteidigung. München