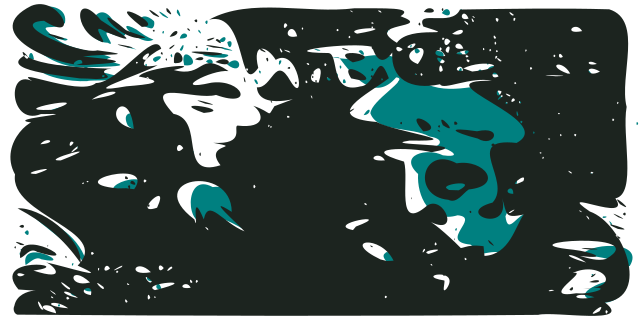von Ulrich Schödlbauer
Leserkommentar, gefunden auf Tichys Einblick
I.
Regierungen, die nicht rechtzeitig abgewählt werden, nähren sich vom Zerfall. Der Bürgerblick wendet sich von ihnen ab und einer ungewissen Zukunft zu: Was ist dort zu sehen? ›Nichts‹, verkünden die Klugen, Spötter und Resignierte in einem, ›Umbrüche‹, große Umbrüche die Vorsichtigen, die kühn sein wollen und das Unvermeidliche als überlebensgroßen Schatten an der Wand buchstabieren. Der große Rest wartet ab und vertreibt sich die Zeit damit, vor ›sich abzeichnenden‹ Tendenzen zu warnen, der Tendenz zur wachsenden Demokratiefeindlichkeit etwa – ein Dauerbrenner des politischen Geschäfts. Man könnte ihn das Geschäft der Meinungsblockierer nennen, derjenigen Leute also, die sich blendend in der politischen Gegenwart eingerichtet haben und unruhige Blicke auf alles richten, was ihrem behäbigen Dasein gefährlich werden könnte. Die Dinge laufen doch bestens, so der Refrain ihrer medialen Zuarbeiter, wer daran etwas ändern will, kann nur verdächtig sein.
*
Diese verdächtigen Subjekte wollen vor allem das eine: Sie wollen an die Macht. In der Regel empfinden sie die Aktivitäten der Meinungsblockierer als hilfreich. Meinungen, soviel verrät ihnen die Geschichte, lassen sich nicht blockieren. Bewusstsein kennt keine hermetisch abgeriegelten Räume. Wer Türen und Fenster verriegelt, muss erschreckt feststellen, dass irgendwann das Wasser durch alle Ritzen dringt und endlich von der Decke tropft. Wer blockiert, gibt sich Illusionen hin: kein schöner Anblick, kein überzeugender Anblick, kein sauberer Anblick auf Dauer. Zum ältesten politischen Inventar gehört der ›Saubermann‹. Nicht ohne Grund: Reinigungsrituale existieren für die Politik ebenso wie für den privaten Hausgebrauch. Laufen die Dinge gut, bleiben sie, oft über lange Zeiträume, ausgeblendet, bis man sich ihrer zu gegebener Zeit erinnert. Dann erscheint der Saubermann als Tabubrecher, der den Widerwillen, manchmal den Hass der Gesellschaft auf sich zieht: Der Bote ist die Botschaft. Im Hintergrund wirkt die Logik mehr oder weniger homogener Gemeinschaften: Nur der gekonnte Tabubruch entwickelt jene Dynamik, die ausreicht, einen fatalen Mehrheitskonsens zu zerbrechen.
*
Unsaubere Praxis gegen unsaubere Gesinnung – wer bietet mehr? Das Spiel scheint offen, aber dem scheint nur so. Soll sie in diesem ungleichen Kampf bestehen, muss auch die geltende Praxis sich eine Gesinnung zulegen. Das kann, nach Lage der Dinge, nur eine Gegen-Gesinnung sein. Soll heißen, die geltende Praxis treibt, ganz von allein, ins Kielwasser der Empörung, die ihre Wortführer so beredt verdammen. Auf diese Weise steigert Bewusstsein sich aneinander und beendet den Status quo ganz ohne weiteres Zutun, indem es ihn in einen neuen status quo ante überführt. Das Bevorstehen übt eine unwiderstehliche Macht auf alle aus, die sich nicht wirklich bewegen wollen. Es schiebt, es drängt, es bedrängt sie, es nötigt sie: Mit einem Mal sagen und tun sie Dinge, die, im Sinn des Bestehenden, besser ungesagt und ungetan blieben, bis hin zur Publikumsbeschimpfung, deren Komik auf dem erreichten Grad der Erregung prompt untergeht. Ja gewiss, vieles am Kampf der erhitzten Gemüter wirkt komisch. Es merkt nur keiner. Im Sommerloch genügt dann die unbedarfte Geste eines Fußballspielers, um das Stadion der wohlfeilen Gesinnungen auf Wochen hinaus in einen Hexenkessel zu verwandeln: die Szene verengt sich zum Tribunal.
*
Das Ende der Regierung Merkel ist nicht vorher-, aber absehbar. Damit stellen sich lange Zeit mehr oder weniger erfolgreich blockierte Fragen. Welche strukturellen Verschiebungen in der Wählerschaft und im Parteiengefüge sind in Gang, welche auf kurze, mittlere und längere Sicht zu erwarten? ›Struktur‹ ist gut, Struktur ist immer dann gut, wenn ungeprüfter Gestaltungswille auf ideologisch zementierte Routine trifft. Wahlniederlagen und Umfragewerte, zu anderen Zeiten als ›vernichtend‹ analysiert, spielen Schicksal, dem man sich willig unterwirft, weil einem keine andere Wahl bleibt. Die neue Lust am ›Verschwinden der Volksparteien‹ ist erkennbar ein Faktum, das analysiert werden sollte. Aber Vorsicht: in den Strukturen versickert die Schuld, für die niemand einstehen will, um an ungeeigneter Stelle als Selbstzerfleischung fröhliche Urständ zu feiern. »Welche Schuld?« fragt der Parteifreund, der stets auf die Linie achtet, auch wenn er sie in den wolkigen Sprüchen der Oberen nicht immer zu erkennen vermag. Schuld, mein Freund, sind immer die anderen, es kommt darauf an, sich nichts zuschulden kommen zu lassen. So wird eine Regierung mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum am Ende moralisch – ›hypermoralisch‹ nennen es Gegner, denen daran liegt, die herrschende Moral zu diskreditieren. Das Wort stammt aus der Mottenkiste der Gesinnungskritik, die selbst auf Gesinnungen pocht, aber es stimmt: Die publizierte Moral derer, die gerade am Drücker sind, pflegt kein großer Glanz aus innen zu sein, sondern die speckige Außenansicht einer abgegriffenen Sache.
*
Was für die Politik gilt, das trifft auch auf die Medien zu. Als Teil des politischen Kräfte- und Spannungsfeldes sind sie nicht in gleichem Maße rechenschaftspflichtig wie die Politik. Sie sind, um es vornehm auszudrücken, sensibel, und das in mehrfacher Hinsicht: gegenüber den Einflüsterungen der Macht, gegenüber der zahlenden Leserschaft und ihren Wanderbewegungen, gegenüber dem technologischen Wandel und, nicht zu vergessen, den mehr oder weniger volativen, mehr oder weniger subtilen Informations- und Desinformationsstrategien im nationalen und internationalen Raum. Desinformation lautet das Gebot der Stunde. Entsprechend bedarf es der Stundenzähler, um ihren Bocksprüngen auf der Spur zu bleiben. Was galt, was gilt, was hat schon gegolten und seine Zeit hinter sich? Was ist abgegolten, was drängt sich in Geltungsposition, mit welchen Mitteln, mit welchen Aussichten? Die Fake News-Parade der angeschlagenen, unter jähem Bedeutungsverlust ächzenden amerikanischen Leitmedien, angeheizt von einem begnadeten, zum ›homo sacer‹, zum globalen ›Narren‹ beförderten Player, erweist sich, eins zu eins in die heimischen Verhältnisse übersetzt, als Scharade: Was fehlt, ist der konsistente, in Zeit und Raum identifizierbare Gegner. Das atemlose Stöhnen der ›Guten‹, der fließende Wechsel der Themen und Anlässe, das Übermaß an Häme und schierem propagandistischem Nonsens lässt nicht nur die Glaubwürdigkeit der Medien schwinden – beim klickenden Publikum erzeugt es eine selten angetroffene Informationswut, in der sich Enttäuschung, Empörung und Gleichgültigkeit angesichts des ebenso flüchtig Geschriebenen wie Gelesenen sammeln und gleichsam bei abwechselnd lodernder und schwindender Flamme verbrennen.
*
Es ist oft bemerkt worden: die faktische Allparteienregierung aus CDU/CSU, SPD, Grünen, FDP (soweit im Bundestag vertreten), unter Einschluss kooperationswilliger Teile der Linken, hat nicht nur das Wechselspiel von Regierung und Opposition im Bundestag ausgehebelt. Sie hat, vorsichtig ausgedrückt, die deutsche Öffentlichkeit in einen neuen Aggregatzustand überführt. Zum – gefühlten – nanny state, der, neben Recht, Umwelt, Sozialem und Infrastruktur, die geistig-moralische Betreuung seiner Bürger als Aufgabenfeld entdeckt hat, ist eine Nanny-Öffentlichkeit hinzugetreten, aus der mit der Verlässlichkeit der Ware Information auch die kritische Distanz zur Macht diffundiert zu sein scheint – also gerade jene beiden Kontributionen der vierten Gewalt, ohne die eine parlamentarische Demokratie auf Dauer nicht existieren kann. Macht machtet – sie erzeugt Abhängigkeit, alternativlose Macht erzeugt alternativlose Abhängigkeit, alternativlose Abhängigkeit erzeugt Einbahnstraßen-Bewusstsein, Einbahnstraßen-Bewusstsein erzeugt Ergebenheit, Ergebenheit erzeugt moralische Indolenz, Indolenz erzeugt Abwehr, Abwehr erzeugt Wut und gelegentlich Hass, also gerade den Stoff, dessen ein Establishment auf Abruf bedarf, um sich im Recht zu fühlen und letzteres vorsorglich anzuschärfen. Gefühltes Recht ohne Richter ist Rechthaberei ohne Ende, ein schwindelerregender Sturz in den Malstrom einer urteilslosen Gesellschaft.
*
Nichts ... nichts charakterisiert die Atmosphäre der letzten Jahre so sehr wie die anschwellende, in allen Tonlagen vor, hinter und unter der Hand geflüsterte Frage: Wo leben wir eigentlich? Nicht wie, nicht warum, nicht wofür, nein: wo? Warum so ratlos, ließe sich zurückfragen, da die Antwort doch auf der Hand liegt: In diesem unserem Land mit seinen altbekannten, reflexhaft eingefahrenen Ritualen, in dem ›wir‹ dennoch, folgt man einer gern verhöhnten Wahlkampfparole, ›gut und gerne leben‹. Wirklich? Anders zurückgefragt: dieses anschwellende Wir, von vielen arglos, von anderen mit erschreckender Schärfe gebraucht – steht es für die Staatsbürger dieses Landes, die sich ihrer Stellung im Gemeinwesen nicht mehr sicher sind? Für eine politische Fraktion unter ihnen, die sich an oder über den Rand des erwünschten oder erlaubten Spektrums gedrängt sieht? Für den ›einfachen Mitbürger‹, der an kultureller Dissoziation zu leiden beginnt und Sicherheit und Ordnung, die beiden Grundfunktionen des Staates, nicht mehr gewährleistet sieht? Für einen unbestimmten Mix aus alledem? Angenommen, ›wir‹ wüssten, wofür es steht, wüssten es ganz genau – wer wären dann wir? Dieses allgegenwärtige Wir, wir ahnen es bereits, ist nicht objektivierbar. Es ist eine intrinsische Größe, die mit jedem Propagandaspruch fremdgeht.
*
Nein, es ist ihr Land nicht mehr. Eine wachsende Zahl lieber Mitbürger hat ihm den Rücken gekehrt und freut sich bereits auf die Rückkehr aus dem Exil, dem inneren wie dem äußeren, sollten die Dinge sich irgendwann wenden. Die forscheren unter ihnen denken ans Auswandern und stellen Visa-Anträge, vorerst, um noch ein wenig von der Welt zu sehen, bevor man weitersieht. Die Grimmigen unter den Zweiflern sehen entschlossen weiter und halten den Blick starr auf das Gebälk des Systems gerichtet, um den Zeitpunkt nicht zu verpassen, zu dem es zusammenkracht. Ist es schon so weit? Ist es wieder so weit? Die Neugier wächst, das Publikum sammelt sich. Auf keinen Fall will es das Ende der Verunsicherung verpassen, in die eine wechselweise als ›Glücksfall‹ und als ›naiv‹ empfundene Politik das Land gestürzt hat.
*
Der Duden, Sprach-Ratgeber in allen Lebenslagen, kennt das Wort ›Gegenöffentlichkeit‹, aber er kennt nicht seine Bedeutung. Das ist merkwürdig und hilft, die Wahrnehmung zu schärfen. Jeder Stammtisch kennt die Regel, der zufolge eine »sich gegen eine als öffentliche Meinung geltende oder als solche dargestellte Ansicht artikulierende Gegenmeinung« – so die Definition des Dudens – unterschiedlich darstellt, je nachdem, ob sie öffentlich oder privat geäußert wird. In den sozialen Medien mag der Unterschied verschwimmen, aber das ändert nichts daran, dass eine Meinung, gleichgültig, ob sie als Original- oder Gegenmeinung daherkommt, ›öffentlich‹ oder ›privat‹ gemeint sein kann – genauso, wie sie ›ironisch‹ oder ›sarkastisch‹ oder ›ganz ganz ernst‹ gemeint und entsprechend aufgenommen sein will. Solche Kriterien können vor Gericht eine Rolle spielen, sie sollten daher ernst genommen werden. Wer will, darf Öffentlichkeit auf den Begriff der öffentlichen (oder veröffentlichten) Meinung herunterfahren, aber er wird sie auf diese Weise nicht los. Öffentlich ist öffentlich, ›für jedermann einsehbar‹, Gegenöffentlichkeit eine Öffentlichkeit für Leute, die der Überzeugung anhängen, die Öffentlichkeit, wie sie sich in der Regel präsentiert, präsentiere nicht alles, was ihrer Ansicht nach ›für jedermann einsehbar‹ sein sollte.
*
Die Schwierigkeit einer solchen Definition liegt auf der Hand: Wenn alles öffentlich ist, was für jedermann einsehbar vollzogen, angezeigt, beklagt oder verhandelt wird, dann mag es zwar Lücken in der öffentlichen Wahrnehmung geben, aber der Ausdruck ›Gegenöffentlichkeit‹ ist per se sinnlos. Entweder etwas ist öffentlich einsehbar oder nicht. Sinnvoll wird der Begriff erst dann, wenn eine manipulierte, also eine Schein-Öffentlichkeit unterstellt wird, in der gewisse, an die Allgemeinheit adressierte Inhalte nicht zugelassen und daher für sie nicht wahrnehmbar sind. Auch dann bleibt eine gewisse Paradoxie zurück. Denn der Ausdruck unterstellt, dass es trotz allem möglich sein muss, die Zulassungsschranke zu durchbrechen und auch solche Inhalte öffentlich zu kommunizieren. Angenommen, ihre Kommunikation wäre illegal und würde, sobald sie ruchbar würde, von den ›Organen‹ des Staates unterbunden – was, weltweit gesehen, nicht so selten vorkommt –, dann wäre Gegenöffentlichkeit einfach der unterdrückte Teil der Öffentlichkeit, verstanden als aufblitzender Widerspruch gegen eine degenerierte Öffentlichkeit, in der ein Teil das Ganze zu sein beansprucht. An dieser Stelle sollte man genau sein. Nicht ›die Öffentlichkeit‹ wäre in diesem Fall der Gegner, vielmehr wären es die Kräfte der Verstümmelung, die sich im Zentrum der Macht die Hand geben.
*
Ganz so einfach liegen die Dinge nicht. Damit etwas öffentlich, sprich allgemein einsehbar werden kann, muss es einige Filter passieren. Sie sind teils technischer, teils organisatorischer, teils rechtlicher Art. Dazu kommt der innere Zensor, der auf den gesellschaftlichen Zensor abgestimmt ist: Nicht alles, was kommuniziert werden kann, passiert die Schicklichkeitsschranke. Vieles davon bleibt besser unveröffentlicht, manches ›unsäglich‹, es sei denn, es verläuft sich im engeren Kreise – letzteres kann sich, vor allem bei Politikern, als eine trügerische Annahme erweisen. Öffentlichkeit kommt ohne diese Art der Unterdrückung nicht aus, sie gehört zu ihr wie die Unterdrückung gewisser Geräusche zu einer gesitteten Mahlzeit. Zur Öffentlichkeit gehört auch, dass die Schicklichkeitsschranke in ihr selbst als Thema verhandelt wird. Aus gutem Grund: Nur so kann verhindert werden, dass, weitgehend unbemerkt, Tabus eingeschleppt werden und sich verbreiten, die irgendwann jede freie Artikulation zu ersticken drohen, oder dass umgekehrt grenzenlose Verrohung die Öffentlichkeit zu einem Schreckensort verkommen lässt.
*
Der Begriff ›Gegenöffentlichkeit‹, wie er heute gebraucht wird, ist ein Produkt der ’68er Jahre des letzten Jahrhunderts (wie man immer dazusetzen sollte, will man nicht der allgemeinen Ikonisierung jener Zeitläufe Tribut zollen). Soll heißen, er ist behängt mit dem Flitter der damals gängigen Kritik der bürgerlichen Öffentlichkeit und der vermeintlich politischen Absicht, sie um eine plebejische oder proletarische Komponente zu erweitern – nicht, damit beide künftig in freundlicher Koexistenz nebeneinander existierten, sondern damit die eine die andere am Ende – in dem Prozess gesellschaftlicher Umgestaltung, der sich im ›Marsch durch die Institutionen‹ abzuzeichnen schien – verschlingen könnte, und sei es nur deshalb, weil jene andere sich dann mangels Adressaten erübrigt hätte. Die Prozesse sind, wie man weiß, etwas anders verlaufen. Verlaufen hat sich die linke Gegenöffentlichkeit – wenn man von hartnäckig gehaltenen Widerstandsnestern in den Sperrzonen bürgerlicher Rechtschaffenheit einmal absieht – nicht zuletzt deshalb, weil die ›bürgerliche‹ Öffentlichkeit sich als weit aufgeschlossener erwies als von der Theorie unterstellt und fast mühelos die verschiedenen Emanzipationsprojekte von der Straße saugte. Erstaunlicherweise war, als dank der ›neuen Medien‹ endlich eine ›flache‹, wenig hierarchische, plebejisch anmutende Öffentlichkeit entstand, der ›linke‹ Zensor zur Stelle und verhängte, mit zweifelhaftem Erfolg, ›Hass‹-Verbote, statt sich der damaligen Überlegungen zum Code der unterprivilegierten Bevölkerungsteile (und seiner ›karnevalesken‹ Drastik) zu erinnern.