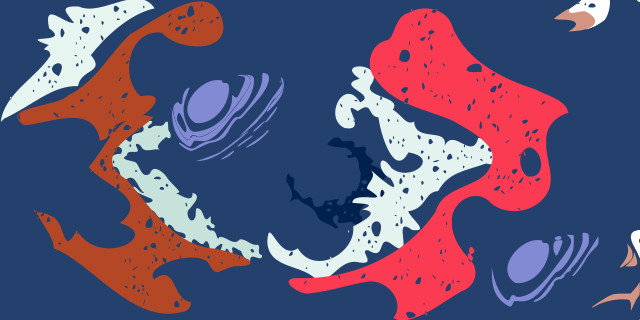von Uwe C. Steiner
Miss Sara Sampson und ihre späten Verehrer
Sofort nach ihrem Tod wird Sara Sampson eine »Heilige« genannt. Und zwar von ihrem Liebhaber. Hören wir die Worte Mellefonts, zu denen er sich ersticht:
»Diese Heilige befahl mehr, als die menschliche Natur vermag! […] Wenn ich als das schuldige Opfer ihrer [d.i. Marwoods; U. St.] Eifersucht gefallen wäre, so lebte Sara noch. […] Es stehet bei mir nicht, das Geschehene ungeschehen zu machen; aber mich wegen des Geschehenen zu strafen – das steht bei mir!« Er ersticht sich, und fällt an dem Stuhle der Sara nieder.
Weil er, Mellefont, sich dem Dolchstoß der Marwood entzogen hatte, war Miss Sara zur Victima geworden. Sie stirbt anstelle seiner, sie stirbt demnach auch für seine Sünden, ihre Opferschaft bezeichnet ein Stellvertretungsverhältnis, Sara stirbt als ein sacrificium. So bezeugt es Mellefont quasi in seinen Einsetzungsworten, in denen er sie eine »Heilige« nennt. Und, vor allem, bezeugt er es, indem er seine Schuld einräumt und darin seinen Verzicht auf das tragische Privileg erklärt. Sein Selbstmord mit dem Dolch dient der Läuterung und ist ausgewiesen kein tragischer Tod. Er sinkt vielmehr »an dem Stuhle der Sara nieder«, in einer Demuts- und Verehrungsgeste.
Diese Selbstanklage eines Mannes sollte bald Nachahmer finden. Sie begründet gleichsam eine bis dato beispiellose Kultur der Selbstbezichtigung von Männlichkeit. Die menschliche Natur, die im Vergleich zur heiligen Sara inferiore menschliche Natur, diese Natur wird bald die männliche Natur genannt werden. Dass siebzehn Jahre später Odoardo Galotti das weibliche das bessere Geschlecht nennen wird, findet sich hier angelegt. In der Emilia wird die Titelheldin selbst ihr Opfer als förmliches sacrificium inszenieren, und sie wird es gegen den erklärten Willen des Vaters durchsetzen.
Weibliche Opferschaft als Zeichen einer höheren, weil moralischen Natur avanciert zum Gegenstand der Nachfolge. Und zwar auf und jenseits der Bühne, in realen und fiktiven Nachahmern. War die vierte Wand nicht errichtet worden, um durchlässig zu sein? Jedenfalls signalisierten ostentativ arrangierte Emilia-Drucke, dass Karl Wilhelm Jerusalem und Goethes Werther ihre jeweiligen Suizide, den realen und den fiktiven, als Opferungen im Glanze von Lessings Heldin verstanden wissen wollten.
*
Sie blieben nicht die einzigen Prätendenten. Im Juli 1793 erscheint im revolutionären Paris ein schmaler Aufsatz, betitelt Charlotte Corday. Sein Verfasser erlebt die deutsche Publikation nicht mehr. Der 1766 geborene Adam Lux war 1784 in Mainz mit einer Schrift über den Enthusiasmus promoviert worden. Als veritabler Enthusiast wird sich Lux in der Folge denn auch erweisen. Von 1792 an wirkt er, wenn auch eher gemäßigt, bei den Mainzer Jakobinern. Mit Georg Forster geht er 1793 nach Paris, um dem Nationalkonvent den Anschluss der Mainzer Republik anzutragen und im Jakobiner-Club den Schwur auf die Republik zu leisten. Nach dem Fall von Mainz zum Exilanten in der französischen Hauptstadt geworden, erlebt Lux am 17. Juli 1793 als »tief betroffener Augenzeuge« (Günter Christ) die Hinrichtung Charlotte Cordays. Ihre Schönheit, ihre Ruhe und Abgeklärtheit sollen ihn überwältigt haben. Anschließend verfasst er die knapp zehnseitige und nur zwei Tage später, am 19.7.1793 im französischen Original publizierte Schrift, in der er die Mörderin des Marat zur Märtyrerin erklärt. Mit ihr und einer weiteren jakobinerkritischen Schrift bewirbt sich Lux sozusagen um einen Platz unter der Guillotine. Erfolgreich. Schon am 24.7.1793 wird er verhaftet. In den Verhören soll Lux selbst mehrfach auf rasche Aburteilung gedrängt haben. Möglicherweise wollten ihm die Ankläger den Opfergang nicht zu leicht machen: Erst am 4.11.1793 wird das Todesurteil ausgesprochen und am gleichen Tag vollstreckt.
Noch im selben Jahr nimmt Johann Wilhelm von Archenholz Luxens Schrift in den siebten Band der Zeitschrift Minerva. Ein Journal historischen und politischen Inhalts auf und schickt ihr die folgenden Zeilen voraus: »Dies ist die in den öffentlichen Nachrichten oft gedachte Schrift von Adam Luchs, weiland außerordentlichem Abgeordneten von Maynz. Die heldenmüthige Aufopferung der Dame reizte ihn zur Nachahmung. Auch er wünschte als ein Märtyrer der Freyheit zu sterben; daher diese kühne Schrift.«
Archenholz fasst Impuls und Motivation von Schrift und Verfasser punktgenau zusammen. Lux verehrt die tugendbewegte Attentäterin im schwärmerischen Vokabular der Empfindsamkeit. Er nennt sie eine »himmlische Seele«. Auf dem Weg zum Schafott scheint ihn ihr »so sanft[er] und so durchdringen[der] Blick« bis »ins Innerste [s]eines Herzens« getroffen zu haben. Zumal bezeugt Lux die Wirksamkeit eines ästhetisch, eines auf dem Theater etablierten Dispositivs. Er rühmt den »Heldenmuth« der Charlotte Corday. Ihre Hinrichtung habe die Guillotine in einen »Opferaltar« verwandelt, auf dem er als weiteres »Schlachtopfer« dargebracht zu werden bittet. Man solle seinem »abgeschlagenen Kopfe eben so viele Ohrfeigen geben lassen, als sie«, die Feinde der Freiheit, »dem Kopfe der Charlotte geben ließen«, und er, Lux, bittet darum, dem »cannibalischen Pöbel zu befehlen, diesem tiegerartigen Schauspiele Beyfall geben zu lassen«. (Hervorhebung U. St.)
Gegenstand der Nachahmung ist explizit der »Heldenmuth« einer Frau. Wenn Männer noch Helden werden können, dann in Nachahmung der Frauen. Es ist der exemplarische Opfertod einer Heldin, der im ganz realen Schauspiel der revolutionären Exzesse das Schafott in einen Altar und die Delinquentin in ein Sacrificium, in ein »Schlachtopfer«, verwandelt. Wobei es nicht nur jugendliche Schwärmer gewesen sind, die ihr huldigten. Auch Klopstock, längst ein ehrwürdiger Greis, hatte sich vom Martyrium der »Kordä« rühren lassen und setzte der Attentäterin 1793 ein literarisches Denkmal. Das Opfer auf der Bühne der Geschichte bewirkt aber weniger eine Katharsis, als dass es, als Objekt der Nachahmung, weitere Opfer heischt. In der pathetisch eingeforderten Selbstdarbringung folgt Lux seiner Ikone, dem sittlich-politischen Exempel einer weiblichen Tugend, die er, der Mann, womöglich nie wird erreichen können: Die »erhabene Charlotte« möge ihm, Lux, verzeihen, wenn es ihm nicht gelänge, in seinen »letzten Augenblicken dieselbe Sanftmuth und denselben Muth zu zeigen«.
*
Seither reißt die Kette der Nachahmungen nicht mehr ab. Im Jahr 1919 erlebt Georg Lukács gleichsam eine Bekehrung. Zuvor hatte er noch unter dem Namen Georg von Lukács publiziert. Jetzt, 1919, glaubt der Sohn eines Budapester Bankdirektors, der transzendentalen Obdachlosigkeit der Moderne durch ein Bekenntnis zum Kommunismus zu entkommen. Und sofort argumentiert der frisch Konvertierte in seinem Taktik und Ethik betitelten Aufsatz, man müsse sich selbst als Opfer darbringen, als Opfer für die gute Sache, nämlich für die Revolution. Die »Befreiung der Menschheit«, das glaubt Lukács zu wissen, sei der »wahre Endzweck« der Geschichte. Diesen Endzweck zu verwirklichen, sei auch das Böse in Gestalt des politisch motivierten Mordes gerechtfertigt. Lukács will darin einen Gedanken »größter menschlicher Tragik« erkennen: Man opfere »sein minderwertiges Ich«, wenn man tut, was man der konventionellen Moral zufolge eigentlich nicht tun darf, was aber im Interesse der guten Sache getan werden müsse. Für diese Tragik finde sich ein dramatisches Vorbild. Lukács verehrt ein theatralisch geheiligtes weibliches Bühnenopfer, das er gleichsam zur Ikone im revolutionären Kampf stilisiert. Das Selbstopfer, das der politische Attentäter erbringt, findet Lukács nämlich in der Haltung von Friedrich Hebbels Judith gerechtfertigt, und zwar in ihren »unnachahmlich schönen Worten […:] ›Und wenn Gott zwischen mich und die mir auferlegte Tat die Sünde gesetzt hätte – wer bin ich, daß ich mich dieser entziehen könnte?‹«
Es kann hier nicht darum gehen, zu diskutieren, warum Intellektuelle unter beträchtlichem Begründungsaufwand mit Vorliebe dann ein sacrificium intellectus erbringen, wenn sie der moralisch gerechtfertigten Sache zu dienen glauben. Es gilt hier vielmehr, das Opfer und seine Verwandlungen strukturell zu verstehen. Anders als Lux will sich Lukács nicht selbst physisch opfern. Er nimmt die Schuld auf sich, nicht ohne sich zuvor eine Präventivabsolution erteilt zu haben. Indem er jemand anderen, vermutlich den Klassenfeind, über die Klinge zu springen vorsieht, spaltet er die im Ritus noch gewährleistete Einheit von victima und sacrificium, von Opfermaterie und Opferhandlung auf. Das dem Opfer gebührende Mitgefühl, das tragische Prestige des sacrificium, begehrt er für sich selbst. Er nimmt gleichsam die Qualitäten der mythologischen Figur des heiligen Henkers in Anspruch, wie sie Hyam Maccobi beschrieben hat: ein Opferer, nicht ein Opfer, der sowohl als heilig wie auch als verflucht gilt. Der victima, dem politisch Ermordeten, verbleibt nur die Position der katharma, »das bei rituellen Handlungen weggeworfene böse Objekt«, von dem René Girard spricht. Das Opfer heischt Opfer.
*
Den Geist des politischen Moralismus hätte man im 18. Jahrhundert einschlägig als Symptom von »Schwärmerei« bezeichnet. Einen »unternehmenden Haß gegen die, welche sich« ihren Bestrebungen »widersetzen«, ferner »Verfolgungsgeist, Märtyrer- oder Aufopferungsgeist« attestierte Ernst Platner allen Formen der Schwärmerei. Erinnern wir uns, dass Lux mit einer Arbeit über den Enthusiasmus promoviert worden war. Die Grenzen zwischen Enthusiasmus und Schwärmerei erschienen schon den Zeitgenossen durchlässig. Den »Charakter des heldenmütigen Schwärmers« hat nun kein anderer als Friedrich Schiller auf theatralische Weise reflektiert, er hat ihn in der Figur des Marquis von Posa dargestellt und in den Briefen über Don Karlos zudem noch einmal eigens problematisiert. Es ist nun ausdrücklich der Wille zur »Aufopferung«, der laut Schiller den Schwärmer vom Enthusiasten unterscheidet. Posa bringt sich zwar stellvertretend zum Opfer, nämlich für Karlos. Vor allem aber stirbt er für eine Idee. Posa opfert sich als politischer Moralist. Und zwar, indem er seine »moralischen Motive […] von einem zu erreichenden Ideale von Vortrefflichkeit« hernimmt, wie Schiller schreibt. Solche »Ideale von Vortrefflichkeit« unterliegen unter »dem eingeschränkten Gesichtspunkt des Individuums« aber dem menschlich Allzumenschlichen. Sie treten »allzu schnell mit gewissen Leidenschaften« in Verbindung, »die sich mehr oder weniger in allen Menschenherzen finden; Herrschsucht […], Eigendünkel und Stolz, die sie augenblicklich ergreifen, und sich untrennbar mit ihr vermengen.« Das sei, so Schiller, auch der Fall des Marquis. Nicht zuletzt will sich Posa »zu einem Gegenstand der Rührung und Bewunderung« machen. Posa opfert sich im Don Karlos, aber er stirbt weder als Held – das Heroische, so Schiller, nehme er lediglich als »heroisches Palliativ« in Anspruch – noch als tragisches Opfer.
*
Posa, könnte man paraphrasieren, maßt sich den Opferstatus an. So etwas wie eine Opferanmaßung konnte man ja durchaus schon in der Emilia angelegt finden, wenn nämlich die Protagonistin die Position des Opfers und zugleich die der Opferpriesterin bekleidet, und auch die Opferliturgie selbst stiftet. Schiller aber verweigert dem Marquis das Heldentum und das Prestige des Tragischen. Damit läutet er eine markante Tendenz in der Dramatik der Klassik ein. Man kann sie vielleicht als Deeskalationsmaßnahme verstehen, indem sie die Theatralität des Opfers dramaturgischen Beobachtungsmaßnahmen aussetzt. Diese dienen nicht zuletzt der Neutralisierung der vom Opfer nicht mehr befriedeten, sondern entfesselten Nachahmungsenergien. Klassische Dramatik nimmt Distanz ein zur Theatralität des Opfers. So wird im tragischen Konflikt von Schillers Maria Stuart ein geschlechteranthropologisch überformter Kampf um das Opferprestige erkennbar. So etwa, wenn Elisabeth die weibliche Natur als Modell einer milden und gerechten Form politischer Herrschaft adressiert. Auf der Bühne, im Drama selbst, fragt eine Figur, wie Geschlecht mit Macht zusammenhängt. Anstatt die Frage zu beantworten, anstatt Herrschaftsverhältnisse durch eine These über die Natur der Geschlechter zu legitimieren oder zu delegitimieren, nimmt das Drama eine distanzierte Position ein; und zwar einer semantischen Innovation der Moderne gegenüber, die ›Errungenschaft‹ zu nennen ich noch zögere: die Symbolisierung von Gesellschaft durch Geschlecht. In idealisierter Weiblichkeit bekunden sich die Vorstellungen einer sinnhaft unentfremdeten Existenz, für die die Interaktion, nämlich der intime Gefühlsraum der Familie die Norm vorgab. Der Mann jedoch, der ins feindliche Leben, in die Gesellschaft, hinausmuss, sei ein von Natur aus unmoralisches, triebhaftes, List und Verstellung praktizierendes, soziale Kälte verbreitendes Wesen, das der Zivilisierung durch die überlegene Moralität der Frau bedürfe. »So sind die Männer, Lüstlinge sind alle!«, erregt sich in der Maria Stuart einmal die sonst so kühle Elisabeth.
*
René Girard zufolge ist die Tragödie entstanden, als die archaischen Opferkulturen in die Krise gerieten und ihre Leistung, die Bändigung der mimetischen Gewalt, nicht mehr erbrachten. Als solche besitzt sie eine bösartige, sozusagen mit ihrer Entstehung verbundene dionysische Seite, aber auch eine gutartige, apollinische, nämlich ordnende Seite. Das Theater existiert nach wie vor, aber womöglich nur mehr als Anachronismus. Nimmt das Opfer heute daher so häufig den Charakter des Vortragischen an, fernab aller Katharsis? Soll man daher Michel Serres folgen, wenn er konstatiert, unser Zeitalter regrediere in die Opferreligionen der Antike, wenn es von den viktimologischen und sakrifiziellen Dynamiken der audiovisuellen und sozialen Medien überkommen wird: »Aujourd’hui, le sacrifice se met en scène dans la societé du spectacle«?
In dem Maße, in dem Literatur an Leserschaft und Geltung verliert, in dem Maße, in dem kanonische oder nichtkanonische Stücke zu Bildträgern für die Übermalungen einer übergriffigen Regie entmächtigt oder zum didaktischen Vorwand für das Exerzieren sozialmoralischer Agenden in Schule oder Universität verwendet werden, in diesem Maße droht womöglich das Tragische die literarisch ohnehin nicht immer erfolgreich eingehegten Räume zu verlassen. Die komplexen Szenarien der ästhetischen Reflexion scheinen uns immer weniger zur Verfügung zu stehen. Manche Soziologen konstatieren, die bürgerliche Würdekultur, die einst erfolgreich die adlige Kultur der Ehre zurückgedrängt hatte – von diesem Konflikt handelte jedes bürgerliche Trauerspiel –, die bürgerliche Würdekultur habe einer Opferkultur, einer victim culture, Platz gemacht.
*
Bekundet sich in der Proliferation der Opfer, in den moralischen Kulturen der Gegenwart eine Krise des modernen Opferkults? Eine Krise ausgerechnet im Moment seiner größten Konjunktur, im Moment, in dem das symbolische Kapital des Opfers in eine Hochzinsphase eintritt und immer weiter diversifizierte Gruppen alimentiert? Wenn eine kulturelle Errungenschaft schlechthin, das mühsam errungene Opferprestige, die Eskalationsspirale der Nachahmung anzuheizen droht, anstatt sie zu beenden, wenn aus der Sakrifizierung der victimae neue Ritualzwänge entstehen, dann zeigt sich, dass das Opfer selbst eine Fallhöhe aufweist. Es droht womöglich, wiederum mit Michel Serres, »du sacrifice à l’état constant, perpétuel«, das ewige Opfer, das Opfer als Dauerzustand.
Kurzfassung von: Uwe C. Steiner, Opferdramaturgie und Geschlecht. Lessing und die Folgen, in: Uwe C. Steiner / Wim Peeters (Hrsg.), Opferdramaturgie nach dem bürgerlichen Trauerspiel, Würzburg (Königshausen & Neumann) 2024. Dort auch Zitatnachweise und Literaturliste. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Verlages.