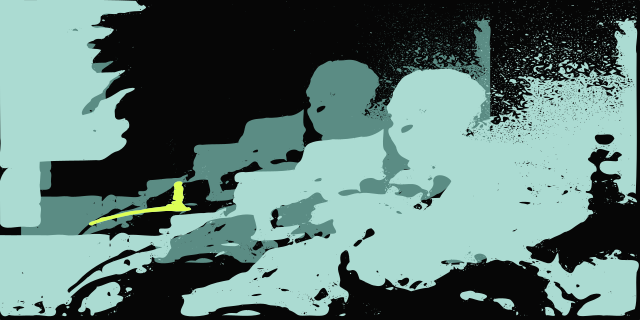von Ulrich Schödlbauer
19.
Auch unsere Moderne wird, wie jede andere, vergessen. ›Unsere Moderne‹? Was soll das sein? Das müssten wir wissen, wir wissen es aber nicht und werden es niemals wissen. Nur wer eine Moderne projektiert, weiß Bescheid, denn er will etwas durchsetzen. Deshalb ist jede Moderne ein ›unvollendetes Projekt‹, solange noch eine Hand sich regt und ein Gehirn sich dafür ›einsetzt‹. Dieser Einsatz für eine bessere Welt, die heute die ökologische heißt und morgen anders, für eine andere Ordnung der Dinge und Menschen, setzt voraus, dass einer sich selbst als in einer anderen – spirituellen oder historischen – Ordnung stehend begreift. Das gilt als ›selbstverständlich‹, aber was heißt das? Die Hoffnung auf Erneuerung kann sich mit allem Erdenklichen verbinden, sie bleibt immer das Tierchen, das trabt. Diese seltsame Allianz aus jungen Leuten, die ihr Lebensrecht reklamieren, und unfrohen Konvertiten, die sich als Träger der frohen Botschaft ihr Quentchen öffentlicher Befriedigung holen, wenn sie nicht nur ihren Etat aufstocken möchten, beide auf der ewigen Suche nach einem Volk, das gegen die Verhältnisse aufbegehrt, nach der Mehrheit ›links von‹, trägt ihre Welt mit sich herum, lebenslang, lebenslänglich. Bei den Erfolgreichen verbindet sie sich mit dem, was sie anfassen, macht gleichsam selbst Karriere und verwandelt sich in ein Plakat, das die verteilte Wirklichkeit verdeckt und ersetzt, bei den Erfolglosen wird sie zum Vorbehalt, zur bitteren Losung, zum Ressentiment und zum Erinnerungsposten. Wer nicht vorankommt, darf es sich merken, man merkt es ihm an und man lässt es ihn merken. Man hält sich auch an ihm schadlos; so endet ein reiches Gelehrtenleben unter höhnischem Erbarmen und doppelzüngigem Lob. Ein recht humanes Schicksal, verglichen mit den Erschießungspeletons und Ausrottungsfeldzügen, mit denen sich seine Vorläufer ins Buch der Geschichte einschreiben durften und denen sie selbst zum Opfer fielen. Die Unerträglichkeit des Humanen muss tief empfunden werden, um sie durch die Unerträglichkeiten der Humanisierung ersetzen zu wollen. Angesichts solcher Prägungen ist Ratlosigkeit ein hohes Gut, das man nicht leicht verschleudern sollte. Erklärungen finden sich immer, sie sind billig und Wasser auf die Mühlen der Erklärten. ›Der Mensch‹ ist kein unvollendetes Projekt, sondern eine traurige Figur, die gern lacht.
20.
Das kulturelle Gedächtnis lebt vom Vergessen. Das wäre nichts Besonderes, im Alltag vergisst es sich nur. Ungezählte Spezialisten, wohlgenährt und kongresssüchtig, halten die Vergangenheiten auf Vorrat, man weiß nicht recht, ob für bessere oder schlechtere Zeiten. Alle haben Nietzsche gelesen und wissen um die Vergeblichkeit, das wahre Bild der Geschichte abseits der Schneisen, die das gegenwärtige Interesse diktiert, auch nur im Vorbeihuschen fixieren zu wollen. Alle drängen in die Öffentlichkeit, die sie sich erfolgreich vom Leib hält. Manche kommen dort an, man gibt ihnen eine Sendung und, wenn sie sich gut machen, eine Sendereihe, man interviewt sie und sie bemühen sich nach Kräften, diese für sie ungewohnte Situation mit Bravour zu bestehen, das heißt, die Grenze zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, zwischen epistēme und doxa zu respektieren und nichts von dem zu verraten, was ihren wissenschaftlichen Alltag ausmacht und worüber sie sich vielleicht gerade in dem Moment ihre Gedanken machen, in dem sie ihn vermissen oder mit einer Wonne davontreiben sehen, die höhere Genüsse verheißt. Die eigene Rede in Kreisläufe einspeisen zu dürfen, die Aufmerksamkeit und sogar Einfluss verheißen, vor allem aber den eigenen Namen für einen Augenblick erglänzen lassen – dieser Versuchung erliegt man leicht und man kann sie bestens begründen, weil in wissensbasierten Gesellschaften Entscheidungsträger aller Ebenen über Wissen verfügen müssen, also jedenfalls von ihm wissen oder informiert sein sollten. Das leuchtet, wie man so sagt, ein, und dabei bleibt es auch. Die Befriedigung, die die Hüter der Vergangenheiten daraus ziehen, dass man sie zu Wort kommen lässt, geht tief, aber nicht auf den Grund. Auf dem Grund lagert, in trägen, unauflöslichen Schlieren, Verzweiflung. Die Gedächtniswissenschaften, über deren Eingängen in Neonlicht ein mattes »Vergeblich« leuchtet, haben Zeit, viel Zeit, vor allem dafür, sich mit ihrem Zustand abzufinden. Manchmal gibt ihnen die Politik einen Stoß, das hinterlässt ein langes, absurdes Rumoren, über das man ›draußen‹ den Kopf schüttelt – schon diese Unterscheidung verheißt Übles, im besten Fall das bekannte »Rührt euch« im Verteilungskrieg um Aufmerksamkeit und Finanzmittel. Die Wurst hängt hoch, aber nicht zu hoch, die schlankesten Köter haben die besten Chancen.
21.
Die Öffentlichkeit ist ein gefräßiger Riese, dessen Verdauung – sozusagen – auf tönernen Füßen steht. Erkenntnisse, die man ihm einzuflößen versucht, erregen sein immer reges Misstrauen. Er sieht voraus, dass sie ihm nicht bekommen werden und weiß sich gut beraten, wenn er weiterhin auf die gewohnte Kost vertraut. Öffentlichkeit und Wissenschaft, sagt man, sind nicht ohne weiteres kompatibel. Dabei ist der gegenständliche Teil ihrer Thesen durchaus im Umlauf – die Öffentlichkeit ist ›in Teilen‹ stets ›erstaunlich‹ informiert, auch wenn sie sich nicht so zeigt. Sie ist sogar auf dem Laufenden, wenngleich dort die Schwierigkeiten beginnen. Da sie nun einmal von den wissenschaftlichen Argumentationstechniken nichts wissen kann, weil sie dazu die eigenen aufgeben müsste, und deshalb auch die Argumente nicht versteht, entgeht ihr in schöner oder unschöner Regelmäßigkeit der Clou der Geschichte und ihr Wissen zerfällt und sammelt sich in den bizarren Weltbildern unzähliger interessierter Zeitgenossen. Das Vorurteil besteht fort, es erhält sich rund und lebendig, solange man immer neues Wissen in die Kreisläufe einspeist. Darin liegt ein großes Geheimnis der Medien, der Zaubertrick, mit dem sie das kritische Publikum zwischen ihre Knie betten. Kein Vernetzungsprojekt zwischen den Institutionen der Wissenschaft und der öffentlichen Vermittlung kann daran etwas ändern – schließlich bestehen die realen Netze vor jedem Projekt und akkomodieren es sich mühelos im Entstehen. Und sie bestehen nicht ohne Grund. Diese selbstreproduzierenden Kamele auf dem langen Marsch durch die Wüste der informationsgestützten Intuition beherrschen den Zeittakt der Gesellschaft. Sie geben – und nehmen – die Zeit, die bleibt, um einen gegenwärtigen Messianisten zu zitieren. Sobald sie ›Druck machen‹, konzentriert sich die Zeit der Hoffnung auf die Dauer, für die sich die massenhafte Abstellung von Journalisten rechnet, davor wie danach herrscht die durée der Hoffnungslosigkeit: »Alles bestens!« Medien, die auftragsgemäß irgendeiner Mehr- oder Minderheitsidiotie huldigen, sind da naturgemäß im Vorteil. Die Unverfrorenheit prescht jeder Recherche voran und schließt die durch gereizte Nachdenklichkeit geöffnete Lücke mit dem Implantat des nächsten ›Wahnsinns‹. Kein Goldzahn, aber eine Goldgrube: die stets offen gehaltene Informationslücke erzeugt diese Leerstelle im Bewusstsein, die selbst hochgebildete und denkstarke Menschen zu beinahe willenlosen Anhängseln des öffentlichen Bewusstseins macht.
22.
Ordnung paradox: sie gewinnt, wenn die Konfusion wächst. Die stärksten Effekte verbucht sie bei aktiver Sinnabstinenz. Wer darüber wacht, dass alle die Regeln einhalten, braucht sich um den Sinn ihres Tuns nicht zu kümmern – es sei denn zum Zeitvertreib. Sinnsuche als Zeitvertreib – die Zeit, die einige Postmoderne nennen, um anzudeuten, dass die Periode der aufregenden Menschheitsziele ebenso vorbei ist wie das zermürbende Warten darauf, dass sie sich einstellen, hat dieses Spiel nicht erfunden, aber unerhört ausgedehnt. Vom Urknall bis zum finalen Erlöschen des Universums reicht die eine Geschichte, in der ›wir‹, koste es, was es wolle, unseren Platz finden müssen. Definiere deinen Platz! So könnte die Devise lauten, unter der patentierte Königskinder sich anschicken, das Raumschiff Erde für eine Weile zu retten, um Aufschub für sich und ihr Tun zu gewinnen. Es ist nicht einfach, die Welt zu retten, aber so schlimm kann es nicht sein. Es geschieht schließlich alle Tage. Heute schon geraucht? Übel, übel, aber nicht ohne Hoffnung. Der Krebs wächst, wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Wer weiß, wo sie sonst ankäme. Die nicht aufgegebene Hoffnung verdämmert in den Zellen eines Denkens, das hauptsächlich damit beschäftigt ist, sich nichts zuschulden kommen zu lassen, was als Aufsässigkeit gegen den Gedanken der Weltbewahrung gedeutet werden könnte. Hoffen wir, dass dort nicht gefoltert wird. Wir sind alle mit den Nerven etwas herunter, kein Wunder angesichts des allgegenwärtigen Problemdrucks. Eine kleine Misshandlung hier, eine kleine Unduldsamkeit dort kann da schon unterlaufen. Und wenn auch. Keine Ratte sein ist schließlich auch ein Konzept. Die Ratten zu jagen – über diese Aufgabe herrscht jener Kónsens, der auf der ersten Silbe betont wird, um anzuzeigen, dass er der bestimmende ist und sich zu verfügen – notfalls auch zu fügen – weiß. Verfügbar ist schließlich das Leid, ein kostbarer, zumeist aus Schwellenländern importierter Rohstoff, aus dem sich seltsame Amulette gewinnen lassen.
23.
Die Entdeckung, überflüssig zu sein, treibt Menschen zu extremen Handlungen aller Art. Das kann auch die ohne Rücksicht auf sich selbst betriebene Pflege eines kranken oder alternden Menschen sein, die gezielte Unachtsamkeit auf das, was im eigenen Leben ansteht, wenn es als ganzes gestaltet werden soll – was bei den ökonomischen Grundlagen anfängt, aber noch lange nicht endet. So beginnt einer, zwei Leben zu leben anstelle des einen – sein ungelebtes und eines, das er gleichsam stellvertretend absolviert, weil sich niemand anbietet, der aber da sein müsste, wenn die unterstellten Bedürfnisse der anderen Seite befriedigt werden sollen. Und befriedigt werden müssen sie, sofern der Sog nur groß genug ist, der von der anderen Person oder auch nur den Umständen ausgeht, in denen sie sich befindet, und die sie immer wieder herzustellen weiß oder nicht zu verlassen klug genug ist. Worin diese Umstände bestehen? Manch einem – und einer – genügt das Sich-Fallenlassen in immer neue kleine und größere Katastrophen des Alltags, eine Unfallneigung, ein kleines Laster, das aber vom anderen gedeckt sein will, wenn die Lichter nicht ausgehen sollen. Bei Bedarf können depressive Zustände nachgeschoben werden, auch darin bekommt die Seele Übung. Am Ende steht – als Vision oder Realität – der ans Bett oder an den Rollstuhl gefesselte, der verbrauchte Mensch, der Mensch, der nicht leben und nicht sterben kann. Einen Partner zur Seite zu haben, der diesen Weg mitgeht, zählt zu den großen Beruhigungen des Lebens. Was liegt also näher, als ihn zu testen? Ihn immer und immer wieder zu testen – was doch nichts anderes heißt, als ihn zu erpressen, ein ums andere Mal, ein ums andere Jahr, ein ums andere Jahrzehnt. Die an die Stelle der ›konventionellen‹ Ehe gesetzte Partnerschaft – ein Zweckbündnis – lockt zu solchen Tests, es ist der übliche Weg, auf dem sie entgleist. Aber wer sagt denn, dass sie entgleist? Dass sie nicht auf diesem Weg ins Gleis kommt?
24.
Die Idee des Nachtwächterstaates ist nicht falsch, sie reicht nur nicht aus. Wer will, dass alle die Regeln einhalten, muss den Sinn ihres Tuns zerstören, sobald er ›ordnungsrelevant‹ wird. Nicht das Geltenlassen ist also der Sinn der Veranstaltung, sondern der einzurichtende Geltungsraum, in dem sich die Protagonisten des Spiels ungehindert bewegen können. Dieser Raum wird durch seine Ränder bestimmt, durch gewöhnlich halb oder gar nicht sichtbare Marken im Gelände, deren Überschreitung aus dem Gesprächspartner eine befremdliche Person werden lässt, die ›Feind‹ zu nennen bereits selbst ein befremdlicher Vorgang wäre, der besser unterbleibt. Die liberale Gemeinschaft kennt keine Feinde. Die paradoxe Formel deckt einen paradoxen Sachverhalt. ›Weimar‹ bleibt das Synonym für ein über seine Grenzen hinaus beanspruchtes liberales Gemeinwesen, für eine Gesellschaft ohne Gemeinschaft, um den Ausdruck Tönnies' zu gebrauchen. In der Regel hilft ein starker Glaube, wie ihn Hannah Arendt und andere nach ihrem Zusammenbruch in Amerika vorfanden. Aber er ist nicht übertragbar. Übertragbar sind – in Maßen – Institutionen und Vorschriften, übertragbar sind Redeweisen und Bilder, Erziehungskonzepte und eine gewisse Art, sich permanent unter Strom zu halten, gewissermaßen eine propagandistische Existenz zu führen, in der einzelne Wörter und Sätze einen markigen Klang besitzen und die Art und Weise, in bestimmten Situationen die Augen aufzureißen, keinen gesellschaftlichen Typus verrät, sondern die augenblicklich angesagte Aufgabe. Man sieht das bei Politikern, Moderatoren und Machern, man sieht es auch bei den bedauernswerten Menschen, die für ihren Beruf ›alles‹ geben oder zu geben behaupten, bevor sie die nächste psychische Krise für eine Weile vom Arbeitsplatz entfernt.
25.
Was sehen wir? Ehrwürdige Greise, Überlebende vergangener Bewegungen, ohne Unterlass bemüht, Worte für eine offen zu haltende Zukunft zu finden, während die aktiven Eliten lächelnd darüber hinweggehen. Ohne Avantgarde ist die Moderne am Ende. Dies auszusprechen – nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern öffentlich, ex instituto, mit dem Gewicht einer erworbenen Stellung – bedeutet, ein Spiel in Gang zu setzen, in dem nur der zur Avantgarde zählt, der ihr Ableben als gegeben ansieht oder anzusehen behauptet – ein stabiles, auf Jahrzehnte hinaus gültiges Spiel. Das kann nicht anders sein, wenn die von Habermas angespitzte Charakterisierung stimmt, dass sie allein sich den Risiken plötzlicher, schockierender Begegnungen mit dem aussetzt, was noch nicht bekannt, noch nicht kartographiert und ›besetzt‹ ist. Das muss wohl die Zukunft sein, jedenfalls in der Form, in der man sie kennt und liebt. Leider besitzt die als Zukunft bestimmte Offenheit die Eigenschaft, sich nur dem rückwärts gewandten Blick als das eingetretene Neue zu offenbaren. Man muss schon die richtigen Instrumente besitzen, um im Gewimmel all dessen, was unaufhörlich ›eintritt‹, die Spur des Neuen, das ›wir‹ sind und zu sein verlangen, zu entdecken. Dagegen ist der produzierte Schock eine Kinderei, desgleichen das hartnäckige Bestehen darauf, dass ›die Zukunft‹ durch diese und keine andere Tür eintritt, während man in dem, was wirklich geschieht, nur das Immergleiche einer verkehrten oder verstellten Welt zu erkennen vorgibt. Es gibt solche Türen nicht. Was es zu geben scheint, sind Schwellen, die von Mal zu Mal ›auftauchen‹ und die man nicht überschreitet, ohne in eine andere Welt einzutreten, eine Welt, in der dieselben Parameter nicht mehr das gleiche Gewicht haben wie zuvor und andere aus dem Nichts aufzutauchen scheinen, bevor man sie rückblickend in fast jeder Vergangenheit findet. Manche Begegnungen mit der Zukunft gehen tödlich aus; der Verschleiß kann hoch sein. Was gestern Metapher war, glänzt heute als Messer in der Brust eines Menschen, der es besser wüsste, wenn man bereit gewesen wäre, ihn leben zu lassen.
26.
Aber, liebe Direktion, es gibt kein ›unbesetztes Gelände‹, hier nicht und in Zukunft nicht, weder für Avantgarden noch für irgendwen sonst. Man muss es schon jemandem wegnehmen, und sei es den Nichtkombattanten inmitten der öffentlichen Auseinandersetzungen, die der kriegerische Hochmut nur als Zulieferer gelten lässt. Die Avantgarde ermittelt die Stärke des Gegners, das ist ihr Auftrag und ihr Spiel - sofern sie spielt. Man sollte nicht vergessen, welch rüdes Volk sich unter diesem Zeichen zusammenfindet. Es gibt nichts Tastenderes, Abwägenderes, Ungewisseres, selbst Unwissenderes als ein Wissen, das sich der Bestimmung des Heute nähert, es bezeichnet in allem den vollkommenen Gegensatz zur voreilenden Besserwisserei, die genau weiß und mit großer Gebärde austeilt, was an der Zeit ist und wie sich die Zukunft gestaltet. Diese besondere Macht über die Gemüter kommt aus der Zeit selbst, jemand meldet sich immer, der sie beansprucht, gleichgültig, ob das Wort Avantgarde Konjunktur hat oder gerade in die Rumpelkammer verbannt wurde. Man sollte ihr daher nicht nachtrauern, sich eher fragen, auf welchen und vor allem, auf wessen Trick man hereinzufallen im Begriff steht, wenn man ihren Verlust konstatiert. So wie es Leute gibt, die die Rückkehr des klassischen Intellektuellen fordern, den es nie gegeben hat und nicht geben kann, so gibt es Leute, die ungestüm eine Klasse von Bauchrednern zukünftiger Entwicklungen fordern, sich jedoch völlig desinteressiert an der Analyse so heikler Begriffe wie Zukunft oder Entwicklung zeigen. Sie erinnern an abgefallene Zeugen Jehovas, die mit Jehova nichts mehr im Sinn haben, aber weiterhin Zeugenschaft verlangen, oder an Ideologen, die mit jedem Marxschen Dogma gebrochen haben und unverdrossen für eine genuin marxistische Politik werben.
27.
Der Widerspruch zur Moderne entstammt keinem Gestern oder Morgen, keinem Jenseits der Epoche. Sie selbst bringt ihn hervor. Sie nimmt jeden mit. Konservative und Progressive, Realisten und Utopisten — sie spielen ihren Part. Scheinbar zeitversetzt, doch stets in tempore. Jedenfalls dann, wenn der Begriff der Moderne das leistet, was seine anspruchsvolleren Apologeten von ihm erwarten. Nur als Epochenspender lässt sich Moderne begreifen. Wer in ihr eine Bewegung sieht, der man sich anschließen oder gegen die man opponieren kann, versteht nicht, dass modern sein im Ernst nichts weiter heißt, als an der Zeit sein. Die Besorgnis, nicht auf der Höhe der Zeit zu sein, nicht mitzuhalten - mit was auch immer -, lässt jede Bewegung, auch Modernebewegung, veralten. Wenn es modern ist, der Parole von der überwundenen Moderne zu folgen, dann gibt es kein Halten. Deshalb fällt jede ausgerufene Nachmoderne zwanghaft und zwangsweise wieder in den Fluß der Moderne zurück. Moderne beginnt, aber sie endet nicht. Wer ihr Ende ausruft, steht als ebenso seltsamer Prophet in der Wüste wie ein Vertreter der These vom Ende des Staates oder der Kunst oder der Religion. Moderne ist nicht angewiesen darauf, dass jemand den Ausdruck mag. Wie die Avantgarde versteckt sie sich mühelos unter tausend Begriffen. Im Alltag genügen Betonungen oder Einfärbungen der Aussprache, die bestimmte Vokabeln eine Zeitlang wie geheimnisvolle Markierungen tragen, um ihre Botschaft zu übermitteln. Was geht und was nicht mehr geht - das Ausmitteln dieser Grenze realisiert den Gehalt von Moderne, wann immer es geschieht, mit welchen Mitteln auch immer. Deshalb sind Modernetheorien so öde, die über den realen Gehalt der Moderne Auskunft geben sollen.
28.
Es klingt immer kurios, zu erfahren, ›wir‹ hätten die Moderne hinter uns, ebenso kurios, als wollte man uns verkaufen, wir hätten sie vor uns. Vor allem deshalb, weil immer dabei anklingt, man habe sie überwunden, so, als sei sie plötzlich als Jugendtorheit entlarvt oder als Anfangsschwierigkeit eines größeren Unternehmens gelöst oder beiseitegeschafft worden oder als habe man einen Feind besiegt und eine gefährliche Okkupation gerade noch rechtzeitig beendet. Die professionellen Überwinder der Schwierigkeiten halten es wie die Ministerin, die ihren Beamten verbietet, in ihren Vorlagen das Wort 'Problem' zu benützen. Sie schaffen Probleme. Die Moderne, und nicht erst sie, hat eine Problembürokratie geschaffen, die mit jedem öffentlichen Problemschnitt anwächst. Kein Problem, das dort nicht verwaltet würde, sorgfältig registriert, beobachtet und verwahrt, mit philosophischen, juristischen, ökonomischen, hermeneutischen Behandlungsvermerken versehen, in Erwartung der Stunde, in der es erneut zur Begutachtung ansteht, man wird sehen, wie danach weiter zu verfahren ist. Die gezielte Reduktion der Probleme im Dienste des Lebens, der Politik, der Karriereplanung oder auch nur von Projekten, für die man eine Zeitlang bezahlt wird, gelingt erst vor dem Hintergrund dieser geschmeidigen und effizienten Verwaltung, man kann auch sagen: dank der Gesichtslosigkeit des überwiegenden Teils der Tätigkeiten, die im Bereich des Denkens täglich anfallen. Den Beamten gefällt ihre Ministerin und sie möchten ihr keine Schwierigkeiten bereiten, lieber nehmen sie weitere auf sich und protestieren nur hinter der vorgehaltenen Hand.
29.
Zu dieser Haltung gehört, dass einer sich nur zu Wort meldet, um den Matadoren des wissenschaftlichen und kulturellen Bewusstseins seine assistierenden Gedanken anzudienen oder ihnen eins auszuwischen, indem man sich an den jedermann zur Einsicht freigegebenen Problemkataloge bedient. Das ist legitim, es richtet keinen Schaden an und bringt ihn mit ein bisschen Glück ins Gespräch. Ansonsten bleibt es subaltern. Es bliebe auch subaltern, wenn man recht behielte, das heißt für den Fall, dass der Gedanke, den man in die Arena wirft, dort aufgenommen und nach einem Moment des Bedenkens auch eingesetzt würde. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Fall eintritt, liegt nahe bei Null. Nicht dass die Helden der Arena nicht sähen, was ihnen da zugespielt wird. Aber sie werden sich hüten, ihre erworbene Stellung dadurch zu gefährden, dass sie neue Akteure ins Spiel bringen. Sollten sie es einmal versuchten, würden sie rasch daran erinnert, zu welchen Konditionen sie arbeiten und worin ihre Tätigkeit besteht. So bleibt ihnen der zweifelhafte Genuss, an sich selbst zu erfahren, mit welch schlichten Mitteln Superiorität und Meinungsführerschaft ins Werk gesetzt werden. Die großen Anreger sind große Zudecker, sie sorgen dafür, dass die Blicke der Kompetenten starr auf die Arena gerichtet bleiben. Die Arbeit am Horn des Problems wird von Leuten verrichtet, die ihre Präsenz aus der Wiederholung immer derselben Griffe bestreiten und auf diese Weise ein unerhörtes Pensum erfüllen, wie das raunende Publikum weiß, das mit seinem ordinären Alltagsfleiß sich redlich die Einladungskarte zum nächsten Symposium verdient.
30.
Die postmoderne Massengesellschaft erzwingt solche Trennungen. Das Medium, über das sie kommuniziert, heißt, wie man weiß, ›Fernsehen‹, so als sei die unendliche und unüberwindbare Distanz zwischen denen, die 'in Betracht kommen', und all den anderen in den elementarsinnlichen Vorgang des Sehens eingetreten und habe die europäische Tradition, die den Ausdruck für alle möglichen Erkenntnisoperationen einsetzt, an dieser Stelle außer Kraft gesetzt. Fernsehen ist keine Metapher, sondern die reine Wahrheit, wenn man die von ihm erzeugte Illusion beiseitelässt, es handle sich darum, physische Distanzen zu überbrücken und in gesellschaftliche Räume einzudringen, die einem sonst verschlossen blieben. Die Distanz, die das Fernsehen überbrückt, wird von ihm selbst geschaffen. Die Mattscheibe ist sein Symbol. Zwischen den Leuten, die hinter der Scheibe agieren, und denen, die vor ihr sich ihrer Stiefel entledigen, herrscht eine absolute Differenz, die von den ebenso aktiven wie naiven Zeitgenossen, die alles daransetzen, um - wenigstens ein Mal - hinter die Scheibe zu gelangen, tätig geleugnet und zugleich bestätigt wird. Der Wunsch all derer, die hineinkommen wollen, gipfelt bekanntlich darin, sich selbst darin zu sehen. Wer, durch welche magische Operation auch immer, auf die andere Seite der Scheibe gelangt ist, kann bestätigen, dass sich dort nichts befindet, jedenfalls keine 'Wirklichkeit' außer der banalen von Leuten, die ihren Job verrichten und auf die eine oder andere Weise die Verwandlungsmaschine bedienen und am Laufen halten. Der fernsehende Mensch weiß, dass er nicht in Betracht kommt, der betrachtete, dass daran kaum mehr interessant ist als die Position, die er einnimmt und um keinen Preis herzugeben bereit ist, weil er davon überzeugt ist, dass nur der ein Mensch genannt zu werden verdient, der in Betracht kommt. Das Fernsehen ist, wie die Sprache, ein großer Entwerter, man nennt es die Sprache der Analphabeten. Es hat den Betracht, in den einer kommt, in eine unbestimmte und unbestimmbare, vor allem praktisch, das heißt durch eine vernünftige und vertretbare Praxis nicht erreichbare Ferne verschoben, es ist der Tabernakel, vor dem sich die Linien von Ehrfurcht, Erwartung, Erstarrung, Missmut und Unglauben kreuzen. Es gibt keine Wirklichkeit, es sei denn aus diesem Kasten: die Theorien, in denen das mit der üblichen Emphase als frohe Botschaft verkündet wurde, sie fallen, eine nach der anderen, der Entwertung anheim, in deren Dienst sie sich begeben hatten. Wer immer sich vor den Kasten setzt, weiß, dass er im Begriff steht hereinzufallen, und ob er sich hütet oder gehenlässt, es kommt auf dasselbe heraus. Er weiß es. Er lässt sich gehen und ist auf der Hut. Der Schatten des Erbärmlichen streckt sich neben ihm, er hat es leicht.
31.
Der Gedanke der Distanz hat eine lange Geschichte hinter sich, ehe er als eine Art Grundmotiv der Moderne auftritt. Auch hier behält er die Schein-Eindeutigkeit, mit der er sich Leuten andient, die sich eher ›geistig‹ verstehen: Intellektuelle, Gläubige, Ideologen, Weltflüchtige, Invaliden des Apoll und der Infinitesimalrechnung. Nichts geht leichter auf dem Papier (oder an der Tafel) vonstatten als das Einklammern. Was zwischen die Klemmbacken der Abstraktion gerät, ist nicht verschwunden, aber relativiert, es wird zur handlichen Größe auf einem Operationsfeld, in dem es um andere, wichtigere Dinge geht - den Wurf etwa, der den Distanzierten in eine neue, nicht notwendig homogene Zeit- oder Wertordnung schleudert. Zur Distanz gehört das Aperçu, die in einem Punkt zusammenfließende oder -schießende Weltsicht, mit der sich der Einzelne aus einer festgefügten Konstellation heraussprengt. Zu ihr gehört das ›Verhältnis‹, das kalkulierte Sich-Verhalten und Mit-etwas-Umgehen, auf das für viele sich der gesuchte und gefürchtete ›Kontakt‹ mit der Außenwelt beschränkt. Zu ihr gehört auch die Urteilsabstinenz, das stornierte Bekenntnis, das sich prachtvoll mit einem funktionierenden Weltgewissen vereinbaren lässt. Das ist nicht verwunderlich, da letzteres auf Ritualen beruht, die den Kernbestand eigener Überzeugungen freilassen. So bildet sich bei allen, die verantwortlich denken, ganz natürlich heraus, was Orwell einst ›double speech‹ nannte, die gespaltene Zunge. Der unterdrückte Einwand ist immer mitgedacht, er stellt eine Art strukturierender Folie dar, auf der sich die Rede bewegt, die sich einer erlaubt. Schließlich gehört zur Distanz, dass einer ausweicht: das kann höflich sein oder feige, rücksichtslos oder klug, jedenfalls zählt es zu den Kulturtechniken, die jede Kultur überleben, weil ohne sie keiner überlebt. Die Kulturen selbst, diese großen Kommunikatoren, weichen sich in ihrem Kernbestand aus und das scheint gut so. Sie verkehren miteinander und sie halten Abstand. Wer das nicht nüchtern sieht und seine mitgebrachte Kultur der anderen zu opfern gedenkt, kommt nicht an, sondern gerät ins Abseits. Er ist kein Partner im Gespräch der Kulturen, sondern ein Zwischenträger, dem man manches abnimmt, aber beileibe nicht alles. In einem gewissen Sinn kommt er nie in Betracht. Das Gespräch führen andere, die keine Sekunde zögern, das Gewicht der eigenen Rede durch heimische Praktiken zu steigern und dort Distanz zu erzeugen, wo sie sie für angebracht halten. Der ›Kampf der Kulturen‹ ist identisch mit dem Schrecken schlechthin, ein Freibrief für grenzenlose Gemetzel, wie man nicht erst seit den Schützengräben des Ersten Weltkriegs weiß.
32.
So wenig es Moderne ›gibt‹, so selbstverständlich gibt es eine Geschichte der Moderne. Sie ist immer eine Geschichte unter anderen - was manche Theoretiker dazu verführt hat, eine Vielzahl unterschiedlicher ›Genesen‹ für die Moderne zu proklamieren. Es mag sein, dass jede Geschichte auch ein wenig Ursprungsgeschichte ist, aber in diesem Fall lässt sich die fundamentalistische Pointe nicht übersehen. Die - konkurrenzlose - Geschichte der Moderne ist der Gang der industriellen Gesellschaft - ihr Gang wohlgemerkt, nicht ihre ›Ausbildung‹. ›Als solcher‹ ist der Kapitalismus ebenso wenig modern wie der Sozialismus oder irgendeine andere Denkschule. Erst der empfundene, behauptete, beschriebene Gegensatz gegen die Alten (›les ancients‹) ›macht‹ die Moderne, er macht sie immer aufs Neue und immer neu, so wie die ›Alten‹ des siebzehnten Jahrhunderts nicht lange gemeint bleiben, sondern durch andere ersetzt werden. Die Geschichte hinter der Moderne ist also die Geschichte der Verschiebungen in der Art, wie die Alten, die Vormodernen, die Welt vor dem Schnitt ausgezeichnet werden: eine diffizile Angelegenheit, da jeder, der hier forscht, mit störenden Interventionen seiner Lebenswelt rechnen muss. An nichts lassen sich vormoderne Zustände zuverlässiger identifizieren als an ihrer ›veralteten‹ Technik. Je schneller oder intensiver der vom Betrachter erfahrene technologische Wandel, desto leichter verschwimmen die Grenzen zwischen den verschiedenen Zonen des als nicht mehr zugehörig empfundenen Alten, desto punktueller zeigt sich Moderne. Auch die andersartige Stabilität ›geistiger‹ Einstellungen und Werke wirkt irgendwann befremdlich und muss erklärt werden. Gleichgültig, wie diese Erklärungen ausfallen, sie nehmen dem ›Phänomen‹ eine Spitze, sie machen es weniger selbstverständlich, sie nehmen ein Stück ›Geltung‹ heraus und deponieren es im Erklärungsmuster, am Ende in der Notwendigkeit der Erklärung. Die zu wendende Not ist gerade immer die, auf die das Geistige antwortet - was bedeutet, dass es mehr oder weniger rasch zum Akzidenz dieser Not selbst wird, die wir nicht nur erklären, sondern wenden, soll heißen, in einer nahen oder fernen Zukunft beseitigen können.
33.
Auf diese Weise kommt auch der prophetische Typus in die Moderne hinein, der die substanzielle Arbeit zur Bewältigung der Lebensnot – die Sinngebung des Unabwendbaren – als ›Verklärung‹, ›falsches Bewusstsein‹, ›Sublimierung‹ etc. - beschreibt und die Forderung erhebt, es müsse die Geschichte der Entbehrungen, gehüllt in den Glanz intellektueller und realer Eroberungen, umgeschrieben werden in eine Geschichte der Hoffnungen, der guten Ansätze, des Fortschreitens insgesamt auf einem Weg, an dessen Ende die Abschaffung der symbolischen Deutungen der Lebensnot stehen werde, da diese selbst dann behoben sei. Er weiß sich in ihr ›gut aufgehoben‹ und zeitweilig sieht es so aus, als ergreife er von ihr Besitz - als sei die Moderne nichts weiter als eine Abfolge von Versuchen, über sie hinaus zu gelangen, eine Art Jakobsleiter ins Reich der Freiheit oder der Wartesaal eines Kopfbahnhofs, von dem aus pünktlich die Züge in Richtung Zukunft starten. Das Wartesaal-Bild besitzt eine von ›Realisten‹ immer wieder namhaft gemachte Pointe: das erstaunliche Vertrauen in eine im Hintergrund regelnd aktive Verwaltung, die umstandslos dafür sorgt, dass alles so eintrifft, wie man es sich ausgedacht wird. Dieses Vertrauen kann bei Gelegenheit in Misstrauen und Säuberungen umschlagen, wie die Geschichte der totalitären Gesellschaften zeigt. Aber man versteht unmittelbar, dass Vertrauen und Misstrauen hier nur zwei Seiten einer Medaille sind. Dieselbe Bürokratie, die Regeln für eine ›geschlechtergerechte Sprache‹ ausgibt, weiß die Strukturen zuverlässig zu bewahren, die damit abgeschafft werden sollen. Die Verwaltung erfindet den neuen Menschen nicht, sie setzt ihn um. Dieses ›Umsetzen‹ ist der Kernbereich der Moderne, ihr Mysterium. Es muss begriffen werden, wenn es darum geht, Erfolg und Misserfolg der Moderne und ihrer Ziele zu taxieren. Entsprechend viele Beschreibungen sind im Umlauf. Sie erläutern anschaulich, was mit Visionen geschieht, wenn sie sich in bürokratische Regularien verwandeln. Sie demonstrieren auch das spezifisch bürokratische Vermögen, Realitäten zu schaffen und zu verändern. Dennoch behält das Umsetzen einen geheimnisvollen Aspekt, der nur auf einer sehr allgemeinen Ebene von Glitzerwörtern und Nichts-weiter-als-Formulierungen gestreift wird. Er betrifft Erwartungen an die Zukunft, die ebenso leicht als maßlos oder ›überschießend‹ gebrandmarkt wie als überlebensnotwendig und der Gattung geschuldet angesehen werden können. Moderne ist die Zeit, in der nach kurrenter Überzeugung das nicht Gestaltbare, die Zukunft, gestaltet wird. Darin liegt das Mysterium.