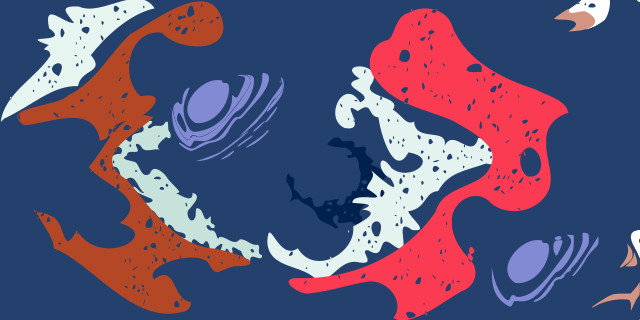von Ulrich Schödlbauer
Meine erste Begegnung mit der Kunst Walter Rüths – nicht mit seinen ersten Bildern, sondern mit dem, was er bald darauf grab_art nannte – verdanke ich, so unglaublich es klingen mag, einem Fahrradsattel. Dieser Sattel, wenn man ihn noch so nennen darf, hat sich aus seiner Halterung gelöst, er ist emporgestiegen, fast wie ein Tier, ein Marder oder ein Eichhörnchen, das sich kurzfristig auf seine Hinterbeine stellt, um zu schnuppern, vielleicht eine Gefahr, vielleicht die Freiheit oder einen Hauch davon. Gerade so, mit dieser charakteristischen Biegung der Hinterbeine, in der sich die Spannung und das Ungewohnte der Situation mitteilen, steigt der Sattel vor dem erstaunten Auge des Betrachters auf, das schon ahnt, dass dieser Zustand nicht von Dauer sein kann, dass er heraustritt aus der Zeit der Begebenheiten und dadurch natürlich eine eigene Dauer gewinnt, die ihm niemand mehr nehmen kann, eine im Bild gewonnene Dauer.
Doch nicht diese gewonnene Dauer war es, die mich überzeugte. Was meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm und auch diesmal in Anspruch nimmt, ist die von einer unsichtbaren Hand ausgehende Bewegung, die den unmöglichen Moment hervorbringt, in dem sich ein am Rand bereits ein wenig zerfressener und vom Gebrauch blank polierter Sattel aufrichtet – wider seine Natur, möchte man anmerken, obwohl man natürlich weiß, dass in seinem Fall von einer Natur nicht die Rede sein kann und man das Bild nur ein wenig drehen muss, um ihn in beliebiger Positur betrachten zu können.
Andererseits – was weiß man schon ›natürlich‹, das heißt von Natur aus? Wenig, sehr wenig. Wer ein Ding, eine Sache, einen Gebrauchsgegenstand vor einen neutralen Hintergrund stellt, also aus seiner Funktionalität herauslöst, ihn gleichsam in Klammern setzt und gleichzeitig präsentiert, der verrätselt diesen Gegenstand. Das empfindet jeder Mensch so, der mit offenen Augen seine Umgebung aufnimmt, während der Funktionsmensch, der Mensch, der zu tun hat und seine Zeit kalkulieren muss, die Spielerei, wie er sagt, mit einer gewissen Ungeduld beiseiteschiebt. Dieser Sattel, dessen Farbe von aparten Brauntönen bis ins Bläuliche hinein schimmert und hier und da zarte Ansätze eines Grüns erkennen lässt, das man von sehr jungem Gemüse kennt, dieser leicht heruntergekommene Prachtsattel hat keine Funktion mehr, er wurde ausgesondert, weggeworfen vielleicht. Aber das bleibt nebensächlich gegenüber dem Umstand, dass die bereits erwähnte unsichtbare Hand ihn in eine Spannung stellt, die überhaupt nur im Betrachter existiert – und auch dort nur als minimale Regung. Ein plötzlich Tier gewordener Sattel, der diese Anmutung herausfordert, aber durch Stille, durch Reglosigkeit, durch Nichtherausforderung, durch den Verzicht auf jegliche penetrante Assoziation, ist schon etwas Besonderes, er ist ganz und gar künstlich.
Dieses Wort besitzt einen verdächtigen Klang, der sich gleichermaßen mühelos mit dem potentiell gefährlichen Kunststoff wie mit der künstlichen Aufregung zu verbinden weiß. Dennoch erscheint es angemessen, es an dieser Stelle zu wiederholen. Rüths Fotografien, die Bilder sind, die manchmal wie Fotografien aussehen, obwohl sie zweifellos Fotografien sind, zeigen höchst künstliche Wesen. Man sagt das gern über Porträtfotografen, die ihr Handwerk verstehen – wie der berühmte Helmut Newton, der einmal Helmut Neustädter hieß – und denen es gelingt, Schauspielerinnen oder anonym bleibende Zeitgenossen in Figuren eines Traums zu verwandeln, der wenig mit der realen Welt zu schaffen hat. Diese Art Künstlichkeit, die aus Prominenz und Unbestimmtheit Wunschwelten hervorgehen lässt, ist hier nicht gemeint. Kein sozialer Traum verbindet den Betrachter mit den von Rüth in den neutralen Bildraum gestellten Objekten, auch nicht der Albtraum, in den uns der Anblick einer im Abfall ertrinkenden Welt hineinnötigt.
Wenn ihn überhaupt etwas mit ihnen verbindet, dann die leise Spannung, in die sie ihn unentwegt versetzen: Ist das wirklich nur ein Sattel? Ist das wirklich nur ein Steinmännchen? Ist das wirklich nur ein gekrümmtes, getrocknetes, verkrüppeltes Blatt? Man kennt solche Effekte seit Duchamps Ready-mades aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts. Dort wird diese Frage nicht nur gestellt, sondern auch unentwegt beantwortet: »Ja, es ist nur ein Urinal, ja, es ist nur ein Fahrrad, das Sie hier sehen, aber gerade deshalb – sehen Sie hin! Schließlich befinden Sie sich in einer Ausstellung.« Diesem bejahrten Spiel eine neue Variante abzugewinnen ist nicht so einfach. So kann man auch vor Rüths Fotografien sagen: Ja, es sind nur Steine, Blätter, Früchte, Sättel oder Kleiderbügel. Was sollten sie sonst schon sein?
Was sollten sie sonst schon sein? Die etwas heruntergekommene Frage zielt, alle wissen es recht gut, nur vordergründig auf die Dinge. In Wirklichkeit zielt sie auf den Menschen, der sie uns so präsentiert. Was will er uns damit sagen? Will er überhaupt etwas damit sagen? Oder will er nur gesehen werden als die Person, die hinter diesen Dingen steht und sie uns entgegenhält? »Aber Herr Duchamp, haben Sie das nötig? Ein so bedeutender Mensch wie Sie!« So könnte man natürlich fragen, obwohl man im voraus weiß, dass es darauf keine Antwort gibt als: »So sehen Sie doch hin!« Nein, die Frage zielt nicht auf den Menschen, der sie uns gerade entgegenhält, sie zielt durch ihn hindurch auf den Menschen, der solche Dinge tut: auf den Menschen inmitten der Menschen und inmitten der von ihnen geschaffenen Dingwelt.
Diesem Menschen geht es ganz gut, solange er sich nicht überhebt oder an den Rand des Getriebes gerät oder durch den unergründlichen Ratschluss einer fremden Instanz verkrüppelt oder ausgelöscht wird. Es geht ihm gut, heißt das, solange er sich nicht freistellt und in sich die vibrierende Spannung erzeugt, auf die wenig mehr antwortet als das ›unermessliche Schweigen der Räume‹, von denen uns die Naturwissenschaftler sagen, dass sie voller Geräusch sind, voller Gequengel gleichsam, das den Theoretikern viel, dem auf Eigenspannung gestellten Menschen nichts sagt. Aus solchen Momenten entsteht hin und wieder eine symbolische Geste: Jemand ergreift einen Stein und lässt ihn über eine Wasserfläche dahinflitzen, ein anderer stürzt sich in den Ätna oder vom Dach eines Hochhauses in eine Tiefe, die immer dieselbe ist, gleichgültig, was die Sicherheitsleute dazu sagen, ein Dritter ergreift irgend etwas, nicht um es zu ergreifen, sondern um eine Art Parität zu schaffen.
»Ergreifen, was uns ergreift« lautet die Formel dafür, die aber insofern ungenau bleibt, als dieses Ergreifen niemals und nirgends als ein einziger Akt vorgestellt werden kann, sondern eher dem Balancieren auf einem Hochseil gleicht. So etwas geht nur Zug um Zug, es ist weniger ein Vorankommen als ein ausgleichendes Sich-Hineintasten in immer neue Lagen, in immer neue Gleichgewichtskonstellationen, in denen die derart radikal verkürzte Welt ebenso ein neues Aussehen bekommt wie der Artist, obwohl beide nicht wirklich aus ihrer Vertrautheit entlassen werden. Wo diese Vertrautheit nicht mehr gegeben ist, wo die Welt nicht mehr die Welt und der Künstler ein anderer zu sein glaubt, wo es plötzlich wie auf Schienen dahingeht, drängt sich die Erwartung in einem Punkt zusammen: sie nimmt den Absturz vorweg, der unausweichlich kommt, wobei die letzten Figuren vermutlich die kühnsten sind.
Betrachten wir diese Steine und Blätter, so stellen wir fest, dass ein wenig von uns dabei ist – nicht viel, nur ein wenig – was weder viel noch wenig bedeutet. Es sind aber nicht die Ähnlichkeiten, die uns bewegen, wenn wir versuchen, in Bezug auf die eigene Wahrnehmung genau zu sein, es sind nicht die vagen Assoziationen, die der Anblick dieser Bilder wie der Anblick ziehender Wolken in uns auslöst. In diesem mehr oder minder freien Assoziieren, das sich schwer abstellen lässt, gibt es etwas, das jenes primäre Berührtsein durch die Bilder überblendet und verdrängt. Manche nennen es Neugier auf das, was jenseits des Bewusstseins liegt – das Organische im Menschen, den Stein im Menschen, wenn damit das absolut Bewusstseinsferne gemeint sein soll, jene Regionen also, in denen wir mit den Dingen weniger verwandt als identisch sind. Nun ist Identität eine Kategorie, ein sehr allgemeiner Begriff, der sanft oder unsanft daran erinnert, dass das Denkens uns nie entlässt – in Träume vielleicht, aber auch an die müssen wir uns erst einmal erinnern, wenn wir wissen wollen, was in ihnen passiert. Diese Steine sind wirklich, sie sind kein Traum, sie sind keine Assoziationen, sie sind keine verkleideten Personen, sie sind aber genauso gut unwirklich, eine verkleidete Einsicht, die nackt nicht zu haben ist. Sie sind weniger Gegenstände als Welt-Orte, an denen die Neugier fündig wird, ohne dass sie aus sich heraustreten müsste, um an der Erforschung und Erkundung des Neuen teilzunehmen und seiner zweckmäßigen Inanspruchnahme vorzuarbeiten.
Der Künstler, der einen ›Blick‹ für die Gegenstände hat, der diesen Blick kultiviert und entwickelt, entwickelt Zug um Zug ein Verfahren, in dem sich das Sehen und das Gesehenhaben in ein Zeigen verwandelt, in eine Demonstration. Das ist das Sichtbare an dieser wie vermutlich an jeder Kunst. Weniger sichtbar ist der Vorgang des Anschließens, die retrograde Bewegung, die sich in jeder Kunst, die ihren Namen zu Recht trägt, und so auch hier vollzieht. In dieser Hinsicht ist die Abfolge der Rüthschen Experimente, soweit ich sie überblicke, von einer liebenswerten Prägnanz: sie geht von den außer Dienst gestellten Gegenständen des Gebrauchs über handsortierte Fundstücke einer mehr oder minder als exotisch wahrgenommenen Natur weiter zur Erkundung des leeren Raums, den der Künstler um seine Objekte legt. Dieser Raum ist, rein technisch gesprochen, eine weiße Fläche, eine Ausstellungsfläche, nichts weiter. Die Verwandlung in einen Raum ist Zutat, Bewusstseinszutat, Verräumlichung. Sie verdankt sich allerdings keiner subjektiven, gewollten oder auch nur gewussten Anstrengung, sondern dem, was man normalerweise ›Sehgewohnheiten‹ nennt, obwohl gerade dieser Ausdruck angesichts des reinen Weiß, also der gezeigten Leere, eigentümlich ins Leere geht. Dass sich diese Leere gestalten lässt, ist das Auffällige an der nicht ohne Grund Kandinsky gewidmeten Serie Wegen K.
In seiner 1926 erschienenen (2002 wieder aufgelegten) Bauhausschrift Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente erläutert Kandinsky, wie sich mittels der Anordnung einfacher grafischer Elemente, also Punkt und Linie, eine Bildfläche dynamisch organisieren lässt. ›Dynamisch‹ bedeutet hier: die Fläche beginnt zum Betrachter ›zu sprechen‹, sie verwandelt sich in das, was ich soeben ›Bildraum‹ genannt habe, eine vollkommen imaginäre Größe, die stets aufgerufen wird, sobald ins Spiel kommt, was wir ein Bild nennen, sofern wir damit nicht ein einfaches Abbild oder einen Abdruck von etwas meinen, sondern das artifizielle Bild – ein Bild, das seinem Betrachter ›etwas sagt‹. Kandinsky zeigt – und seine Beispiele sind von lehrhafter Eindringlichkeit –, dass dieses Ansprechende keineswegs eine nicht weiter differenzierbare mystische Größe ist, sondern ein Spannungsgefüge, das an einfache, aber starke Affektlagen appelliert: da gibt es so aparte Größen wie jene »Hartnäckigkeit«, die sich durch pure Linienführung in eine »mühsame Spannung« zu verwandeln weiß, da gibt es die »warme« neben der »kalten Ruhe«, das »kampflose Verhältnis« des stumpfen Winkels zu seiner Umgebung usw. Nein, es ist nicht das Sujet, sagt uns Kandinsky, es ist die Anordnung einiger abstrakter Punkte und Linien auf einer Fläche, die darüber entscheidet, wo wir uns gerade befinden – in uns selbst, wo denn sonst. »Der Künstler«, so K., befruchtet diese Fläche, »und weiß, wie folgsam und ›beglückt‹ [sie] die richtigen Elemente in richtiger Ordnung aufnimmt.«
Sehen wir auf die Arrangements aus Stäben und Früchten, die ihre Gegenständlichkeit erst auf den zweiten Blick preisgeben, nachdem sie auf den ersten nichts weiter sind als präzise ausgeführte Kreise und Striche von schillernder Farbigkeit, dann verstehen wir unmittelbar, was dieses Wegen K. bedeutet, dessen Genealogie neben Kandinsky natürlich auch Kafka enthält. In dieser Serie fügt Rüth seiner Folge von Ergreifungen und Ergriffenheiten den leeren, aber von unsichtbaren Spannungen erfüllten imaginären Bildraum hinzu, wie er aus den von Kandinsky vorgeschlagenen Behandlungen der ›Grundfläche‹ zwanglos hervorgeht. Der Vordenker der abstrakten Kunst wusste, dass keine dieser Behandlungen harmlos ist, dass, wie er sagt, »eine leichtsinnige Behandlung dieses Wesens etwas vom Mord an sich hat.«
Etwas vom Mord... Das wiederum erinnert an Franz Kafka und all die Beschreibungen innerer Mordabwehrversuche, die wir ihm verdanken. Ich habe eine Weile über der Frage gegrübelt, ob nicht gerade davon einiges in diese Bilder übergegangen ist. Keineswegs durch künstlerischen Leichtsinn, Gott bewahre, eher durch Leichtigkeit. Ich sehe auf das stille Spiel dieser vollkommen graphisch gewordenen Früchte wie auf Szenen aus einem Gefängnis, in das sie ohne ihr Zutun, mit einem leichten Befremden geraten sind. Dieses Befremden merkt man ihnen an. Sie haben sich ein Stück weit abgefunden mit ihrem Schicksal, aber eben nur ein Stück weit, sie teilen das Los des dressierten Pudels, ohne an seinen Eitelkeiten teilzunehmen. Die Spannungen, unter denen sie stehen, sind uns menschlich vertraut, aber etwas hindert uns daran, sie auf direktem Wege zu benennen. Man müsste nachdenken, grübeln, eine Reise unternehmen, um mit sich ins Reine zu kommen, was uns, reiseerprobt, wie wir sind, nicht immer von Erfolg gekrönt scheint – das alles sind Aufwände, die man ein wenig scheut, wenn man durch eine Ausstellung geht, und sie sind ja auch eigentlich – dem Künstler sei Dank – nicht nötig.
Ausstellung
8. –15. März 2009
Ballhaus am Nordpark
Düsseldorf