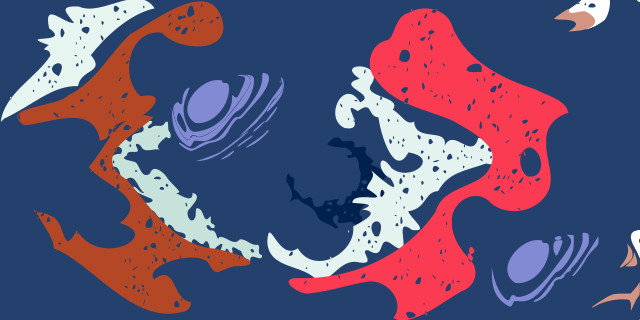von Ulrich Schödlbauer
14. Die ›reine‹ Beziehung und der Kinderwunsch
Untersucht man die im Beziehungsmodell sozial realisierte Trennung von Sexualität und Reproduktion, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass die rigorose Durchstreichung des zweifellos gegebenen, aber durch den Einsatz mechanischer und chemischer Mittel unbegrenzt manipulierbaren biologischen Zusammenhangs den kulturell zweifellos ebenso gegebenen Zusammenhang überblendet, in dem der Kinderwunsch als Summe aller auf ein individuelles Optimum ausgerichteten Steuerimpulse fungiert. Es ist nicht ganz richtig, zu sagen, der Kinderwunsch habe sich mit dem Abschied vom traditionellen Familienmodell ›reduziert‹ oder sei generell zurückgegangen. Angemessener wäre es wohl zu sagen, er werde durch das Beziehungsmodell dauerhaft aufgeschoben: jedenfalls entspricht dem eine in allen Befragungen wiederkehrende Auskunft der Frauen, während Männer häufig rigorosere Sprachregelungen bevorzugen. Seltsamerweise dient die Auskunft der Beruhigung der Gesellschaft – nach dem Motto ›aufgeschoben ist nicht aufgehoben‹ –, während die Daten eine etwas andere Sprache sprechen. Offenkundig besitzt der projektierte Aufschub eine rationale, durch Ausbildung und berufliche Orientierung der Frauen gegebene und allseits gewollte Seite. Aber ebenso offenkundig besitzt er eine andere, von den Akteuren nicht durchschaute und nicht gewollte Seite, auf der ›es‹ ihnen passiert – das Verfehlen des Kinderwunsches –, so wie es ihnen vor der Perfektionierung der Verhütungstechnik nach der anderen Richtung passierte – gemäß der dröhnenden Nachkriegsweisheit: Kinder kriegen die Leute von alleine. Der wahlweise auf die menschliche Natur oder eine psychische Disposition zurückgeführte Kinderwunsch ist von vornherein in Bedrängnis: die kompakte Rationalität der gesellschaftlich geforderten Entscheidung steht gegen die berufene, aber sprachlose und durchsetzungsschwache Natur, das aufgeklärte Interesse am internen Verrechnungssystem der Psyche gegen die naive Verwirklichungsabsicht in Bezug auf den ›gefassten‹ und sich geschmeidig anderen Fassungen des Begehrens anpassenden Wunsch. Dass eine so einflussstarke Institution wie die Katholische Kirche der angeblich bedrohten Natur auf die bekannte Weise beispringt, ist eher geeignet, die Opposition zu verschärfen statt aufzulösen, weil sie das naturalistische Scheinargument indirekt zementiert: Feindschaft, vor allem eine so gediegene wie die zwischen Naturalismus und Supranaturalismus, verbindet. Der Aufschub lässt sich insofern als eine respektable Weise begreifen, mit einem Dilemma umzugehen, dessen Auflösung unumgänglich, aber mit gegenwärtigen Mitteln nicht erreichbar erscheint.
Wenn das Beziehungsmodell die Gleichwertigkeit der privaten Lebensformen und die Freiheit des Einzelnen in Wahl und Gestaltung seiner Lebensverhältnisse sichert, wenn daher aus rechtlichen und sozialen Gründen keine Alternativen zu ihm in Sicht sind, es also nur darum gehen kann, seine Lebbarkeit auf Dauer zu stellen, dann bleibt keine andere Wahl als die, überall dort, wo die Reproduktion der Bevölkerung stockt, die Entgleisung in der besonderen Art und Weise zu suchen, wie es gelebt wird. Ein erster Schritt auf diesem Weg besteht darin, die durchgehende Tendenz zur Kinderlosigkeit und zur Ein-Kind-Beziehung nicht länger dem irreführenden Deutungsschema des ›verminderten Kinderwunsches‹ zu unterwerfen. Vielmehr hat man es, solange man sich auf der Ebene des Wunsches bewegt, mit tendenziell entgegengesetzten Impulsen zu tun. Wer sich kein Kind wünscht, wird schwerlich in der Ein-Kind-Beziehung die Realisierung dieses Wunsches erblicken, wer sich eines wünscht, dürfte die Kinderlosigkeit nicht als Erfüllung empfinden. Vorgängig ist im kinderlosen Fall der beiderseitige Wunsch, die Beziehung frei vom Druck irreversibler und materiell folgenreicher Entscheidungen zu halten, im Ein-Kind-Fall der Wunsch einer – in der Regel der weiblichen – Seite, den reversiblen Charakter der Beziehung mit dem erfüllten Kinderwunsch zu vereinbaren. Beide Male richtet sich die Entscheidung implizit gegen das Kind: das eine Mal gegen seine Existenz, das andere Mal gegen seine als bekannt vorausgesetzten Bedürfnisse. In keinem Fall wird ein spezifischer Kinderwunsch erkennbar, der gelebt würde; stattdessen dominiert die Absicht, die Beziehung rein zu halten von Deutungen und Abhängigkeiten, die durch das traditionelle Bedeutungsfeld ›Familie‹ aufgerufen werden. Selbstverständlich sind auch immer andere Hintergründe (medizinische, berufliche, finanzielle, ethische etc.) berufbar, doch bleiben sie für die Tendenz, um die es hier geht, bedeutungslos. Sub specie der biologischen Reproduktion entgleist die Beziehung am ehesten dort, wo sie am entschiedensten gegen vorgängige Formen des Beisammenseins abgegrenzt wird, wo sie als Alternative zum Herkommen, das durch das elterliche Lebensmodell oder durch Hörensagen diskreditiert erscheint, stilisiert und ›absolut‹ gesetzt wird. Der Umkehrschluss lautet, dass sie dort am erfolgreichsten praktiziert werden kann, wo sie gegenüber den herkömmlichen Erfahrungen und Praktiken offen bleibt, wo sie als Modifikation oder Modulation der familiären Melodie den Sinn für das, was möglich und an der Zeit ist, weiterträgt. Ob das geschieht, ist weniger eine Frage weltanschaulich motivierter Lebensentscheidungen als praktischer Lebensklugheit, gepaart mit Fairness und einer gehörigen Portion Gleichmut gegenüber den medialen Zumutungen der Lebenswelt. Gesellschaften, die als ganze an dieser Stelle eine gewisse Unfähigkeit verraten, müssen sich den Verdacht gefallen lassen, wirksame Blockaden zu unterhalten, die über bloß persönliche Abneigungen und Vorlieben hinaus die privaten Lebensstile beeinflussen. Es versteht sich von selbst, dass jede Theorie, die sich diesen Bereichen nähert, auf von Mutmaßungen umrankte Vorschläge angewiesen bleibt. Auf einer etwas allgemeineren Ebene mag das anders aussehen.
Die kulturelle Matrix hält einige Beschreibungsmuster bereit, die, jedes für sich und alle gemeinsam, helfen können, die zugespitzte Interpretation einer so allgemein gefassten Tendenz, die persönlichen Dinge zu ordnen, durch die bestimmte Gesellschaft zu verstehen. Der wirtschaftsanthropologische Vorschlag (Emmanuel Todd), die Differenz von ›Kern‹- und ›Stammfamilie‹ mit ihren unterschiedlichen Erbpräferenzen für den unterschiedlichen Erfolg einzelner Länder im ökonomischen System des Westens und, in umgekehrter Relation, für Erfolg und Misserfolg im Bereich der biologischen Reproduktion verantwortlich zu machen, hat mit dem hier vorgetragenen das Konzept der ›unsichtbaren Familie‹ gemein. Paradoxerweise enthält er selbst die Kulturrevolution der sechziger Jahre mitsamt dem folgenden Übergang von hohen zu niedrigen Geburtenraten als unsichtbare Größe: offenbar verträgt sich die mit dem Typus der Stammfamilie verbundene Weise des Wirtschaftens sowohl mit hohen wie mit niedrigen Reproduktionsraten. Es muss also etwas hinzukommen, etwa die oft kommentierte Neigung der Deutschen, abstrakte Konzepte – wie das der Beziehung – ›eins zu eins‹ umzusetzen, die allerdings als klassisches Element der Selbstbeschreibung den Nachteil hat, jeweils nur die Mitmenschen zu meinen und die eigene Lebensweise auszusparen. Ähnliches gilt für den angeblichen Hang zur negativen Selbstbeschreibung und zu Weltbeglückungsphantasien, in denen der Pferdefuß steckt – während die Beispiele ins Uferlose führen, beschränkt sich der Ertrag auf die allgemeine Feststellung: Da ist was dran. Handfester erscheint demgegenüber das Argument, das unvorhergesehene Altern der vorhergehenden Generation und das damit einhergehende lebenslängliche Nebeneinanderherleben im Modus der Ablehnung und des Widerspruchs habe den Spielraum der Lebensentscheidungen auf familiärem Feld für signifikante Bevölkerungsgruppen empfindlich eingeschnürt.
15. Lesarten der Abtreibungspraxis
Als eine halbwegs fassbare Größe im Spiel der gesellschaftlichen Wertungen kann die Abtreibungsstatistik gelten. 2005 wurden in Deutschland 124 023 Abtreibungen vorgenommen – eine angesichts der Gesamtheit der Geburten und der in den Zahlenspielen des Statistischen Bundesamtes gehandelten Zuwanderungsquoten verblüffend hohe, wenngleich in den letzten Jahren leicht gesunkene Zahl. Vergleicht man die Zahlen der aus medizinischen (3 177), kriminologischen (21) und anderen Gründen (120 825) vorgenommenen Schwangerschaftsabbrüche angesichts nahezu perfekter Verhütungsmethoden, dann darf die Abtreibungspraxis mit aller Vorsicht als ›objektiver‹ Indikator einer frenetischen Interpretation der in der Gesellschaft vorherrschenden Beziehungsformen gewertet werden. Im europäischen Vergleich wirken die deutsche Abtreibungsquote von 7,6 (Frankreich 16,2; Großbritannien 16,6; Russland 54,2; Schweiz 6,8) und das Verhältnis von Abtreibungen zu Geburten ›moderat‹. Der Aussagewert solcher flächendeckenden Angaben ist gering, solange regionale, soziale und ›kulturelle‹ Differenzen innerhalb der Bevölkerungen und zwischen den unterschiedlichen Landesteilen nicht berücksichtigt werden. Doch fällt auf, dass in Europa, anders als in den USA, das Gros der Abtreibungen in den mittleren Jahrgängen vorgenommen wird, das persönliche Recht auf Schwangerschaftsabbruch also vor der Notlage rangiert. Vor diesem Hintergrund gewinnt das Verhältnis von Geburtenrate und Abbrüchen ein anderes Aussehen: wer innerhalb der Null- oder Ein-Kind-Option abtreibt, verhält sich signifikant anders als jemand, bei dem die Begrenzung der Kinderzahl oder eugenische Gründe im Vordergrund stehen. Der Trend zur Abtreibung ohne Kinder bleibt unverständlich ohne die Annahme eines ›double-bind‹, in dem der persönliche Wille, ein Kind zu besitzen, von nicht oder nur schwer kontrollierbaren Faktoren durchkreuzt und schließlich unterbunden wird – ein Phänomen, nicht unähnlich dem Verhalten von Selbstmördern, die ›nur‹ die Aufmerksamkeit ihrer Umgebung erregen möchten und keinen Widerspruch darin sehen, sich gegen die reale Mordabsicht eines anderen mit allen Mitteln zur Wehr zu setzen.
Das ist eine schwerwiegende Annahme. Sie impliziert, dass die gesellschaftliche Lesart, die in dem genannten Verhalten eine Folge der Emanzipation erkennen möchte, durch eine ersetzt werden muss, in der die ›unemanzipierte‹ Befangenheit in gleichermaßen als lebensfeindlich empfundenen Schematismen obenansteht. Das wäre nichts Besonderes, bedenkt man die quengelige Larmoyanz in kurrenten Selbstbeschreibungen der Gesellschaft. Dem zum Abbruch führenden double-bind entspräche eine unemanzipierte Emanzipiertheit, die sich auch in anderen Bereichen gesellschaftlichen Handelns – und keineswegs nur im weiblichen Spektrum – finden lässt. Die Interpretation des Abtreibungsrechts als mein Recht, das mir die Verpflichtung auf ein bestimmtes Modell des Zusammenlebens auferlegt, weil ich sonst auf das mir zustehende Recht verzichten und einer unemanzipierten Version meiner Existenz den Vorzug geben würde, enthält eine starke Deutung des Rechts und speziell der Abtreibungsgesetzgebung. Offenkundig ist der Tatbestand ›Schwangerschaft‹ ausreichend, um bei einer statistisch erheblichen Anzahl von Personen eine Handlungskette in Gang zu setzen, in der reale Tötungen sich in symbolische Handlungen verwandeln, deren Zweck in der Teilhabe an einem bestimmten Lebensstil, also letztlich darin liegt, dazuzugehören. In gewisser Weise bringt die Beratungsklausel mit dem ihr immanenten Misstrauen gegen die Motive von Abtreibungswilligen, die durch die Fristenregelung angelockt werden, diese Deutung der Abtreibungspraxis offen zum Ausdruck - kein Wunder, dass sie bei Personen, die sich über die Validität ihrer Motive im Klaren sind, ebenso auf Ablehnung stößt wie bei solchen, die sie bewusst oder unbewusst verschleiern. Die Beratungsregelung formuliert das zum Gesetz erhobene und durch die gesellschaftliche Praxis erhärtete Misstrauen des Staates gegen die Fähigkeit seiner Bürger, von den Bestimmungen des Abtreibungsrechts adäquaten, soll heißen der freien Erwägung der zu bedenkenden Umstände Raum gebenden Gebrauch zu machen.
Die Abtreibungspraxis ist geeignet, das Dunkel um die im Kinderverzicht wirksamen Momente ein Stückweit zu erhellen, weil sie, anders als die Empfängnisverhütung, eine gewaltsame und als außerordentlich schwerwiegend empfundene Weise darstellt, die Teilnahme am gesellschaftlichen Spiel durch physische Manipulation sicherzustellen. Sie ist nicht allein Gegenstand von Interpretationen, sondern selbst eine Interpretation von Gesellschaft – eine, die das im Beziehungsleben gegebene Rollenspiel wichtig genug nimmt, um andere personkonstitutive Faktoren, darunter die ethische Frage nach dem Sinn und der Rechtfertigung des Tötens, in nachgeordnete, sub specie der primären Entscheidungen zu behandelnde Elemente zu verwandeln. Innerhalb dieser in wiederkehrenden Handlungsmustern manifest werdenden Interpretation fungiert der ›eigene Körper‹ als Einsatz, ähnlich wie das Militär es vom Leben seiner Soldaten erwartet. Im gleichen Sinn ist auch die ›ritualisierte‹, gerichtsnotorische Trennungspraxis, in der vorhandene Kinder als Waffe im Geschlechterkampf eingesetzt werden, Interpretation, die zeigt, dass real eingegangene und durch keine einfache Manipulation zurücknehmbare Verpflichtungen tendenziell keine Präferenzumkehr bewirken. Wie weit die unter Alleinerziehenden verbreitete Praxis, Kinder langfristig an den eigenen Haushalt zu binden und mit ihnen Ersatzpartnerschaften einzugehen, demselben Modell entspringen oder zu den untauglichen Mitteln gerechnet werden müssen, es zu korrigieren, kann wohl nur von Fall zu Fall entschieden werden.
16. Erinnerungskultur und Geschlechterkampf
Die Deutung des Rechts als Waffe im emanzipatorischen Kampf und ihre rituelle Verfestigung im Zuge der Durchsetzung des Beziehungsmodells stellt letzteres als institutionalisierte Interpretation des Geschlechterkampfs neben die Erinnerungskultur als institutionalisierte Interpretation des Kampfs der Generationen. Als ›lange‹ historische Ereignislinien produzieren Geschlechter- und Generationenkampf Auseinandersetzungen geringer Intensität, deren reale und nicht immer erbauliche Folgen von der Privatsphäre abgefedert werden. Dem Individuum steht es frei, sich zu verhalten: ob es sich kopfüber in die anstehenden Kämpfe stürzt oder die Freiheit eines aus persönlicher Wahl hervorgehenden zivilen Umgangs bevorzugt, wird ihm von keiner Instanz zwingend vorgeschrieben. Die im Medium der Interpretation verfestigten Kulturen des öffentlichen und privaten Miteinander lassen beide Möglichkeiten zu. Es bedarf des unsichtbaren Dritten, um den Stil der Auseinandersetzungen zu verschärfen und die kämpferische Interpretation des Generationen- und Geschlechterverhältnisses im Alltag überwiegen zu lassen. Die seit den sechziger Jahren schwelende, in die Altenheime und Sterbezimmer hinein verlängerte Friedlosigkeit zwischen den dominanten Generationen der ›Verlierernation‹ ist ein hinreichend aussichtsreicher Kandidat für diese Figur des unsichtbaren Dritten, um genauer in Augenschein genommen zu werden.
Anders als die Erinnerungskultur, die aus dem Generationenkonflikt hervorgegangen ist und ihn, wie immer verstellt, nachdrücklich genug thematisiert hat, um partielle Friedensschlüsse und jenen historischen Kompromiss zu ermöglichen, in dem – fast – alle Erinnerungen zugelassen sind, sofern sie das Reputationssystem stützen, ist das Beziehungsmodell per se gedächtnislos und lenkt die Energien der in ihm verbundenen – und durch es separierten – Personen in demonstrativen Akten gegeneinander. Ein populärer Ausdruck wie ›Mehrgenerationenhölle‹ für den durch die familiäre Herkunft gegebenen und durch keine Handlungen oder Willenserklärungen aufzulösenden Generationenverbund kann als mehr oder weniger drastischer Ausdruck dafür durchgehen, dass der Abschied vom ›Familienmodell‹ des Zusammenlebens im Beziehungsmodell auf Dauer gestellt ist, weil die Alternative nur im Imaginarium der Interpretation existiert. Historisch gesehen bestreichen die signifikant niedrigen Geburtenraten die aktive Lebenszeit weniger, mit Krieg und Nachkrieg aus kindlicher Perspektive vertrauter Jahrgänge und der nach dem Krieg geborenen, die kulturelle Revolution der Sechziger vor den heimischen Fernsehern und in den Klassenzimmern nachspielenden Generation, für die die Niederlage, das Schibboleth in den Auseinandersetzungen der Achtundsechziger mit der Vätergeneration, bereits keine greifbare Realität mehr besaß. Dem blinden Ausagieren eines unbegriffenen, aber in beträchtlicher Härte inszenierten Generationenkonflikts bot und bietet das kämpferisch gegen die familiäre Herkunft gesetzte Beziehungsmodell eine optimale Plattform. Seine sukzessive Verrechtlichung darf mit einiger Berechtigung als Bereitstellung des Terrains gelten, auf dem diese politisch eher parasitäre Generation ihre zentralen Lebensentwürfe erfand und konfliktreich ausagierte.
Und es geht weiter: fragt man sich, was öffentliche Erinnerungskultur und private Beziehungskultur miteinander verbindet, so sieht man sich auf Lücken der Erinnerungskultur verwiesen, von denen man einige erst im letzten Jahrzehnt zu schließen begonnen hat. Einige dieser Lücken – Bombenkrieg, Flucht, Umsiedlung, Vergewaltigungen etc. – sind nicht zufällig oder auf Grund eines im Nachhinein unverständlichen Schweigens der Zeugen, sondern aus ethisch-funktionalen Gründen in den sechziger Jahren entstanden. Sie sparen aber, lange Zeit unbeachtet, just den – vornehmlich weiblichen – Erinnerungsraum aus, in dem sich viele Gründe für die Feinjustierung der Geschlechterbeziehung in der Elterngeneration hätten finden lassen. An Ingeborg Bachmanns 1971 erschienenem Roman Malina ließ sich früh ablesen, welche Wirkung der gleichsam erschreckte Blick durch die Finger auf Krieg und Nachkrieg selbst dann entfalten kann, wenn er nur wenig geschichtliches Wissen transportiert. Das dem Entsetzen über die im Imaginationsraum abrufbaren väterlichen Grausamkeiten und das aus dem familiären Schweigen sich lösende Gorgonenhaupt des absoluten Verbrechens geschuldete, gleichwohl interessegeleitete und inszenierte Von-Anderem-Reden im öffentlichen Raum ist in der vieles falsch oder missverständlich interpretierenden Sprachlosigkeit im privaten Raum mit enthalten. Die durchgestrichene Wahrnehmung der elterlichen Existenz, diese in vielen Bereichen wiederkehrende Figur, bestimmt die Eigenwahrnehmung und die Solidaritäten. Mit ihrem nach familiären Maßstäben leeren und gerade darin einer Utopie des gemeinsamen Lebens verpflichteten Beziehungsleben zahlen die Deutschen der ›zweiten Generation‹ für den Nachkriegsaufstieg, der nicht ihr Werk ist, und das Geschehene, das, dank verbesserter medizinischer und finanzieller Versorgung der Älteren, in ihrem lebenslänglichen Unfrieden mit sich selbst erstarrte Präsenz besitzt.
17. Vom Danachkommen
Nach 1989 geriet die Erinnerungskultur von zwei Seiten unter Druck. Das doppelte Erbe der DDR und das historische Deutungsbegehren, das aus den Biographien der nach 1989 aus den Ländern Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion zugewanderten Deutschen sprach, mündeten in eine verdeckte Konfrontation der Interpretationen, die sich in der Alltagssprache einen festen Platz erobert hat und in Entgleisungen der Politik wie der Ausweisung von ›no-go-areas‹ für Ausländer nach irakischem Vorbild in den neuen Bundesländern für Befremden sorgt. Angesichts der legitimierenden Funktion der Erinnerungskultur für das Gemeinwesen sind das ernste Prozesse, in deren Verlauf einerseits der Richtungssinn, andererseits die integrative Kraft der Institution ins Gerede gekommen ist. Negativ gesprochen hieße das: die neue Erinnerungskultur präsentiert sich gleichermaßen richtungslos und autoritär im Zulassen und Verwerfen von Erinnerungen. Ob man darin neue legitimierende Kämpfe oder die Anfänge eines unaufhaltsamen Delegitimisierungsprozesses sieht, an dessen Ende die notgedrungene Restituierung der Nation steht, ist gegenwärtig eine Frage der politischen Optik.
Der rasch zunehmende Anteil von Personen mit fremd- oder gemischtkulturellem Hintergrund an der Gesamtbevölkerung wirft weitergehende Fragen auf. Das nationale Erinnerungsmodell macht dieser Personenguppe kein besonders attraktives Identifikations- und Integrationsangebot. Das ist, aufs gesellschaftliche Ganze gesehen, vielleicht nicht besonders wichtig, solange Migration vor allem als Fluktuation (mit Anpassungen an die konjunkturelle Arbeitsmarktsituation) oder als Elendsmigration verstanden wird: in beiden Fällen steht das gefestigte Selbstverständnis des reichen Landes im Zentrum, das den ›Fremden‹ seine Arbeitsplätze und sozialen Sicherungssysteme zur partiellen Nutzung überlässt und ihnen freistellt, ob sie sich integrieren möchten oder nicht. Die Überprüfung des Schulsystems hat gezeigt, dass diese Deutung bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt beträchtliche Wahrnehmungslücken enthält. Und die vom amerikanischen Kampf gegen den Terror produzierten Schlagzeilen haben dem Begriff des ›inneren Friedens‹ eine religiös-kulturelle Note wiedergegeben, die Historikern vertraut ist, eine laizistische Politik aber gern dauerhaft von ihm ferngehalten hätte. Vor allem belehrt die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung darüber, dass diese saturierte Sicht der Dinge obsolet ist.
Einer gängigen Auffassung nach wäre es ›jetzt‹ an der Zeit, von Fluktuation auf Integration ›umzuschalten‹. Was daran politisch machbar ist, sollte die Wahrnehmung limitierender Faktoren und die Reflexion auf kulturelle Gegebenheiten, die dem Machen leicht eine andere als die vorgedachte Richtung geben, nicht beeinträchtigen. Wenn Integration zu den Aufgaben eines jeden Gemeinwesens zählt, die es unter anderem durch Statuszuweisungen (darunter die des Gastes, Flüchtlings etc.) löst – oder zu lösen versucht –, dann scheint diese Rede wenig ergiebig zu sein, wenn es darum geht, die besondere Problemlage eines Landes zu beschreiben, das sich aus Mangel an Nachkommenschaft am Weltmarkt für Migrationswillige zu bedienen wünscht. Ein Stück näher kommt man ihr, wenn man zwei limitierende Faktoren in die Überlegungen einbezieht.
– Es ist keine politische Definitions- oder Willensfrage, ob ein Land mit nationalstaatlichen Institutionen, zu denen die Organe und Mechanismen der politischen Willensbildung, das nationale ›Gedächtnis‹, die Selbst- und Fremdwahrnehmung des ›Landes‹ und seiner Grenzen, die Funktion der Landessprache, der religiöse, literarische und kulturelle Fundus und schließlich der sich in einer Fülle kleiner und kleinster Alltagshandlungen und -reden bezeugende Wille der ›überwältigenden‹ Bevölkerungsmehrheit zählen, als Einwanderungsland gilt. Soll das Wort nicht als weitgehend leerer Problemlöser durchgehen, so setzt es einen Mix von Herkunftsgeschichten seiner Bewohner voraus, in dem das Motiv der Einwanderung dominiert. Länder wie Deutschland sind Zuzugs-, nicht Einwanderungsländer: im Geschichtenmix ihrer Bewohner überwiegt das – regional, genealogisch oder kulturell interpretierte – sesshafte Motiv, das durch Sondergeschichten mit eigenkulturellem Hintergrund ergänzt und angereichert wird. Insofern nimmt es nicht Wunder, dass Journalisten auf Wörter wie ›Völkerwanderung‹ und ›Landnahme‹ verfallen, wenn sie die kommenden Umwälzungen bildhaft zu benennen versuchen – Vokabeln, die im europäischen Kontext Auflösungs- und Untergangsphantasien, aber keine realistischen Optionen bezeichnen.
– ›Einwanderung‹ ist unter den heute herrschenden kommunikations- und verkehrstechnischen Bedingungen ein in staatsmännischer Absicht gepflegter Euphemismus. Der Vorgang, für den das Wort steht, ist charakterisiert durch räumliche und zeitliche Trennung, Irreversibilität, partielle oder totale Kommunikationsabbrüche, soziale und kulturelle Entfremdung und – im Fall des Gelingens – erneute ›Akkulturation‹. Diese Faktoren sind zwar nicht vollständig aus dem Migrationsfeld verschwunden, aber ihr Wandel hat das spezifische Gewicht des Vorgangs so weit verändert, dass es erlaubt ist zu sagen: tendenziell findet Einwanderung, jedenfalls in den entwickelten Ländern, nicht mehr statt. Die zeit- und raumlose globale Kommunikation, die massenmediale Präsenz der Herkunfts- in den Aufnahmeländern, die Entwicklung des Flugzeugs zum planetarischen Massentransportmittel und der sozioökomische Wandel, der eine weitgehend berührungsfreie Koexistenz mit der ›einheimischen‹ Bevölkerung über Generationen hinweg erlaubt, lassen das Gemeinte – und Erhoffte – zu wenig mehr als einer historischen Reminiszenz schrumpfen.
Mit der gegründeten Aussicht darauf, dass die Bevölkerungsanteile in den Aufnahmeländern sich durch Zuzüge signifikant verschieben, bis hier und da Mehrheiten sich in Minderheiten verkehren, verwandelt sich das Bevölkerungsproblem in ein Definitionsproblem der besonderen Art: wer die Macht besitzt, den zu erhaltenden Kernbestand des Ausgangssystems zu definieren, entscheidet indirekt darüber, welches Volk man ein paar Jahrzehnte später in den jeweiligen Landesgrenzen antreffen wird. Das existierende Volk, sofern es in diesem Prozess eher kommentierend in Erscheinung tritt, reagiert gespalten: einerseits ist ihm elementar an der Aufrechterhaltung der Prosperität gelegen, die es für einen Ausfluss des gegenwärtigen Systems hält, andererseits möchte es seine Position im zu erwartenden Verteilungspotpourri gewahrt wissen, gleichgültig ob es um sozialen Status, Straßenbilder, Wohngewohnheiten oder den informellen Zusammenhalt der Gesellschaft geht. Nüchtern formuliert: es wird zum Befürworter von Zuwanderungen, die es ablehnt, sobald sie mit realen Verschiebungen im Lebensstil und in den Machtverhältnissen einhergehen.
Das Dilemma schmeckt ein wenig nach Brechts bekanntem Ratschlag an die Regierenden: »Wäre es da / Nicht doch einfacher, die Regierung / Löste das Volk auf und / Wählte ein anderes?« Immerhin erscheint er unter den gegebenen Bedingungen im Kern realistischer als der Versuch, Ausländer über das Erinnerungsparadigma in die Gesellschaft zu integrieren, indem man ihnen den potentiellen Opferstatus vor dem Hintergrund der Aktivitäten neonazistischer Schlägertrupps anbietet. Die Europäisierung der Erinnerungskultur, darunter ihre Anreicherung um den Kolonialdiskurs, die die Relationen von Erinnern und Erforschen, Vergessen und Gedenken neu sortiert, stellt Integrationsmuster bereit, deren Annahme bereits die Ablehnung inhärent ist. In den Ländern der ehemaligen Kolonialherren füttert die kritische Konservierung der rassistischen Topoi das bekannte System, ein bereits vorhandenes, angesichts seiner abweichenden Geburtenraten argwöhnisch beäugtes Bevölkerungspotential mit individuellen Aufstiegschancen auszustatten und zugleich am unteren Ende der sozialen Skala zu fixieren. Europa wird die Probleme der Deutschen nicht lösen, es wird aber erwarten, dass die Deutschen sie lösen, statt es ein weiteres Mal in die drohenden Schatten der incertitudes allemandes zu tauchen. Den Deutschen wäre eine etwas freiere Sicht darauf zu gönnen, dass keine alternativlos fordernde Moderne, eher schon das unvollendete Verständnis einer als Zukunft maskierten Vergangenheit für gewisse generationsspezifische, aber mit der Tendenz zur Fortschreibung behaftete Blockaden verantwortlich ist. Die vergleichbare Lage von Ländern wie Italien, Japan, Südkorea oder Russland erscheint in dieser Perspektive als vergleichbar spezifische, die ein analoges, die jeweils gültige historisch-kulturelle Konstellation zu Rate ziehendes Verstehen der wirksamen Parameter verlangt.
– Ende –
Teil 1: Demographischer Wandel: Der große Übergang (1)
Teil 2: Demographischer Wandel: Der große Übergang (2)
Teil 3: Demographischer Wandel: Der große Übergang (3)
Teil 4: Demographischer Wandel: Der große Übergang (4)