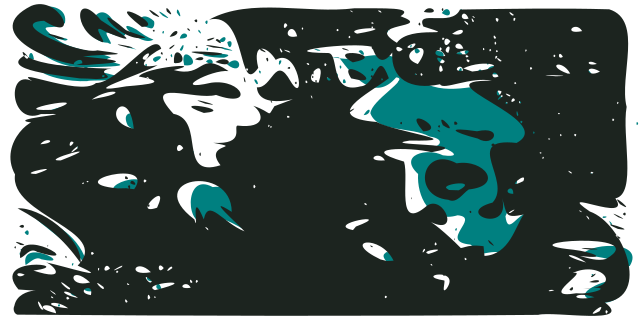von Stephan Hilsberg
1. Ich denke immer, dass man sich die Schuhe, die einem hingehalten werden, nicht anziehen muss. Wenn Dich also andere zu Ostdeutschen machen, bist Du das noch lange nicht. Ich lass mir doch von anderen nicht sagen, was ich bin. Das entscheide ich schon selbst.
2. Ich selbst empfinde mich als Ostdeutscher, und ich bin gleichzeitig mehr. Ich bin auch Deutscher, ich fühle mich als Europäer, ich bin einfach ein Mensch, und ich bin ein Geschöpf Gottes. Das sind gleich mehrere Identitäten. Sie widersprechen sich nicht. Sie bestehen nebeneinander her. Manche entdeckte ich erst sehr spät. Meine Identität als Deutscher bspw. wurde mir bei meiner ersten Westreise 1986 nach Westberlin bewusst. Als Ostdeutscher empfinde ich mich, seit die DDR keine Rolle mehr spielt. Sie hat mich immer zum DDR-Bürger gemacht. Das war ich in gewissem Sinne auch. Allerdings nicht in dem positiven Sinne, wie es dieser Begriff, der ja in erster Linie von der SED und zwar mit einer positiven Wertung, etwa: ›Ich bin stolz ein DDR-Bürger zu sein‹ verwendet wurde. Stolz war ich nicht. DDR-Bürger war ich trotzdem. Und eine DDR-Sozialisation habe ich auf alle Fälle. Die kann ich ja nicht abstreifen. Diesen Konflikt habe ich mit meiner ostdeutschen Identität nicht. Darunter verstehe ich meine ostdeutsche Herkunft, meine Geschichte als Ostdeutscher, meine ostdeutschen Prägungen und Erfahrungen. Auch die kann ich nicht abstreifen. Ich kann durchaus stolz auf diese ›ostdeutsche‹ Identität sein. Ob man sich unvoreingenommen zu seiner ostdeutschen Identität bekennen kann, hängt vielleicht davon ab, ob man den Frieden mit seiner eigenen Geschichte machen kann.
3. Ich persönlich habe, wie viele andere auch, das hohe Wahlergebnis der AfD in der letzten Bundestagswahl als bedrohlich empfunden, und als Schande. Und dann habe ich meine Witze darüber gemacht, um das irgendwie zu verarbeiten. Die Häme über die hohen Wahlergebnisse der AfD in Ostdeutschland, die in der Tat hier besser abgeschnitten hat als im Westen Deutschlands, kann man ertragen, wenn man sie nicht persönlich nimmt. Diese Häme beleidigt ja nicht. Dahinter steckt doch kein Rassismus. Wie gesagt, ich muss mir die Schuhe nicht anziehen, die mir von anderen hingehalten werden. Und wenn ich das kann, brauche ich auch nicht mehr sauer zu sein. Dann kann ich diese Häme und Zuschreibung als das begreifen, was es im Kern ist, Sorge um die politische Zukunft Deutschlands. Und dann kann ich darüber reden. Im Kern wird also die Häme gegenüber Ostdeutschland zu der Frage, was eigentlich die AfD ist, und wie man damit umgehen kann.
4. Darüber lohnt das Nachdenken auf jeden Fall. Für mich ist die AfD Ausdruck einer Schieflage, in die unsere Gesellschaft hineingeraten ist. Ein Stück weit ist die AfD Symptom für eine Fehlstelle in der Innenpolitik der letzten 30 Jahre, gegenüber den Herausforderungen einer sich auf Grund vermehrter Zuwanderung insbesondere muslimischer Mitbürger nach Deutschland verändernden Gesellschaft, die gelegentlich bedrohliche Formen angenommen hat. Das Verhängnissvolle an der gesellschaftlichen Debatte über diese Zuwanderung war ihre rein positive Rezeption nach dem Muster, Deutschland wird bunter, vielfältiger, interessanter und lebenswerter. Das mag für manche so sein. Für viele andere war und ist sie es aber nicht. Die fühlten und fühlen, wie ihre Wohnviertel kippten, wie ihre Kinder in der Schule gemobbt wurden, wie neue Konkurrenz am Arbeitsplatz entstand, und wie sie im Alltag plötzlich von neuen Aggressionen, die vorher nicht da waren, herausgefordert wurden. Doch wenn sie das als Sorgenpunkt und als Quelle von Angst zur Sprache brachten, sahen sie sich plötzlich als Rassisten disqualifiziert. Sie sahen sich mit einem Tabu konfrontiert, das sie zwang, den Mund zu halten. Dadurch entstanden politische Freiräume, in denen sich Parallellgesellschaften etablieren konnten, ohne dass die Gefahren, die damit einhergingen, wirklich öffentlich besprochen worden.
5. Die AfD hat dieses Thema aufgenommen. Aber sie beantwortet die Herausforderungen dieser muslimischen Zuwanderung mit altem Denken. Sie glaubt, wenn man endlich eine Politik zur ›Verteidigung‹ der Deutschen mache, dann ließe sich das Problem der Ausländer lösen. Bei PEGIDA ist dieser Ansatz sogar in den Namen mit aufgenommen worden. Dieses alte Denken, dieses Denken in Gegensätzen ›Deutsche‹ hier und ›Ausländer‹ dort, aber taugt auch nicht zur Lösung der Konflikte. Es ist ein Rückfall in nationalistisches Denken und birgt in der Tat die Gefahr eines neuen Rassismus in sich. Sorgen muss man sich auch um die Folgen dieses neuen Nationalismus machen, in Bezug auf viele andere politische Themen, bei denen die AfD als Bundestagspartei jetzt ihren Einfluss entfalten wird. Da stehen Europa, die europäische Friedensordnung, unser Integrationsprojekt an erster Stelle. Das einzig Produktive der AfD besteht darin, das Thema der innergesellschaftlichen Konflikte auf Grund der muslismischen Einwanderungstendenzen überhaupt wieder in das Zentrum unserer öffentlichen Debatten zu bringen.
6. Man kann das Thema nicht alleine bei einer einzelnen Partei abladen. Wir sind hier alle gefordert, bis hinein in den Alltag, auf der Straße. Institutionen wie Schule, Polizei, Justiz und Arbeitsämter sind hier besonders gefordert. Es ist die Aufgabe unserer Regierungen, sie mit den notwendigen Mitteln auszustatten. Es ist Aufgabe unserer Parteien, sich mit den Folgen auseinanderzusetzen, und politische Strategien zu entwickeln, und in Gesetze zu gießen. Dabei dürfen unsere Werte, wie Toleranz, Pluralität und Freiheit nicht über Bord gehen. Doch andererseits darf man nicht am Rechtsstaat rütteln, am staatlichen Gewaltmonopol, und an den Sicherheitsstandards für die Bürger, die sich die Bundesrepublik aufgebaut hat. Leider gibt es solche Tendenzen. Das ist Öl ins Feuer der AfD.
7. Dass die AfD in Ostdeutschland so hohe Wahlerfolge eingefahren hat, mag damit zusammenhängen, dass der Anteil der Ostdeutschen, die die Zuwanderungstendenzen als Bedrohung wahrnehmen, höher ist, als der entsprechende Anteil in den alten Bundesländern. Die Frage ist, warum ist das so? Nun, die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland ist in der Tat fragiler, als in Westdeutschland. Der Aufholprozess ist zum Stoppen gekommen, die Einkommen sind niedriger, die Perspektiven schlechter. Viele Ostdeutsche empfinden sich deshalb als Deutsche zweiter Klasse. Niemand thematisiert das. Nirgendwo finden Debatten statt, wie man das ändern, wie man neue Dynamik in den wirtschaftlichen Wachstumsprozess Ostdeutschlands kriegen könnte. Die ostdeutschen Politiker schweigen sich dazu aus. Wenn jemand es einmal thematisiert, wie letztlich die letzte Ostdeutschland-Beauftragte, Iris Gleicke, erntet er Ignoranz oder Empörung.
8. Wenn sich viele Ostdeutsche aus diesen Gründen als Deutsche zweiter Klasse empfinden, dann ist klar, dass diese Haltung schnell bei den Ausländern abgeladen werden kann. Das hängt mit der menschlichen Tendenz zusammen, immer noch jemanden zu brauchen, der unter einem steht, damit man sich selbst nicht so schlecht fühlt. Diese Haltung hat früher zu Antisemitismus geführt. Heute mündet sie in eine Art neuen Rassismus.
9. Es geht hier um viel mehr, als nur um die Diskriminierung der Ostdeutschen. Die Zukunft unserer Gesellschaft insgesamt steht auf dem Spiel. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die das Kind mit dem Bade ausschütten wollen. Für mich gehören die Ausländer, die hier leben mit zu Deutschland hinzu. Lösungen für eine friedliche Gesellschaft, in der sich alle entwickeln können, kann es nur gemeinsam geben. Genau das ist die Schieflage im Beitrag von Klaus Rüdiger Mai. Er beantwortet die Vorwürfe an die Ostdeutschen mit einem spezifisch ostdeutschen Eingeschnapptsein. Er denkt in der Tat noch in ostdeutschen Kategorien. Vielleicht hat er gar nicht begriffen, was wirklich dahinter steckt.