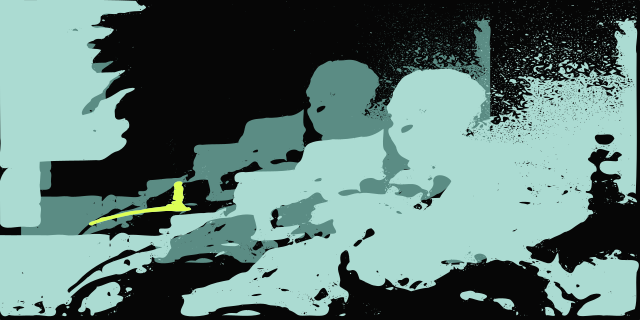von Siegmar Faust
Als Vatl mit seiner Kaufmannslehre fertig war, wurde er sofort eingezogen und war mit seinen 19 Jahren einer der Jüngsten in seiner ihm zugeteilten Landser-Kompanie. Er kam in russische Gefangenschaft, überlebte und kam auch mit leichten Verletzungen an der Schulter bald wieder frei. Belastet als Nazi konnte er keinesfalls sein, denn er arbeitete, ohne einer Partei anzugehören, bald im Finanzamt des Bezirkes Dresden, was im Westen einer mittleren Beamtenlaufbahn entsprochen hätte. Doch in der »DDR« gab es keine Beamten, nur Angestellte.
Im Jahr 1953 geschah jedoch zweimal etwas Eigenartiges. Im März 1953 war ich noch acht Jahre alt. Ich war öfters bei meinem Hausfreund Hagen Milde zum Spielen. Er war zwei Jahre jünger als ich und wohnte bei seinen Eltern und mit zwei jüngeren Brüdern eine Etage unter uns. Es muss ein Sonntag gewesen sein, denn Hagens Vater, der Steinmetz Manfred Milde, war ebenfalls zu Hause. Dann klingelte es und unser kleinwüchsiger Nachbar Walter Brendel, der Kino-Direktor, mit dem mein Vatl Skat oder Doppelkopf spielte, kam herein und fiel dem muskulösen Manfred um den Hals:
»Weißt du schon? ... Stalin...«
Er schluchzte:
»Väterchen Stalin...«
Beiden Männern flossen die Tränen. Sie konnten es nicht fassen. Ihr Gott Stalin hatte das Zeitliche gesegnet. Wir Jungs standen fassungslos daneben. Noch nie hatten wir Männer weinen gesehen. Beide waren die einzigen SED-Genossen im Haus. Ihr Gott war nun gestorben, einfach so, ohne Vorankündigung. Väterchen Stalin, der Generalissimo, der »große Freund des deutschen Volkes«, der »weise Führer aller Völker«, der »größte Mensch unserer Epoche«, wie der damalige Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und Stalinist Walter Ulbricht (1893-1973) meinte. Doch für den Staatsdichter Johannes R. Becher (1891-1958) war Stalin (1878-1953) gar der »Ewig-Lebende«. Der kurz darauf zum ersten Kulturminister der »DDR« aufgestiegene Dichter der »DDR«-Nationalhymne prahlte nun in großer Geste:
Lenin Stalin sind Glücksunendlichkeit.
Begleitet Stalin vor die rote Mauer!
Erhebt euch in der Größe eurer Trauer!
Seht! Über Stalins Grab die Taube kreist.
Denn Stalin: Freiheit – Stalin: Frieden heißt!
Und aller Ruhm der Welt wird Stalin heißen!
Lasst uns den Ewig-Lebenden lobpreisen!
(Aus: »Neues Deutschland«, 7. März 1953, S. 3)
Der Dichter Johannes Bobrowski (1917-1965), den ich erst viel später mit seiner hintergründigen und auch humorvollen Weise wahrnahm, als er sowohl im Westen wie im Osten schon bekannt war, schrieb über Becher:
Dies ist der größte Dichter, so redet und schreibt man. Ich stimme immer damit überein, er ist der größte, gewiss; nämlich der größte tote Dichter bei Lebzeiten, einer den niemand hörte und las –, aber er lebte und schrieb.
Selbst dieser Stalinist Becher hatte eine Wandlung durchgemacht, die für »DDR«-Bewohner jedoch erst 1988 ersichtlich wurde, nachdem in einer Ergänzung zu seiner Schrift »Das poetische Prinzip« herauskam, dass er den Sozialismus als »Grundirrtum« seines Lebens erkannt hatte. Nachdem er im Oktober 1958 verstorben war, erklärte ihn der Diktator Walter Ulbricht zum »größten deutschen Dichter der neuesten Zeit«. Bechers letzter Wille in seinem Testament, man »möge die Öffentlichkeit nicht mit Gedenkfeiern langweilen« und von »offiziellen Ehrungen« und »Schaftelhubereien« Abstand nehmen, wurde mit einem der opulentesten Staatsbegräbnisse der »DDR« beantwortet. Dass ich 1967/68 am Institut für Literatur »Johannes R. Becher«, das 1955 in Leipzig nach dem Vorbild des Moskauer Gorki-Instituts gegründet worden war und ein Jahr nach Bechers Tod nach ihm benannt wurde, selber schon gegen meinen eigenen Willen meine innere politische Wandlung einleiten konnte, kann nur ein Zufall sein – oder?
Als ich dann aus der Wohnung von Mildens zu meinen Eltern hoch lief, erlebte ich das Kontrastprogramm. Sie waren gut gelaunt. Freuten sie sich etwa, dass Stalin, dessen Porträt auch in unserem Klassenzimmer hing, gestorben war? »Gott sei Dank!« entfleuchte es meiner Mutter, als ich Stalin erwähnte. Vatl guckte sie streng an. Sie schaltete einen Westsender an, der keine Trauermusik brachte, sondern fröhliche Tanzmusik. Sie konnten sich wegen mir nur verhalten über den Tod des »Ewig-Lebenden« freuen. Ich sollte es nicht mitbekommen, damit ich sie nicht in der Schule verraten könnte in meiner grenzenlosen Naivität, denn das konnte noch immer heißen: »Ab nach Sibirien!« Die brisanten Schlüsselworte meiner Kindheit hießen demzufolge: »Abgeholt« und »Abgehauen«.
Am 17. Juni desselben Jahres stromerte ich wieder einmal mit Schulfreunden wie Gotti, Mischa, Stoppi oder Hartmut an der Elbe herum, zumeist dort, wo die Müglitz, von uns Mingatsch genannt, in die Elbe mündete. Als ich zurückkam, meistens mit schlechtem Gewissen, weil es schon später als erlaubt war, standen vor dem Rathaus ungewöhnlich viele Einwohner und hörten aufgeregt aufgeregten Rednern zu. Ich drängte mich durch die Massen auf dem Rathausvorplatz, dann noch 150 Meter durch die Bahnhofstraße. Ich hastete die Treppen hoch, Muttl öffnete die Tür, Vatl drehte schnell das Radio aus. Sie sahen zwar äußerst besorgt aus, aber beachteten mich kaum. Sie schimpften gar nicht, obwohl ich doch fast eine Stunde zu spät zu Hause angekommen war. Haben sie wieder RIAS gehört? Das war der Sender im amerikanischen Sektor, wie ich später erfuhr, da uns in der Schule beigebracht wurde, dass dieser böse Rundfunksender ein Hetzsender der amerikanischen Imperialisten war.
Am nächsten Tag, das war ein Donnerstag, hingen überall in Heidenau Plakate herum mit der Überschrift »Befehl!« Darauf wurde von der sowjetischen Besatzungsmacht der Ausnahmezustand verhängt. Es war verboten nach 18 Uhr die Häuser zu verlassen. Am Tag durften nicht mehr als drei Personen in Gruppen auf den Straßen anzutreffen sein. Wir standen zu viert vor dem Plakat, als wir Vatl gegen 17 Uhr vom Bahnhof abgeholt hatten. Dort sah ich zwei sowjetische Panzer, überhaupt das erste Mal Panzer in meinem Leben. Ich konnte mit meinen achteinhalb Jahren bereits bis vier zählen und guckte Vatl besorgt an. Er nahm Gabi auf den Arm und sagte:
»Ihr seid ja noch keine Personen.«
Ich wollte protestieren, aber mehr interessierten mich die Panzer, doch Muttl zog mich am Arm nach Hause. Ein Arbeitskollege meines Vaters, der auch in Heidenau wohnte und ebenfalls zwei Kinder hatte, wurde wegen aktiver Teilnahme an den Protesten am 17. Juni 1953 nach Sibirien verschleppt und tauchte nie wieder auf. Mit Joachim, dem größeren der beiden Söhne, war ich einige Male zusammen im Kinderferienlager.