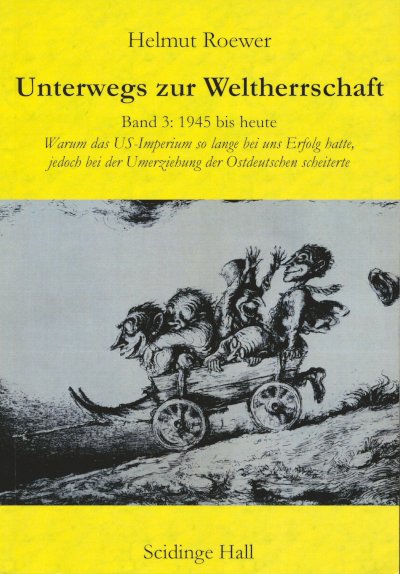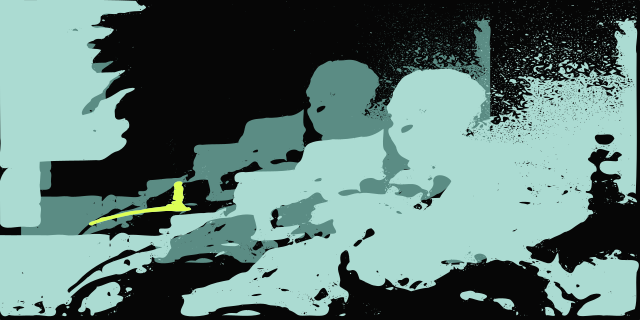von Steffen Dietzsch
Band 1 (1917-1920), mit einem Essay v. Michail Schischkin. 457 Seiten; Band 2 (1930-1932), mit einem Essay v. Ulrich Schmid, 505 Seiten]
Als nach dem Ende der Sowjetunion viele staatliche und persönliche Archive für die Öffentlichkeit geöffnet wurden, zeigte sich eine unerwartete Vielfältigkeit gerade ›unterhalb‹ der parteilichen Öffentlichkeit in jener – vor allem zwischen 1929 und 1989 – streng geschlossenen und kontrollierten Gemeinschaft. Die besonders seit Zeiten des Kalten Krieges üblichen Darstellungen einer von Schrecken und Schwermut zusammengehaltenen uniformen Masse von ›Mitläufern‹ und Parteidoktrinären waren lange im Gebrauch als narrative Grundierung westlichen ›Wissens‹ über die uns vom Osten verheißene Zukunft im Rohbau (F. C. Weiskopf). Es war aber gerade durch die archivalischen Neufunde immer differenzierter möglich, ganz neue Erfahrungs- und Lebenszeugnisse aus sehr unterschiedlichen Ebenen des Sowjetalltags auszuheben. Dadurch gewinnen viele Sowjetautoren nach langer, parteidominierter, äußerlicher Gemeinschaftlichkeit eine neue Statur von bewegter, bewährter Individualität. Das, was sogenannte ›Dissidenten‹ schon immer als ›Bonus‹ beanspruchen konnten, wird langsam als überindividuelle, wenn auch klandestine Ressource in der Alltags- und Überlebensmentalität der Sowjetwelt deutlich: »Die im Menschen verborgenen Träume ans Licht zu ziehen – darin sah Prischwin seine Aufgabe.« (Konstantin Paustowski)
Michail Prischwins (1873-1954) jetzt insgesamt bekanntgewordene Tagebücher (sie umfassen, 1991 gedruckt, im russischen Original achtzehn Bände!) dokumentieren das Auf und Ab der Zeit des harten Bolschewismus (vom Oktoberputsch 1917 bis zum Tod Stalins März 1953). Für die deutsche Ausgabe ist zunächst eine Auswahl in vier Bänden geplant. – Als Prischwin die Arbeit an diesen Tagebüchern begann, war er schon ein bekannter Autor; er schrieb seit 1905 journalistische und populärwissenschaftliche Skizzen, auch – lebenslang – Jagd-, Tier- und Abenteuergeschichten, die als ein eigenes (russisches) Genre: Otscherk, seither zum festen Bestand der Jugendliteratur gehören (exemplarisch: Grau-Eule, 1954). Den allgemeinen Eindruck von der ganz eigenen literarischen Signatur Prischwins war, wie es der jüngere Freund Paustowski formulierte, dass er ›Millionen von Menschen die russische Natur als eine Welt der feinsten, hellsten Poesie offenbart‹ hatte. – In den Tagebüchern aber bemerken wir einen aufmerksamen, assoziationsreichen Beobachter der politischen und menschlichen Aufbrüche, Abgründe und Absurditäten dessen, was man das Sowjetjahrhundert nennt.
Prischwin beginnt seine Tagebücher im Jahr 1914 mit Wahrnehmungen zu u.a. militärischen Tragödien, die das schnelle Ende der dreihundertjährigen Romanow-Dynastie deutlich werden lassen. Die deutsche Edition beginnt folgerichtig mit der Februarrevolte 1917: Prischwin nimmt en passant etwas wahr, was dem frenetischen Fortschrittsimpuls jener Tage ein langes Dunkel verheißt: »Die Elektrischen stehen still, jetzt aber sieht man erstaunt: Die Pferdebahn fährt!« (1, S. 8). – Zu Beginn des Jahres 1918 wird das russländische Reich von einer neuzeitlich bis dahin noch nie erlebten geopolitischen Veränderung erschüttert: durch den Vertrag von Brest-Litowsk (Febr. 18) verliert es alle Gouvernements zwischen Don (im Osten) und Dnjestr (im Westen). Prischwin war mit einem Mitglied der sowjetrussischen Verhandlungsdelegation bekannt: Lew Kamenew (1883-1936). Bis November 1918 etabliert sich hier ein ›Hetmanat‹ unter der Protektion des deutschen Generalstabs. Das wird von Prischwin auch der ernüchternden »Bilanz am Ende des ersten Revolutionsjahrs« (1, S. 103) zugerechnet. Die Schuld an den vielen Verwerfungen, die mit diesem Jahr verbunden sind, wird von Prischwin nicht zuerst ›politisch‹ zugeteilt, denn: »Erst wurde der Deutsche unser äußerer Feind, dann wurde aus dem Deutschen der innere Deutsche, als nächstes kam der Zar an die Reihe, dann der Bolschewik, jetzt der Jude« (1, S. 104), aber enden wird das erst, wenn der Mensch in sich selber die Ursachen jener religiösen, vormundschaftlichen oder patriotisch-nationalistischen Affekte finden wird. »Von Gerechtigkeit kann nicht die Rede sein, denn alles geschieht prinzipienhalber.« (1, S. 120) Für sich habe der Diarist »einen eigenen Ausgang ins Allgemeinmenschliche« (1, S. 118) gefunden, aber eben »im russischen Bärenwinkel«, nicht »in europäischer Lebensweise«. Und hier bemerkt er, das »Gefühl des Endes (Eschatologie), das im einfachen Volk wie in unserer Intelligenzija gleich ausgeprägt ist, verleiht gegenwärtig den Bolschewiki ihre Stärke, die nicht einfach bloß aus einer marxistischen Schlussfolgerung kommt.« (1, S. 126)
Dem Jahr 1919 gehört Prischwins gesteigerte Aufmerksamkeit; neben Tagebuch-Eintragungen hat er dem »Jahr neunzehn des zwanzigsten Jahrhunderts« [Der irdische Kelch. Das Jahr neunzehn des zwanzigsten Jahrhunderts, Berlin (Guggolz) 2015] ein eigenes Buch gewidmet. Dieses Jahr beansprucht auch in der sowjetischen Hagiographie der Revolution einen besonders hervorragenden Rang: es gilt als das Unvergessliche Jahr 1919 (nach dem gleichnamigen Theaterstück von Wsewolod Wischnewskij, geschrieben 1949 zu Stalins siebzigstem Geburtstag, verfilmt 1952 von Michail Tschiaureli, mit der Musik von Dimitri Schostakowitsch). Es war nach dem Ende des Weltkrieges das Jahr existentieller Behauptungen gegen Landnahmen antibolschewistischer Streitkräfte und Milizen des In- wie Auslandes zwischen Baltikum und Stillem Ozean. Es war das Jahr der Märtyrer- und Heldengeschichten,von Budjonnys Reiterarmee, von Bljuechers Fernöstlichen Feldzug zum Amur, von Trotzkis Schnellzug – die Revolution »ist auf Räder umgezogen« (1, S. 223), von Tschapajew, Kotschubej, Rudnew oder Stschors, dem Beginn des Kriegskommunismus (bis März 1921) und dem Beginn des Roten Terrors (vgl. 1, S. 227-230). Prischwin erleidet gerade in diesem Jahr, wie durch »die Kraft der uranfänglichen Gleichheit, die das Individuum hinwegfegt«, eine ganze Kultur zerstört wird: »das Chaos hat begonnen und seine gleichmacherische Kraft.« (1, S. 189) In seiner sowjetrussischen Gegenwart bemerkt er fortan ein altes Paradox wohl aller sozialrevolutionären Befreiungen, das einst Alexander Herzen formuliert hatte: »den Kampf des freien Menschen mit den Befreiern der Menschheit.« (1, S. 180)
Anfang Januar 1920 reagiert Prischwin auf neue Frontstellungen im laufenden russländischen Bürgerkrieg: »Am Horizont des Krieges zeigen sich die Polen, und mit ihnen lebt die Hoffnung auf die Konterrevolution wieder auf.« (1, S. 261) Dass diese Wahrnehmung einer dokumentierbaren historischen Tatsache entspricht, zeigt ein Blick in die Intentionen des polnischen Militärchefs Józef Pisudski, der seinerzeit in einer programmatischen Schrift deutlich machte: »Schon im Jahre 1918 stellte ich mir ganz unabhängig ein klares Ziel des Krieges mit Sowjetrußland […] Im Jahre 1919 vollbrachte ich diese Aufgabe.« ( Józef Pisudski, Das Jahr 1920) Bis Mai 1920 beschreibt das Tagebuch die entsprechenden Erfolge gegen den Bolschewismus. Dabei bildet sich eine überraschende neue geopolitische Perspektive heraus: »Polnischer Angriff auf Kiew, anscheinend wird sich bald noch ein Teil Rußlands, die Ukraine, als unabhängiger Staat formieren. Nur Moskowien hat keine feste Kontur, sondern bleibt eine Kategorie des Raumes und des Strebens nach Erweiterung.« (1, S. 284) Bei dem Kommentar dieses Eintrags im Band 1 (S. 391) ist ein gravierender Fehler anzumerken: die Gründung der wieder unabhängigen (Zweiten) Republik Polen wird hier »mit dem Frieden von Brest-Litowsk« März 1918 verbunden, ist tatsächlich aber erst nach der deutschen Kapitulation, am 11. November 1918 erfolgt.
Die deutsche Edition der Tagebücher hat sich dann für eine Zehnjahreslücke entschieden und im Band 2 die Jahre 1930-1932 dokumentiert. Aber in diesen zehn Jahren wurde das vielfach chaotische, experimentierfreudige und von vielen Aufbruchwilligen existentiell mitgetragene Konstruktionswerk einer kulturell prosperierenden (absichtsvoll nicht-parlamentarischen) Massengesellschaft am Ende mit politisch-ideologisch doktrinären Entscheidungen zugrunde gerichtet. 1927, auf dem 15. Parteitag der russländischen Kommunisten machte einer der Redner – denunziatorisch und höhnisch – auf die Klage des ehedem hochverdienten Bürgerkriegs-Veteranen, Sergei Mratschkowski (1888-1936), aufmerksam, der in öffentlicher Rede die politisch Schuldigen am absehbaren Niedergang des Lenin-Projekts von 1917 namhaft machte, nämlich »die Stalin-Fraktion, die sich ZK [Zentralkommitee] nennt« Diese ›Stalin-Fraktion‹ macht auch Prischwin als politische Entscheider für die – wie wir heute wissen – strategischen Fehlorientierungen namhaft, die – wie man auch schon ahnen konnte – zwischen 1930 und 1990 die Sowjetunion für zivilisatorische Selbsterhaltung ideenlos und also unbrauchbar machten. Prischwin fragt schon im Sommer 1930 (es läuft gerade der 16. Parteitag der KPdSU), ob nicht zu befürchten sei, »dass die momentane Generallinie bewusst auf einen Krieg zusteuert, der zum weltumspannenden Bürgerkrieg werden muss?« (2, S. 84)
Die stalinsche Volksgemeinschaft wurde künftighin militärförmig verwaltet (zeitgenössische Kritiker benutzten dafür den Pleonasmus Kasernensozialismus …). Wirtschaftliche Entscheidungen, Planungen und Produktion haben Befehlsstruktur, Versäumnisse oder Verstöße dagegen wurden standrechtlich geahndet, das Verratsnarrativ war allgegenwärtig. Mitte Januar 1930 konstatiert der Diarist: »Eine durchsetzungsmächtige Zentralgewalt und die unzweifelhafte Stärke der Roten Armee – das ist das ganze »ergo ∑« des Sowjetrussland-Kollektivs.« (2, S. 12f) Und in diesem Monat Januar erscheint in – natürlich – der militär-politischen Tageszeitung (1930, Nr. 16, Krasnaja Swesda) der Artikel »Die Liquidierung des Kulakentums als Klasse«. Die Radikalität, mit der nun das bäuerliche Privateigentum (Boden, Immobilien, Produktionsmittel) massenhaft und zügig aufgelöst und in Gemeineigentum überführt werden soll, bekräftigt Stalin in der übernächsten Nr.18 (21. Jan. 1930) dieses Blattes. Das habe zur Folge »eine Wendung von der alten Politik der Einschränkung der kapitalistischen Elemente des Dorfes zur neuen Politik der Liquidierung des Kulakentums als Klasse.« Prischwins unmittelbarer Eindruck der Zerstörung der bäuerlichen Kultur in Russland ist dann: »Die Kolchosen sind das reine Grauen.« (2, S. 13), oder »Wie stark sich die Unbarmherzigen vermehrt haben, die bei der Tscheka, dem Fiskus, der Bauernkollektivierung« (2, S. 21). Die landwirtschaftlichen Arbeitszyklen brachen zusammen, da es keine Bauern mehr gab, nur noch Landarbeiter, oder wie Prischwin sagt: »zum einen werden sich Kolchosen in Fabriken verwandeln, zum anderen (Bauern) in Werktätige, Proletarier« (2, S. 49), jedenfalls in »regierungsgebundene Muschiki« (2, S. 40). Die Folge ist, dass es nicht mehr um »Ernten« geht, sondern nur noch um »Getreidebeschaffung« (dort, wo noch Saatgut oder andere Vorräte zu erwarten wären). Die frühen Warnungen z.B. der Bucharin-Tomski-Rykow-Fraktion, »daß das Land ohne Getreide bleibt«, »daß die Bauern nicht kollektiviert werden wollten« wurden parteioffiziell in der Prawda (v. 7. Nov. 1929) als »bürgerlich-liberales Gewäsch« abgetan. Aber die Extremisten im Kreml haben Reserven: »Heutzutage verfügt die Regierung über Kader, die es unter dem Zaren nicht gab: eine ihr fanatisch ergebene Jugend.« (2, S. 51)
Die stalinistische Enteignungs-Kampagne, die Bauern in kürzester Zeit und massenhaft von ihrem Eigentum zu trennen, hatte unter den improvisativen Sowjetbedingungen allerdings sofort einen Verwaltungs-, Verkehrs- und Ernährungskollaps zur Folge, der ›von oben‹ her kaum noch zu beherrschen war. Da kam auch Stalins – »des Sowjetvolkes großer Ernteleiter« – halbherziger Bremsversuch mit seinem Appell Vor Erfolgen von Schwindel befallen (vom 2. März 1930) zu spät. Jetzt hieß es, so notiert der Diarist: »Wir haben übertrieben, jetzt korrigieren wir die Richtung, auch den Glauben unterbinden wir nicht länger […] Nach der finsteren Zeit, in der wir jeden Augenblick das blutige Ende erwartet hatten, endete plötzlich alles in einer Komödie.« (2, S. 35). Aber die hält sich nicht lange: »›Lustig, ja‹, räumt der Muschik ein, ›aber nicht zum Lachen: das Lachen vergeht einem vor Grausen‹.‹ (2, S. 40) Und schließlich resigniert Prischwin: »Nein, es gibt offensichtlich keine Möglichkeit, sich von den schrecklichen Folgen der »linken Überspitzung« erholen. Bald wird sich alles als Nachwehen des untergegangenen Zarismus herausstellen.« (2, S. 37).
Die grauenhafte Folge mit Millionen von Hungertoten (Anfang der Dreißiger) hatte natürlich das ganze Land zu tragen und nicht etwa ›nur‹ die Zielgruppe der Enteigneten, oder gar ›nur‹ einzelne Sowjetregionen. Es war doch der stalinistischen Sowjet-Mentalität politisch fremd, ihr Herrschaftsgebiet ethnisch-völkisch zu hierarchisieren. Der 1930er Parteitag warnte sogar vor dem »großrussischen Chauvinismus als Hauptgefahr in der Partei auf dem Gebiet der nationalen Frage«. Auch war es schon verwaltungstechnisch unvorstellbar, das Massenelend regional administrativ speziell anzuweisen. Es gab innerhalb der Sowjetgesellschaft kein macht- oder repressionstechnisches Sondergebiet! – Allerdings: jene verhängnisvollen politischen Entscheidungen in der Sowjetunion gegen die Bauern von damals brachten das ganze Land seither (nicht nur in Kriegszeiten) in einen anhaltenden Zustand universeller Mangelversorgung, regional auch schon immer wieder einmal an die Grenze des Hungers. Es bleibt über alle Zeiten ein Grundparadox sowjetischen Lebens: »versprochen worden sind Äpfel, ausgeblieben ist Brot.«
In jenen Jahren des Stalinismus in statu nascendi demonstrierte der Schriftstelle Prischwin, wie man in diesen Zeiten politischer aktivistischer Omnipotenz gerade doch auf der Bindungskraft des Persönlichen, Allgemein-Menschlichen zu beharren habe. Sein – antipolitisches – Gegenprogramm als Schriftsteller wie als Bürger zum Umgang mit Menschen, auch dort, in jener Welt ohne Erbarmen, dem Jahrhundert des Schreckens (Daniil Granin), betont das Unverfügbare des Menschen: man habe zu leben, »als gäbe es keine Klassen in der Gesellschaft, die Menschen sind alle gleich, sie verdienen alle das Gespräch mit dir, öffne allen die Tür zu deiner Hütte, und suche du selbst beherzt Rat beim Weisen wie dem Einfältigen, und freudig, ohne irgend ihre Herkunft und ihr ›Klassenbewusstsein‹ zu beachten.« (2, S. 66)
Die Tagebücher sind ein noch ganz unberührtes Archiv persönlicher und literarischer Lebens- und Wissensumstände, die zu einer historischen Neubesinnung der dramatischen wie tragischen Alltagskultur der Sowjetunion führen könnten, gewissermaßen ›von unten‹ her, wo das Leben paradox ist.