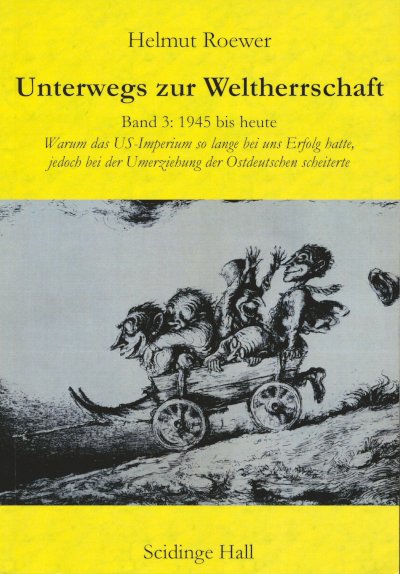von Herbert Ammon
Vorbemerkung
Den nachfolgenden Text – die Besprechung eines Buches, das auf englisch bereits vor fast vier Jahrzehnten erschienen ist, schrieb ich auf Bitten meines deutsch-kanadischen Freundes Hans Sinn im vergangenen Jahr, als der im April 1915 ausgelöste Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich im Gedenkkalender stand. Nicht allein um der historischen Genauigkeit willen sollte künftighin auch der jeweils Hunderttausende zählenden Todesopfer unter den im Ersten Weltkrieg und danach verfolgten Aramäern, pontischen und kleinasiatischen Griechen – gewöhnlich subsumiert unter ›andere christliche Minderheiten‹ – gedacht werden.
Mit Hans Sinn (Peace Brigades International [PBI]) bin ich seit der deutsch-deutschen Friedensbewegung seit den frühen 1980er Jahren verbunden. Durch seine – alsbald durch Einreiseverbot erschwerten Kontakte zu Aktivisten in der DDR, namentlich zu Edelbert Richter (http://www.globkult.de/herbert-ammon/877-annus-mirabilis-1989-zur-vor-und-nachgeschichte-einer-begegnung), Christian Dietrich und Stephan Bickhardt, bestärkte er oppositionelle Kreise in der DDR in ihrem auf Überwindung der deutschen und europäischen Teilung gerichteten Friedensengagement.
Angesichts der seit Jahren präsenten Szenen von Krieg- und/oder Bürgerkrieg, Terror und Flüchtlingselend in Nahost sowie auf das daraus resultierende Flüchtlingselend mag das vorgestellte Buch bei einigen nur noch historisches Interesse erwecken, auf andere als Dokument menschlichen Leidens hingegen zeitlos wirken. Unabhängig von derlei Wahrnehmungen erscheint der Überlebensbericht eines Armeniers – im Hinblick auf die doppeldeutige Rolle der Türkei in Nahost sowie gegenüber der EU, nicht zuletzt in ihrem Umgang mit der Historie des Osmanischen Reiches, von hoher Aktualität.
Die Buchbesprechung wurde von Silke Reichrath ins Englische übersetzt. Sie ist aufzurufen unter: http://www.brookevalleyresearch.ca/the-urchin.html
I.
Was ist Geschichte, was bedeuten uns, Zeitgenossen oder Nachgeborenen, die wir mit spezifisch eigenen Erinnerungen leben, die Leidenserfahrungen von ›anderen‹? Betrachten wir sie nur wie im Theater eine Inszenierung des zeitlosen Stoffes der antiken Tragödie? Um eine Antwort sind die meisten Historiker verlegen, denn, wo die Tragödie den ›Sinn‹ offen lässt, ist ihr Geschäft vermittels Kausalität die ›Sinn‹ stiftende Rekonstruktion der Vergangenheit unter ihren jeweiligen Prämissen. Selbst unter der Zielsetzung, die Realgeschichte, die Faktizität des Geschehenen unideologisch ›objektiv‹ darzustellen, entsteht – gemäß dem derzeit beliebten Modebegriff – stets ein ›Narrativ‹, eine so oder so – politisch, moralisch oder philosophisch – eingefärbte Erzählung. Dies gilt auch für die jüngere Methode der ›oral history‹. Auf der Ebene der Systematisierung und Interpretation diverser Erinnerungen mündet sie wiederum in ein ›Narrativ‹.
Der Quellenwert persönlicher Erinnerungen wird dadurch keineswegs gemindert. Zugespitzt ließe sich in Abwandlung des Ranke-Wortes sogar sagen, allein auf der subjektiven Ebene, in den Lebenserinnerungen von Menschen, erscheine Geschichte als Erzählung, ›wie es eigentlich gewesen« . Die Erinnerungen des Armeniers Kerop Bedoukian (1907-1982) an das Erleben und Überleben des an seinem Volk verübten holocaust – dies der Terminus in seinem Vorwort des 1978 erstmals erschienenen Buches – fallen in die genannte Kategorie.
II.
Bedoukian, als Neunzehnjähriger im Jahre 1926 nach Kanada gelangt, schrieb dieses Buch erst mit 68 Jahren, vier Jahre vor seinem Tod. Dass er das Erlebte mit klarem Erinnerungsvermögen und mit großer Präzision darzustellen vermochte, ist psychologisch zu erklären: Zum einen mit der in Kindesjahren besonders ausgeprägten Beobachtungsgabe. Nicht von ungefähr verweist der Autor selbst auf seine damalige Perspektive als Junge, der die Karawane ins Ungewisse anfangs wie eine Art Abenteuer begriff. Entsprechend lautete der Titel des englischen Originals ›The Urchin‹ – ein ins Deutsche schwer übersetzbares Wort mit Konnotationen wie ›Schlingel‹, ›Lausbub‹ oder ›Bengel‹. Zum anderen hinterlässt erfahrenes Grauen lebenslang nachwirkende Traumata. Das Bild, wie ein Türke mit dem scimitar (Krummsäbel) die Hand einer Frau abhackt, die ihr Kind retten will, das auf dem ihr entrissenen Esel sitzt, verfolgte den Autor zeitlebens. Warum ist er damals nicht hinterhergerannt und hat versucht, das Kind herunterzureißen? ›Bis heute fühle ich mich schuldig angesichts dieser Feigheit‹ (»To this day I feel guilty for this act of cowardice.«)
Die Familie Bedoukian stammte aus Sivas, einer Stadt im nordöstlichen Anatolien mit seinerzeit etwa 80 000 Einwohnern, davon 30 000 Armenier. Die historische Szenerie des Kriegsjahres 1915 tritt bereits im Eingangskapitel eindrucksvoll hervor: Seit den von Sultan Abdül Hamid ausgelösten Pogromen (1894-1896) lebten die Armenier in ungewisser Anspannung. Die Bedoukians gehörten zu den relativ Wohlhabenden, denn außer einem Laden verfügten sie als agas in drei umliegenden türkischen Dörfern über Einkünfte aus Naturalpacht. Sie besaßen ein Haus in einer kleinen Sackgasse, deren Eingang von fünf Hunden bewacht war. In ihrem Hause verbargen sie einen Deserteur. Eines Tages mussten Kerop und sein Freund hilflos zusehen, wie ein türkischer Junge einen der Hunde mit Messerstichen tötete. Kurz darauf beoachtete Kerop inmitten einer atemlosen Menge, wie ein junger Mann, offenbar ein Armenier, öffentlich gehängt wurde. Wenig später wurde der Vater im Zuge einer Polizeiaktion verhaftet. Die Familie sah ihn zum letzten Mal im Gefängnis. Illusionslos bezüglich des ihn erwartenden Schicksals, beschwor er sie, ihrem christlichen Glauben bis zum Martyrium treu zu bleiben.
Für die Armenier von Sivas begann der Leidensweg mit der für den 3. Juli 1915 angeordneten Deportation. Was der knapp neunjährige Kerop, der vierte unter sechs Geschwistern, in den folgenden Tagen und Wochen auf dem unendlichen Elendszug in Richtung Süden erlebte, sind Szenen apokalyptischen Grauens. Bereits am Morgen des zweiten Tages erblickt er am Straßenrand eine tote Frau, nackt auf dem Rücken ausgestreckt, zwischen den Beinen ihr totes, nacktes Kind.Tag für Tag reihen sich die Bilder des Schreckens: Überfälle von Türken und Kurden, die es auf alles, was die Deportierten noch mit sich führen, abgesehen haben, insbesondere auf Gold, auf junge Mädchen und Frauen. Entdeckt man noch Männer, werden sie erschlagen. Drei den Elendszug eskortierende Gendarmen finden ihr Vergnügen darin, Frauen wie Tontauben abzuschießen. Plünderer, aber auch Angehörige des trostlosen Zuges, stochern in Haufen von Exkrementen nach Schmuck und Gold, die einen zur Bereicherung, die anderen auf der Suche nach verschluckten Tauschmitteln. Nach einer zweitägigen ›Rast‹ in den Bergen, eher sinnlos angesichts ungeminderten Hungers und Dursts, bleiben Hunderte von Leichen zurück. Der Selbstmordversuch einer Cousine scheitert – der Brunnen war bereits vollgestopft mit toten Leibern.
Auf dem Todesmarsch verliert Kerop zwei seiner Geschwister. Eines Tages – der Zugang zum womöglich rettenden Euphrat von den Gendarmen versperrt – fällt die sechsjährige Schwester Mariam tot von ihrem Esel. Wenig später bleibt die halbgelähmte Großmutter aus eigenem Entschluss zurück. Am Eingang einer Schlucht, an deren Ausgang türkische Posten verkleidete Männer aus dem Zug herauspicken, entledigt sich der fünfzehnjährige Bruder Serop seiner Frauenkleider und verabschiedet sich. Die Bedoukians haben nie mehr von ihm gehört.
III.
Sofern es eine Heldin in diesem Schreckensdrama geben kann, ist es die Mutter, die als Gebieterin über mehrere Familien – ein wechselnder ›Clan‹ von anfangs mehr als dreißig, zuletzt nur noch zwölf Menschen – dem Unheil ihren Überlebenswillen entgegensetzt. Als die älteste Schwester Aghavni die Nachricht vom Tode Mariams überbringt, erwidert sie: »Lasst die Toten und kümmert euch um die Lebenden.« Ihrer Disziplin und ihrem Geschick verdankt der Rest des ›Clans‹ – inmitten der organisierten Willkür entkam die Gruppe durch List und Zufall und List dem Tode in der syrischen Wüste – das Überleben.
Die innere Kraft gewann Serpouhi Bedoukian aus ihrem unerschütterlichen Glauben. Dem Knaben Kerop entging nicht der funktionale Aspekt ihrer Religiosität, wenn sie einer jungen Frau, die soeben ihr zweites Kind verloren hatte, als Trostwort das Martyrium in Aussicht stellte. Zur Überlebenstechnik der Mutter gehörte der Kompromiss mit der Realität, etwa als sie die ›Heirat‹ eines entfernt verwandten Mädchens – es hatte sämtliche Angehörigen verloren – entgegen dessen Willen mit einem jungen Mann unter der Behauptung forcierte, der ›Bräutigam‹ sei Armenier. Als Kerop das Mädchen noch ein paar Mal zu sehen bekam, trug sie türkische Kleider nach Art der Haremsfrauen.
Es sind nicht allein derlei Episoden, die das Buch zu einer beeindruckenden Lektüre machen. Den Zug über einen Gebirgspfad entlang eines Abgrunds schildert der Autor wie folgt: »Seit wir angefangen hatten im Freien zu schlafen, hatte ich mich über Sternschnuppen gefreut und mich nach ihrem Grund und Zweck gefragt. Jetzt beobachtete ich, wie sich der Zug bewegte und sah, wie Menschen und Tiere den Tritt verfehlten oder gegen einen hervorstehenden Felsbrocken stießen und in eine bodenlose Schlucht hinunterstürzten, ebenso zahlreich wie die Sternschnuppen.‹ (»Ever since we began sleeping in the open, I had enjoyed watching shooting stars and wondered at their source or purpose. Now I was watching the line of marchers and saw people and animals miss a step or bump into a jutting rock and tumble down into a bottomless ravine at the same frequency as the shooting stars.«) Ähnlich eindrucksvoll sind Landschafts- und Ortsbeschreibungen, etwa des die Wüste durchziehenden Euphrat, einer Höhle über der Stadt Birejik, wo die Familie eine Zeitlang hauste, oder der Hafenstadt Liverpool, die Kerop vor seiner Abreise nach Kanada durchstreifte.
IV.
Im Vorwort erklärt der Autor, er verstehe sein Erinnerungsbuch nicht als Geschichtswerk. Zum Thema des Armeniermordes gebe es genügend Studien aus kompetenter Hand. Tatsächlich ist die in der englischen Ausgabe angefügte historische Notiz etwas knapp ausgefallen. Der Satz: »For centuries the Armenians suffered under Turkish rule, but they kept their faith, their culture and their strong family unity« bedarf einer Korrektur. Im osmanischen Reich besaßen die Armenier als für Verwaltung und Handel unentbehrliche Minderheit unter den milletim, den nach Religionszugehörigkeit definierten Völkern, eine gewisse Vorzugsstellung. Dies änderte sich im Zuge der Modernisierung des Reiches. Zu Recht wird der Russisch-Türkische Krieg von 1878 als entscheidende Zäsur genannt, der eine Ära der Verfolgung und Pogrome eröffnete. Unerwähnt bleibt hingegen das ›nationale Erwachen‹ der Armenier. Die Problematik der Jungtürkischen Revolution von 1908 (»democratic government«) und ihres Umschlags von anfänglich liberalen Zielen in türkisch-muslimischen Nationalismus kommt in nur einem Satz mit dem Verweis auf den Ausbruch des I. Weltkriegs zu kurz.
Nichtsdestoweniger enthält Bedoukians Zeugnis vielerlei historisch aufschlussreiche Details. Das beginnt mit der Episode des im Hause versteckten Deserteurs. In der Familie sprach man hoffnungsvoll von »Onkel Christian« womit das als Schutzmacht der orientalischen Christen auftretende zarische Russland gemeint war. Hinsichtlich der vom Regime im fernen Konstantinopel entfesselten Instinkte, in simpler Raubgier und sadistischer Gewalt, standen sich Türken und Kurden in nichts nach. Es gab im Südosten des osmanischen Reiches sowohl turkisierte als auch arabisierte glaubenstreue Armenier, von denen wiederum ein Teil in das Mühlrad der Vernichtung gerieten. Die Abneigung der Araber gegenüber den Türken half einigen Armeniern beim Zug in die Wüste zu überleben, wenngleich oft um den Preis der Trennung der Kinder von ihren Familien.
Für die Armenier bot sich als einziger Ausweg aus der Vernichtung die Konversion. Nur wenige – Bedoukian spricht politisch inkorrekt von den ›Mohammedanern‹ – vollzogen diesen Schritt, gewiss der Verachtung ihres glaubensstarken Volkes. Als Kerop indes den Leidensbericht eines abgefallenen Cousins vernahm, war er bereit zu vergeben. Ferner kommt die Rolle der protestantischen, mehrheitlich amerikanischen Missionare im Orient zur Sprache – ein hierzulande wenig bekanntes Kapitel. Die protestantische Mission bildete das Rückgrat der auf Initiative von Henry Morgenthau Sr. – des im Buch nicht erwähnten US-Botschafters – in Konstantinopel 1915 gegründeten Near-East Relief Association, die noch bis in die 1920er Jahre hinein das Elend der Überlebenden – etwa bei der Suche nach Waisenkindern sowie bei der Auswanderung– zu lindern versuchte.
Die Todesmärsche der Armenier fielen in die Kriegsjahre 1915/16. Bedoukians Buch ist ein Beleg dafür, dass das Leiden und Sterben, durch Hunger, Seuchen und Gewalt, noch nach Kriegsende weiterging. In Aleppo, wo die Familie eine prekäre Zuflucht gefunden hatte, kam es trotz englischer und französischer Truppenpräsenz am 24. September 1919 noch zu einem blutigen Pogrom an Armeniern, bei dem Türken und Araber gemeinsam agierten. In Aleppo erfuhren die Überlebenden von der armenischen Staatsgründung auf dem ehedem von russischen Truppen besetzten Gebiet (28. Mai 1918). Kam nach allem, was man hörte und wusste, eine Rückkehr in die Heimatorte nicht mehr in Frage, so dachten die wenigsten trotz patriotischer Agitation (»strongly nationalistic speeches«) an eine Übersiedlung in das Gebiet des neuen Staates. Dort rückten bereits türkische Truppen auf Kars vor, und eine Bande von Freischärlern unter Topal Osman zog durch die alten Siedlungsgebiete und tötete, wer an Überlebenden in ihre Hände geriet.
Das Ziel der Bedoukians war zunächst das unter Vier-Mächte-Kontrolle (Briten, Franzosen, Italiener und Amerikaner) stehende Konstantinopel, wo (nach Ermordung ihrer Führungsschicht!) eine größere Anzahl von Armeniern – die Zahl von 200 000 scheint zu hoch gegriffen – unter dem Schutz der europäischen und amerikanischen Diplomaten überlebt hatte. Angesichts der Erfolge der türkischen Truppen unter Mustafa Kemal (Atatürk) legten die meisten Armenier auch diese Hoffnung beiseite und zielten auf rasche Emigration, vorzugsweise in die USA vermittels dort bereits lebender Verwandten. Aufgrund der verschärften Visa-Bestimmungen von seiner Familie getrennt, landete Kerop Berdoukian am Ende einer weiteren Odyssee über Bulgarien und England am 10. Oktober 1926 im Hafen von Quebec.
V.
Kerop Bedoukian schrieb ein Buch ohne hassvolle Erinnerung. Es enthält sporadische Episoden von Mitgefühl und – nicht immer uneigennütziger – Mitmenschlichkeit. Es ist naheliegend, die armenische Leidensgeschichte in die Geschichte des ›Jahrhunderts der Vertreibungen‹ sowie der gegenwärtigen Massenflucht aus dem Nahen Osten einzuordnen. Derlei Generalisierung übergeht indes – beispielsweise im Verweis auf die in Potsdam von den Alliierten sanktionierten Vertreibungen von Millionen von Deutschen – die jeweiligen historisch-politischen Umstände. Was die Gegenwart betrifft, so erhellt die von Kerop Bedoukian an den Schluss seines Buches gestellte Szene einen gravierenden Unterschied zwischen damals und heute: Als er nach langen Stunden des Wartens das Hafengebäude mit dem Stempel der kanadischen Einwanderungsbehörde verließ, passierte er einen Schreibtisch, wo ihm eine Dame ein Buch überreichte. Es war eine zweisprachige Bibel, in englisch und armenisch.
Das Erinnerungsbuch dürfte im Falle der angestrebten Publikation in deutscher Sprache, auch außerhalb der überschaubaren Gruppe von deutsch-armenischen Freundeskreisen eine größere Leserschaft finden. Die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts ist in zwiefacher Hinsicht, im Bösen wie im Guten, mit der Geschichte des armenischen Volkes verwoben. Zu erinnern ist an das Verhalten der deutschen Reichsführung im I. Weltkrieg, die, obgleich über die Massaker an den Armeniern im Bilde, es aus ›realpolitischen‹ Erwägungen und militärischem Kalkül vorzog, auf Proteste bei ihren Verbündeten, der Regierung des Osmanischen Reiches, zu verzichten. Auf der anderen Seite stehen Männer wie der Gelehrte und Missionar Johannes Lepsius sowie der Schriftsteller Armin T. Wegner als Zeugen der Menschlichkeit.
Zur bitteren Ironie der Tragödie gehört, dass unter den vergeblichen Mahnern der Name Max-Eugen von Scheubner-Richter zu finden ist. Als Konsul in der ostanatolischen Stadt Erzurum wurde er entsetzter Augenzeuge und Berichterstatter des Grauens. In den frühen 1920er Jahren gehörte der Baltendeutsche Scheubner-Richter zu Hitlers engstem Umkreis in München. Bei der Niederschlagung des Hitler-Ludendorff-Putsches am 9. November 1923 kam er zu Tode. Zwei Jahre zuvor, 1921, hatte das Berliner Landgericht einen armenischen Studenten, der Talât Pascha, als Innenminister einer der Hauptakteure des Armeniermordes, auf dem Kurfürstendamm erschossen hatte, vom Mordvorwurf freigesprochen.
Im Jahre 2014, als die Erinnerung an den Ausbruch des I. Weltkrieges, an den ›Selbstmord Europas‹ (Paul Ricoeur), das große Thema für Geschichtswerke sowie Kontroversen über die jeweiligen Schuldanteile bildete, erregte Fatih Akin mit dem Film The Cut Aufsehen. Getragen vom Wunsch nach erinnernder Versöhnung, konfrontierte der türkisch-deutsche Regisseur ein weltweites Publikum mit der Tragödie, die im Sommer 1915 über die circa drei Millionen zählenden Armenier im Osmanischen Reich hereinbrach. Sodann diente auch in Deutschland das Datum des 8. April 2015 – der alljährliche Gedenktag der Armenier ist der 24. April – als Anlass zu historischer Erinnerung. Inzwischen okkupieren längst andere Bilder die Tagespolitik und die mediale Öffentlichkeit, so dass es scheint, als sei die Wahrnehmung des Schicksals der Armenier hierzulande bereits wieder verblasst. Die historisch-politische Wirklichkeit begegnet uns gleichwohl im Umgang der türkischen Regierung mit dem Massenmord im I. Weltkrieg sowie im unterschwelligen Streit um die Äquivalenz des Begriffs ›Genozid‹ hinsichtlich der Schoa der Juden unter Hitler und der Vernichtung der Armenier unter den Jungtürken.
Losgelöst von derlei geschichtspolitischen und aktuell politischen Kontroversen um den Begriff des Genozids sowie um historische Schuldanteile gebühren der Leidensgeschichte der christlichen Armenier mehr als ein paar flüchtige Sätze in unseren Geschichtsbüchern. Dem Thema angemessen, hat Franz Werfel in seinem großen Roman Die vierzig Tage des Musa Dagh den militärischen Widerstand der um seine Hauptfigur Gabriel Bagradian gescharten viertausend Menschen aus den kleinarmenischen Dörfern am Fuße des Mosesberges mit heroischen Zügen ausgestattet. Mt dem Buch von Kerop Bedoukian liegt ein Dokument vor, in dem der Genozid, das Leiden und Sterben unzähliger Armenier im I. Weltkrieg ohne romanhafte Zutaten anschaulich wird.
(Postscript: Die oben vorgestellten Erinnerungen erschienen auch unter dem Titel: Some of Us Survived. The Story of an Armenian Boy beiFarar, Straus, Giroux (New York) 1979)