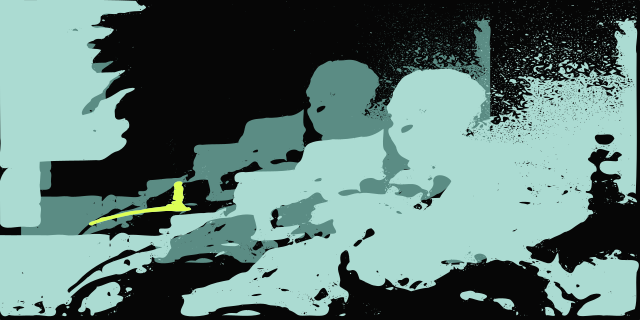von Heinz Theisen
Zukunftsfähigkeit durch Rückkehr zur eigenen Kultur?
Der Niedergang der Europäer zeigt sich sowohl in der an Dekadenz grenzenden Unterfinanzierung ihrer Armeen als auch in ihrem größenwahnsinnigen Moralismus und Globalismus, der sie bis zur Demokratiemission nach Kabul und zur Verteidigung der Ostukraine verleitet. Die aus Klimahysterie erfolgende Deindustrialisierung in Deutschland und der demografische Niedergang des gesamten Westens sind Ausdruck der Krise einer Kultur, die der Fortsetzung des Eigenen keine Bedeutung beigibt.
Seinen deutlichsten Ausdruck findet der Mangel an Selbstbehauptungswillen in den offenen Grenzen, mit denen die Europäer die benachbarte Erobererreligion des Islam zur Kolonialisierung einlädt. In der Vertauschung der größten Gefahr, die im autoritären Russland verortet wird, aber in Wirklichkeit aus dem totalitären Islam kommt, zeigt sich die Unfähigkeit der ungebildeten politischen Eliten, die nur in den alten politischen (und nicht in religiös-kulturellen Kategorien zu denken vermögen.
Der in Europa heute obwaltende Kulturrelativismus verbindet sich mit politischem Universalismus. Dies ist nur scheinbar ein Widerspruch. Denn erst die Entkulturalisierung des Eigenen erlaubt etwa den Glauben an die Ausdehnbarkeit der Demokratie auf andere Kulturen. Darüber endete der angemaßte Universalismus unweigerlich in den militärischen Interventionen in fremden Kultur- und Machtkreisen.
Aber weder der Islam noch Russland oder China akzeptieren westliche Werte – schon gar nicht in ihren neuen kulturmarxistischen und ultraliberalen Varianten. Die moralisierende Einteilung der Welt in Gute und Böse verleitet die Universalisten zu katastrophalen Fehleinschätzungen wie dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, in dem es nicht um Demokratie und Diktatur, sondern um einen Kampf zwischen liberalen und autoritären Oligarchien geht.
Der Globalist glaubt, die Welt zu verstehen und etwa durch Klima- und Außenpolitik auch gestalten zu können. Diese Erkenntnishybris bedingt unweigerlich die Missachtung des gesunden Menschenverstandes, der sich meist in den Nahräumen der Bürger manifestiert. Ihr Ideal der ›Weltoffenheit‹ leitete über zu den offenen Grenzen auch gegenüber Kulturen, die ihre Menschenrechte durch Migration einzulösen versuchen.
Aufgrund seines moralisch untermauerten totalen Wissensanspruchs endet der Globalismus in der Ausgrenzung aller Andersdenkenden, die entweder nicht wissend oder böse sein müssen. Eine Oligarchie der Wissenden sichert sich in Deutschland über fast alle Parteien hinweg die Macht über die unaufgeklärten Massen, die angesichts ihrer bloß ›populistischen‹ Instinkte zugunsten der Wahrheit getäuscht werden dürfen.
In der Politik führen die einstmals konservativen Parteien seit Jahrzehnten Rückzugsgefechte gegenüber den Fortschrittstrunkenen, die meinen, selbst das nach allen historischen und internationalen Vergleichsmaßstäben erfolgreich Gegebene dekonstruieren zu müssen. Die Herrschaft einer Minderheit hat mit repräsentativer Demokratie nichts mehr zu tun. Die Parteien, die sich um die Interessen der Arbeiterschaft und des Mittelstandes bemühen, werden als ›Rechte‹ soweit wie möglich aus dem Diskurs ausgegrenzt. Ihr gemeinsames Merkmal ist – bei allen sonstigen Unterschieden – der Wille zum Schutz des Eigenen.
In den USA bäumt sich hingegen die Gesellschaft mit der Wahl von Donald Trump gegen die eigene Dekadenz auf. Die Parole ›Make America Great Again‹ bringt das Ziel einer Rückkehr zu den besseren Elementen unserer Kultur auf den Begriff. Statt um immerwährende Dekonstruktion des Alten und den Fortschritt zu Neuem, streben die konservativen Revolutionäre die Wiederherstellung einst gültiger bürgerlicher Werte an. Ihr Focus ist nicht mehr auf ›den Fortschritt‹ im Singular, sondern auf die Rekonstruktion des Bewährten gerichtet. Sie wollen das Eigene, von der mittelständischen Gesellschaft, der Souveränität des Nationalstaates bis hin zur westlichen Kultur wiederherstellen, um es dann zu bewahren.
Bei der Abkehr von globalistischen Projekten wie von WTO und dem Pariser Weltklimaabkommen, mit effektivem Grenzschutz, der Beendigung der Förderung von Regenbogenkultur an den Universitäten, einer klaren Positionierung für die israelische Zivilisation gegen die sie umbrandende Barbarei, mit Zöllen als Mittel zur Ordnung der Wirtschaft und den Versuchen zum Aufbau einer multipolaren Weltordnung ist er eine womöglich letzte Chance für den Westen.
J.D. Vance stellte bei seiner Rede in München die Frage, was die USA für einen Verbündeten noch tun könne, der nicht einmal mehr das Minimum an Demokratie gewähre, die Meinungsfreiheit. Später fügte er seine Sorge hinzu, dass ein Europa, welches sich nicht gegen die illegale Migration schütze, dem Untergang geweiht sei. Das gesamte demokratische Projekt des Westens zerfalle, wenn die Leute immer wieder weniger Migration forderten – und dafür von ihren Führungen mit noch mehr Migration ›belohnt‹ würden.
Ist denn ganz Europa verrückt geworden? Nein…
Die wichtigste Frage der Gegenwart ist, ob die Versuche zur Rekonstruktion des Westens von den USA nach Europa überspringen werden. Es ist bestürzend, wie wenige Geisteswissenschaftler – mit der rühmlichen Ausnahme vor allem von David Engels – sich der normativen Aufgabe einer Rekonstruktion der eigenen Kultur widmen. Viel lieber beteiligen sie sich etwa im Rahmen von ›Postcolonial studies‹ an den Dekonstruktionen der eigenen Kultur.
Die Selbstverleugnung des westlichen Europas wird von den Mitteleuropäern, die Jahrzehnte unter dem sowjetischen Totalitarismus einschließlich seiner internationalistischen Erlösungsphantasien leben mussten, nicht geteilt. Ob in Ostdeutschland, Polen oder Ungarn formiert sich der Widerstand. Ungarn hatte das Glück, dass sich in der langjährigen Regentschaft von Viktor Orbán diese Politik schon Ausdruck verschaffen konnte. Diese will natürlich nicht die kommunistische Zeit, sondern jene Zeiten Europas wiedererstehen lassen, in der christliche, aufklärerische und bürgerliche Ideale vorherrschend waren.
Der mit Donald Trump befreundete ungarische Ministerpräsident erfreut sich bei den durch die Inflationierung der Bildung zu ›Masseneliten‹ (Emmanuel Todd) verkommenen Politikern Europas einer durchgängig hämischen Abneigung. Beide stehen einer Politik der Auflösung von Partikularinteressen in globalen Heilskontexten entgegen. Sie halten dem zunächst noch westlichen Universalismus und späteren Globalsozialismus die Politik einer Selbstbegrenzung als Vorbedingung der Selbstbehauptung des Eigenen entgegen. Orbán war der Erste, der sich – allein auf weiter Flur – der Selbstpreisgabe eines ›weltoffenen‹ Europa 2015 mit seiner Grenzschließung gegenüber illegaler Migration offen entgegengestellte.
Als Fellow am Mathias Corvinus Collegium in Budapest konnte ich einige Monate aus nächster Nähe erleben, wie die Regierung Orbán an einer immer neuen Ausgestaltung einer schützenden Politik, mehr noch an tragfähigen Synthesen zwischen Liberalismus und Kommunitarismus und zugleich am Aufbau eines weltweiten konservativen Netzwerkes baute. Die Arbeit an der Programmatik sollte vor allem der Versuchung widerstehen helfen, sich wie die herkömmlichen Konservativen Europas von Wahl zu Wahl immer mehr dem Wunschdenken fortschrittlicher Parteien anzunähern und von den Notwendigkeiten des Bewahrens abzuwenden. Ohne diese metapolitische Ebene kann auf Dauer keine Ordnungsvision entwickelt und durchgesetzt werden.
Es war der ungarischen Regierung immer klar, dass die ›Vernunft in einem Land‹ in einer feindseligen ideologischen Umgebung Westeuropas auf Dauer nicht durchzuhalten ist. Mit der Wahl von Donald Trump kann sich das in Europa isolierte und diffamierte Ungarn rehabilitiert und gestärkt fühlen. Als nächster Schritt muss nun die Brandmauer zwischen gemäßigten und radikaleren Konservativen abgebaut werden, zwischen denjenigen, die an den Symptomen herumwerkeln und denjenigen, die auch die Ursachen der Krisen analysieren und kurieren wollen.
Rekonstruktion des Christentums
Dem Menschenbild der Globalisten zufolge sind Menschen aber nicht unterschiedlich. Ihre unterscheidbaren Identitäten sind im Laufe ihres Lebens erst konstruiert worden. Es gibt demnach keine essentiellen menschlichen Eigenschaften, womit die Herkunft des Menschen aus Nation, Ethnie, Klasse oder Religion verleugnet wird.
Die mangelnde Einsicht in die kulturprägende Rolle einer Religion erzeugt ein politisches Vakuum, in das auch feindselige Bewegungen wie selbst der Islamismus vordringen können. Die jeder Realitätstüchtigkeit enthobene Migrations- und Klimapolitik lässt sich als Perversion der Nächstenliebe durch demonstrative Fernstenliebe verstehen. Mit der freien Geschlechtswahl will sich der Mensch vom Geschöpf Gottes zum Selbstschöpfer erheben.
Die Rekonstruktion des Westens beginnt beim Christentum. Orbán musste im Kommunismus aufwachsen und Trumps Lebensführung ist gewiss nicht von Frömmigkeit geprägt. Dennoch kamen beide zu der Einsicht, dass der Westen ohne seine zweitausendjährige kulturelle Basis des Christentums nur noch eine Himmelsrichtung wäre.
Dem christlichen Menschenbild zufolge sind Menschen zwar gleich vor Gott, aber aufgrund ihrer Erbsündigkeit bedürfen sie einer Hierarchie und einer Ordnung der Freiheit. Selbst eine Ordnung der Liebe ist notwendig, wenn es nicht zu der Vertauschung der Nächsten- durch die Fernstenliebe kommen soll.
Die Fähigkeit zur Unterscheidung ist das Minimum dessen, was wir zur Bewältigung von Problemen benötigen. Unseren Kulturrelativisten ist schon die Fähigkeit zur Unterscheidung von Islam und Christentum abhandengekommen. Während die Europäische Union unter der Führung Annalena Baerbocks begeistert die neue islamistische Regierung Syriens unterstützt, spendet Ungarn fünf Millionen Euro an die Syrischen Christen. Ungarn ist das einzige westliche Land, welches sich die Hilfe für bedrängte Christen zur Staatsaufgabe gemacht hat.
Orbán spricht in Bezug auf Ungarn von einer ›christlichen Demokratie‹, die die Werte des Christentums, von Freiheit und Menschenrechten vertritt. An der leitkulturellen Rolle des Christentums lässt er keinen Zweifel. Christen glaubten an den freien Willen des Menschen, sie hätten einen moralischen Kompass und wären immun gegen dekonstruktivistische und neomarxistische Ideologien. Ein großer Vorteil christlich fundierter Politik sei die Selbstprüfung des Menschen vor Gott. Europas Erfolge entstammten dem Geist der ständigen Selbstreflexion.
Die Christliche Soziallehre schlägt sich in Ungarn auch in der Verbindung von personaler Verantwortung, gegenseitiger Solidarität und Subsidiarität nieder. In der ungarischen Sozialpolitik gilt die Devise: ›Sozial ist, was Arbeit schafft.‹ Sozialhilfe wird in Ungarn nur bei Gegenleistungen gewährt und trägt eher zur gesellschaftlichen Integration bei als ein voraussetzungsloses ›Bürgergeld‹. Einer kommunitarischen Sozialpolitik zufolge gelten Individuen als Mitglieder von Gemeinschaften und einer konservativen Kulturpolitik gilt die Nation als die größte Identitäts- und Wertegemeinschaft. Der Gemeinwohlbegriff setzt die Existenz einer umgrenzten Gemeinschaft voraus, die in der Regel über lange Zeiträume gewachsen ist und gepflegt werden muss.
Ohne eine Hierarchie des Guten, wie sie das Subsidiaritätsprinzip der Christlichen Soziallehre postuliert, endet Idealismus in Naivität gegenüber dem Fernen und in Verachtung des Nächsten. Der zum Katholizismus konvertierte US-Vizepräsident J. D. Vance erklärt die christliche Ordnung der Nächstenliebe (›Ordo amoris‹) wieder zum Leitbild westlicher Politik. Es gelte, zuerst die Aufmerksamkeit auf das Gedeihen der kleineren Einheiten – von der Familie bis zum eigenen Staat – zu richten und erst danach den Blick auf weitere Kreise und dann auf die Globalität der Welt zu werfen.
Donald Trump: Selbstbehauptung durch Selbstbegrenzung
Trump verortet die gefährlichste Feindschaft gegen den Westen nicht bei autoritären Regimen, mit denen wir koexistieren können, sondern beim totalitären Islamismus, den wir eindämmen müssen. China ist tendenziell totalitär und wird von Trump deshalb auch als viel gefährlicher eingeschätzt als Russland. Die Unterscheidung zwischen Autoritarismus und Totalitarismus rekonstruiert die erfolgreiche westliche Politik im Kalten Krieg, die mit autoritären Mächten paktierte, um die totalitären Regime einzudämmen.
Sie untermauert seine unzweideutige Unterstützung Israels im Kampf gegen den islamischen Totalitarismus von Hamas, Hisbollah und dem Iran. Mittels der Abraham-Accords soll eine Kooperation zwischen autoritären arabischen Staaten und Israel zustandekommen. An der Unterscheidung von Islam und Islamismus muss schon deshalb festgehalten werden, weil sie einer Unterscheidung nach Autoritarismus und Totalitarismus entspricht und damit einem ›Teile und Herrsche‹ im Nahen Osten entgegenkommt.
Innenpolitisch bedeutet diese Haltung eine restriktive Einwanderungspolitik gegenüber Muslimen, die immerzu in Gefahr sind, ihrerseits von Islamisten dominiert zu werden. Und schließlich findet sie Ausdruck im Kampf gegen den woken Totalitarismus der Moralisten und Globalisten an amerikanischen Hochschulen, denen die Unterstützungsgelder des Bundes entzogen werden.
Jene Europäer, die Assad bekämpften und das neue islamistische Regime in Syrien hofieren, scheinen den Unterschied zwischen Autoritarismus und Totalitarismus nicht zu kennen. Nur daraus sind auch ihre moralisierenden Anbiederungen an die Hamas-Mörder und die permanente Kritik an Israel zu erklären.
Rekonstruiert werden muss auch die Säkularität des Westens. Wie einst eine Trennung von Kirche und Staat die Grundlage für die ausdifferenzierte Moderne des Westens war, so brauchen wir heute eine neue Trennung zwischen schwärmerischer Ersatzreligiosität und Realpolitik. Generell wird der Westen das Denken in kulturellen Kategorien wieder lernen müssen.
Sicherlich ist Donald Trump nach den korrekten Kriterien aller linken Spießbürger ein schräger Vogel. Anderenfalls hätte er sich auch nicht zugleich mit dem Zeitgeist und dem Mainstream, mit der Journaille und dem Deep State anlegen können und sich der Gefahr von geschäftlichem Ruin und Attentaten ausgesetzt. Trump schwankte zwischen der Demonstration von Stärke und der Ausübung von Vorsicht – er schuf Unsicherheit für seine Gegner, während er sich selbst Flexibilität bewahrte. Dieser Spagat ist nicht immer gut anzuschauen, aber er spiegelt konsequent seine Vorliebe wider, sich mehrere Optionen offen zu halten, anstatt sich auf starre ideologische Positionen festzulegen.
Im Grunde folgt Trump seit Jahrzehnten einer einfachen, aber grundlegenden Einsicht. Der Westen – der nur circa ein Achtel der Weltbevölkerung ausmacht – kann nicht länger die Welthegemonie anstreben und muss seine Macht mit anderen Großmächten in einer multipolaren Weltordnung teilen. Der Westen muss sich vor allem auf sich selbst begrenzen. Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass er seinen Wohlstand nicht mit dem Rest der Welt teilen kann. Die wahnhafte Grenzenlosigkeit der eigenen Staatenwelt sollte einer Begrenzung auf die eigenen Einflusssphären und dem Schutz durch kontrollfähige Grenzen weichen. Umgesetzt wird diese Überzeugung im Einsatz des Militärs zum Schutz der Grenzen zu Mexiko. Für was sollte Militär sinnvoller einsetzbar sein als zum Schutz der eigenen Grenzen.
Die unterschiedlichen Antriebe innerhalb der Republikanischen Partei können nur von einer charismatischen Person zusammengefügt werden. Einig sind sich diese nämlich nur darin, den selbstauflösenden Dekonstruktivismus in die Schranken zu weisen. Trump muss mindestens zwei widerstreitende Positionen zusammenbinden, die Libertären wie etwa Elon Musk, die aus naheliegendem Eigeninteresse auf den alten Freihandel setzen und die Kulturkonservativen im Umfeld des Vizepräsidenten J.D. Vance.
Trump schwankt – so Michael Doran – zwischen Restraintisten (übersetzt: etwa Zurücknehmern) und Falken – nicht aus Verwirrung, sondern mit Absicht. Er will die amerikanische Macht nutzen und gleichzeitig Verwicklungen vermeiden, indem er zwischen Machtdemonstrationen und diplomatischen Ansätzen hin und her schwankt. Rhetorisch schießt er schon einmal weit über das Ziel hinaus, bleibt aber im Handeln meist vorsichtig.
Sein strategischer Zickzackkurs ist die Strategie des maximalen Drucks bei minimalem militärischem Fußabdruck. Er will nicht in Kriege hineingezogen werden, die Amerika unweigerlich schaden, nur um die Interessen korrupter Cliquen zu fördern. Die Strategie soll Unsicherheit für die Gegner und Flexibilität für die Vereinigten Staaten und ihm mehrere Möglichkeiten schaffen, amerikanische Interessen durchzusetzen.
Indem er in seiner Regierung bewusst gegensätzliche Standpunkte gegeneinander austragen lässt, will Trump die Kontrolle über die endgültige Entscheidung behalten. Das Oszillieren ermöglicht, Wählergruppen mit auseinander liegenden Ansichten anzusprechen. Idealerweise könnte diese Dialektik des Zick-Zacks in neue Gegenseitigkeiten von liberalen und kommunitarischen, von globalen und nationalen Perspektiven münden.
Trumps Wirtschaftsnationalismus will das Gute nicht mehr in alle Welt verteilen, sondern es zu sich ziehen. Ziel ist nicht eine fiktive Universalität westlicher Werte, sondern die Konzentration auf eigene Interessen, die erst eine unideologische Koexistenz mit anderen Kulturen und konkurrierenden Mächten ermöglicht. Statt einer Politik der Universalität westlicher Werte bedeutet dies eine Anerkennung von Verschiedenheiten in einer multipolaren Welt und damit auch den Abschied von einem moralistischen Gut und Böse.
Der defensive Charakter dieses Nationalismus unterscheidet sich wesentlich von einem aggressiven imperialen Nationalismus, der andere Nationen ausplündern oder missionieren will. Trump ist Nichtinterventionist. Von daher stand er auch dem Treiben der USA in der Ukraine skeptisch gegenüber. Allerdings hat er in seiner ersten Amtszeit die Versuche der USA, die Ukraine auf ihre Seite zu ziehen, nicht konsequent beendet.
Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist moralisch unentschuldbar, geopolitisch aber leicht erklärbar. Die kulturellen Grenzen Europas, zwischen West-Christentum und Ost-Christentum, verlaufen mitten durch die Ukraine. Eine Teilung Europas zwischen den sich letztlich um diese Linien gruppierenden Machtsphären wird unvermeidlich sein. Diese Einsicht müsste überleiten zu der Beachtung einer viel bedeutsameren und zu schützenden Kulturgrenze gegenüber dem religiösen Totalitarismus, der Europa weitaus mehr gefährdet als das autoritäre, aber lediglich auf seine Stabilität bedachte Russland.
Angesichts dieser kulturellen Grenzen war die bewusste Entneutralisierung der Ukraine durch die USA und die ukrainischen Nationalisten eine Zerstörung der Weltordnung. Ein Blick auf die Landkarte wäre wichtiger gewesen als ins Völkerrecht. Obwohl etwa die deutschen Grünen, eine Art Speerspitze gesinnungsethischen Eiferertums, noch 2021 mit dem Kinderreim ›Frieden schaffen ohne Waffen‹ in den Wahlkampf gezogen waren, wurden sie zu den eifrigsten Unterstützern der ukrainischen Nationalisten und der USA. Sie plädieren bis heute für einen westlich-ukrainischen Endsieg gegenüber der Atommacht Russland.
Ein Verantwortungsethiker, der auch die Folgen seines Handelns bedenkt, wird weder ohne Waffen leben noch Russland ruinieren wollen. In einer weit mehr multipolaren als multilateralen Welt erleben wir eine Rückkehr der Geopolitik, die auf die Geographie als kaum änderbare Realität Rücksicht nimmt. Diese Realpolitik unterstellt dem Gegner keinen Wahnsinn, sondern versucht, sich in dessen Ziele hineinzudenken. Sie respektiert Einflusssphären und notwendige Grenzziehungen.
Trump scheint eine Teilung der Ukraine und damit das Minimum für einen Waffenstillstand anzustreben. Mit Gerechtigkeit hat dies – wie bei den meisten Geschehen in den internationalen Beziehungen – nichts zu tun. Auch die Kriege in Korea und Zypern konnten nur durch Teilung – zwar nicht durch einen ›Gerechten Frieden‹, aber immerhin durch einen dauerhaften Waffenstillstand – beendet werden. Die Einflusssphäre der Großmacht Russland müsste in ähnlicher Weise respektiert werden wie die der USA im mittelamerikanischen Raum und in Westeuropa.
Auge um Auge. Trumps Prinzip Gegenseitigkeit in der Zollpolitik
Trump hat als Geschäftsmann eine andere Erkenntnistheorie als die in der Politik geläufige. Er dealt um Vorteile, so dass es naiv wäre, seine Aufrufe wörtlich zu nehmen. Seine Maximalforderungen sind als Auftakt von Verhandlungen gedacht.
Zölle schaden dem Freihandel und damit den unmittelbaren Vorteilen des weltweiten Wettbewerbs. Der Freihandel ist aber weit mehr eine westliche Ideologie als eine globale Realität. Alle Staaten schützen auf unterschiedlichen Wegen ihre Klientel vor Wettbewerb auf freien Märkten. Die hochsubventionierte Exportindustrie und die nichttarifären Handelshemmnisse in China sind das Gegenteil von fairem Handel und haben den amerikanischen Mittelstand in den Abgrund geführt. Die sozialen Zustände in den USA können unmöglich als Argument für den globalisierten Freihandel gelten.
Die Dekonstruktion der Industriearbeiterschaft im Mittleren Westen der USA hat J. D. Vance in seinem Buch Hillbilly Elegie beschrieben. Für die Global Player der USA war die Globalisierung ein gutes Geschäft, für viele Local Player blieben als Vorteil nur billige Konsumgüter. Die alte Mittelschicht wurde auf diese Weise materiell und ideell untergraben.
Aber ist denn Wachstum das wichtigste Ziel des Wirtschaftens? Sollte diese nicht weit mehr an ihrer Ordnungsleistung für die Gesellschaft und der Selbstbehauptungsfähigkeit des Staates gemessen werden? Trumps auch hier ausprobierte disruptive Methode, zuerst maximale Forderungen in den Raum zu werfen, haben 75 Staaten dazu veranlasst, sich umgehend zu Verhandlungen in Washington anzumelden.
Gewiss handelt es sich bei Trumps Zöllen um eine Operation am offenen Herzen der Weltwirtschaft. Der Streit muss darüber geführt werden, ob diese Operation notwendig ist. Durch die bevorstehenden Zollverhandlungen mit den USA ist die EU gezwungen, ihre eigene Verlogenheit auf den Prüfstand zu stellen. Indem sie mit der Überprüfung der Lieferketten alle nichteuropäischen Produkte ihren sozialen und ökologischen Maßstäben unterwirft, betreibt sie eine moralisch und ökologisch verbrämte Zollpolitik. Die Umwandlung eines wilden Welthandels in einen faireren Handel ist einen Versuch wert. Das Prinzip Gegenseitigkeit ist dafür eine geeignete regulative Idee.
Make Europe Great Again?
Den Versuch Trumps, den Ukrainekrieg im Alleingang zu beenden, empfanden die Bellizisten Europas als Verrat. Sie fühlen sich um ihr manichäisches Weltbild betrogen, bei dem Gut gegen Böse, Demokratie gegen Diktatur stehen und daher keine Kompromisse erlaubt sind. Sie verstärken ihren bellizistischen Moralismus, indem sie die ausbleibende Hilfe der USA zu ersetzen versprechen. Sie wollen den ›Gerechten Krieg‹ im Alleingang bis zum Endsieg fortsetzen.
Donald Trumps Politik zwingt die Europäer, für sich selbst mehr Verantwortung zu übernehmen. Die Europäische Union sollte aber nur nach außen stärker werden und umgekehrt nach innen weitaus mehr Dezentralität und Vielfalt gewähren. Für die Stärke nach außen wäre vor allem ein gemeinsames Kommando gefordert.
Die Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit liegt jedoch in weiter Ferne. Bis dahin wären die Europäer gut beraten, ihre Stärkung nicht gegen die USA, sondern im Rahmen des Nato-Bündnisses zu suchen. In diesen Abstimmungsprozessen wird Viktor Orbán eine zentrale Vermittlerrolle zukommen. Seit langem kämpft er für neue Mehrheiten in den alten westlichen Bündnissen. Ein Austritt aus der Europäischen Union oder der Nato sei – so Orbán – nur für eine kleine Minderheit eine attraktive Option. Das amerikanische Bündnis werde nur ein kleiner Teil der Europäer aufgeben wollen, solange das Machtvakuum nicht aus eigenen Kräften gefüllt werden kann. Solange die Europäer nicht selbstverteidigungsfähig sind, müssen sie sogar für eine Vasallenrolle zu den USA dankbar sein. Solange sie nicht einmal ihre eigenen Grenzen schützen, können sie keinen Anspruch auf Souveränität erheben.
Hinsichtlich des größten ideologischen Konflikts unserer Zeit, dem zwischen Globalismus und Rekonstruktion des Eigenen, sollten sie bei Orbán und Trump in die Lehre gehen. Diese arbeiten sich angesichts der Dialektik der Weltoffenheit an der Suche nach Synthesen von Freiheit und Ordnung ab. Die globalen Prozesse in Wissenschaft, Technik und Ökonomie bedürfen einerseits dezentralerer politischer Strukturen wie vor allem souveräner Nationalstaaten. Andererseits erfordern sie die Konnektivität in Wissenschaft, Technik und Ökonomie und weltweite Netzwerke, die diese Konnektivität zu ordnen versuchen. Deren meist nationalstaatliche Knoten müssten auch im Sinne der Netzwerke gestärkt und gefestigt werden.
Die Zukunft des Westens liegt im Aufbau solcher Synthesen. Dies erfordert zuerst die Rekonstruktion des freien Denkens in einer offenen Gesellschaft, zurück zum dialektischen Denken und zur Ausdifferenzierung der Funktionssysteme, die in der Vielfalt ihrer Eigenlogiken die Stärken unserer Kultur begründet hatten. Der Westen braucht demnach nicht immer neue ›Innovationen‹, sondern Rückschritte zu den Stärken der eigenen Kultur.
Die Hoffnung auf die Rekonstruktion von Werten und Strukturen ist keine rückwärtsgewandte Utopie, wenn es sich bei ihnen um zeitlos gültige Werte und Strukturen handelt. Mit deren Wiederaufbau hat Europa den Dreißigjährigen Krieg und zwei Weltkriege überstanden und trotz allem jeweils neuen Halt und zu neuer Entwicklung gefunden. Spanien war 781 Jahre von Muslimen besetzt und wurde doch wieder eine christliche und später auch eine demokratische Nation.
Die amerikanische Kultur lässt sich nicht von der europäischen trennen. Sie ist letztlich in vielerlei Hinsicht ein Produkt europäischer Philosophie, Theologie und natürlich der Migrationsbewegungen, die aus Europa kamen und zur Entstehung der Vereinigten Staaten von Amerika führten. Dem von seiner Vergangenheit entfremdeten und geistig-moralisch verwahrlosten West-Europa bleibt derzeit vor allem die Hoffnung, dass aus den USA immer noch Gutes – und Schlechtes – nach Europa übergeschwappt ist. Danach könnte auch Europa Anlauf nehmen zum Sprung von der Dekonstruktion zu neuer Rekonstruktion.