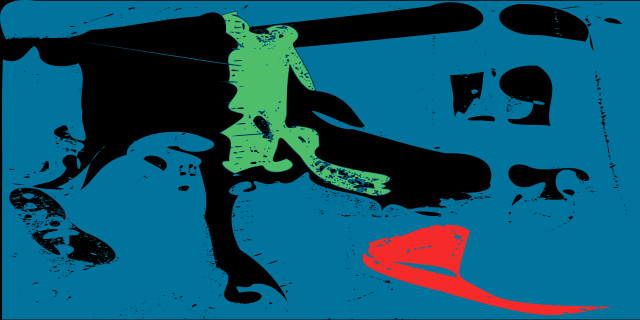von Heinz Theisen
Mit der Niederlage in Afghanistan sind der kulturelle Universalismus und der politische Globalismus des Westens ans Ende gekommen. Statt utopischer Visionen würde eine neue Strategie der Abgrenzung und Koexistenz gebraucht, mit der es dem Westen vor allem um seinen eigenen Schutz gehen müsste.
Der auch mit dem Universalismus westlicher Werte begründete Interventionismus ist in Afghanistan an seinen Illusionen über dem Islam gescheitert. Nach zwanzig Jahren vergeblichen Einsatzes steht der Westen aufgrund seiner Substanzverluste und seiner schmählichen Kapitulation sicherheitspolitisch schlechter da als im Jahr 2001. Der entfesselte Islam hat einen historischen Sieg über den Westen errungen. Er wird uns in Zukunft noch mehr gefährden als bisher.
In dieser Lage ist ein grundlegender Strategiewechsel erforderlich: Die Selbstbehauptung des Westens erfordert seine Selbstbegrenzung, und mehr noch, oft sogar strikte Abgrenzung gegenüber feindseligen Kräften. Aufgrund seiner schon lange verlorenen Hegemonie muss der Westen von den Phantasien über Globalität zur Einbettung in die Realitäten einer allein noch möglich multipolaren Weltordnung übergehen. Die Zeit der Offensiven ist vorbei, die der Defensive beginnt.
Der Übermut, in einem fremden Kulturkreis westliche Strukturen aufbauen zu können, entstammt der Naivität einer Entwicklungsideologie, die keine Unterschiede zwischen den Kulturen in Rechnung stellt. Umgekehrt hätten die versenkten Geldsummen innerhalb der westlichen Welt uns sozial, bildungs- und strukturpolitisch an vielen Orten erst wieder in einen vorzeigbaren Zustand versetzen können. Gegenüber den Taliban oder anderen Islamisten wäre eine rigide Abgrenzung von deren Gebieten nebst wirtschaftlicher Eindämmung und zur Not auch Schlägen aus der Luft die angemessene Antwort gewesen.
Nachdem der Westen durch seine Misserfolge im Nahen Osten und auch die inneren Attacken gegen ›Postkolonialismus‹ und ›Whiteness‹ immer mehr in die Defensive geraten war, besann er sich nicht etwa auf seine kulturellen und politischen Grenzen, sondern flüchtete sich nach vorn in die Utopie von der ›Einen-Menschheit‹. Dieses neue, kaum je dagewesene Denken wurde sowohl mit humanitären als auch mit radikal-liberalen Ansichten über Weltoffenheit und freihändlerisches Win-win befeuert.
Im humanitären Globalismus stehen bei Entwicklung, Klima und Migration nicht mehr eigene, sondern globale Interessen im Vordergrund. Die Notwendigkeit einer Selbstbehauptung von Gesellschaft, Staat und Kultur galten demgegenüber als irrelevant, oft sogar als kontraproduktiv für die globale Entwicklung. Bei dieser Verleugnung des Eigenen zugunsten der ›Einen-Menschheit‹ handelt es sich um eine spezifisch westliche Idee, die andere Kulturen nicht teilen, aber auszunutzen verstehen. Dieser Globalismus bedeutete die ultimative Entgrenzung unserer Möglichkeiten, über die jedes Problem auf der Welt zu unserem Problem wird.
Illusion Universalität und Globalität
Der westliche Universalismus glaubte nach dem Zusammenbruch des Sowjetsystems freie Fahrt zu haben. Ihm galten Einflusssphären anderer Mächte und Kulturen als völkerrechtswidrig, vorgestrig und unmoralisch. Aus russischer (ähnlich aus chinesischer) Perspektive ist die Nichtanerkennung ihrer Einflusssphären gleichbedeutend mit dem westlichen Streben, die ganze Welt als eigene Einflusssphäre zu betrachten.
Der Westen hat Russland nach 1991 zunächst umworben (bis hin zu einem möglichen Angebot von Nato-Mitgliedschaft), dies aber an die Erfüllung seiner Bedingungen gebunden. Die Demokratisierungsbestrebungen in der Ukraine stellten schließlich das System Putin selbst in Frage. Deshalb zog dieser nach der Orangenen Revolution in Kiew 2007 die Reißleine und warf dem Westen den Fehdehandschuh hin.
Das System Putin ist gewiss nicht mit westlichen Maßstäben kompatibel und daher in vielerlei Hinsicht verurteilenswert. Die Anmaßung des Westens besteht darin, Anspruch auf westliche Maßstäbe für Russland zu erheben. Dieser Illusion der eigenen Universalität und einer daraus möglich werdenden Globalität treibt unterschiedliche Systeme zwangsläufig in die Gegnerschaft. Wer statt des kleineren Übels die Wesensgleichheiten des Universalismus verlangt, wird Sturm ernten.
Unterschiedliche Systeme können sich nicht integrieren, sondern nur koexistieren. Mit dieser minimalistischen Lösung hätte sich der Westen schon deshalb zufrieden geben sollen, weil er das autoritäre Russland nicht für eine Wertegemeinschaft, sondern als Sicherheitspartner gegenüber den Herausfordererkulturen Islam und China benötigt hätte.
Dem Verlust des Sinns für das kleinere Übel liegt ein Fortschrittsoptimismus zugrunde, der Naivitäten jeder Art begünstigt. Auch die mangelnde Unterscheidung zwischen autoritären Mächten und totalitären Bewegungen ging mit ihm dahin. Im Lichte von Universalität und Globalität wurde Vielfalt nur scheinbar gewürdigt, denn in Wirklichkeit geht es ihnen nicht um Unterschiedlichkeit, sondern um Gleichheit in der Vielfalt. Der Multikulturalismus beruht auf der Annahme einer Gleichwertigkeit der Kulturen.
Illusion Interkulturalität
Mit der Globalisierung wurde das Weltgeschehen keineswegs ›flach‹ (Thomas Friedmann). Der direkte Zusammenprall und Vergleich machte die Inkompatibilitäten und Konflikte zwischen den Kulturen oft umso deutlicher. Der weltweite ökonomische Wettbewerb trieb das Bedürfnis nach kulturellen Identitäten und politischer Souveränität der Nationen umso mehr hervor.
Islamistische Erzählungen sind attraktive Motive für die Verlierer der Moderne und gewannen parallel zu globalen Modernisierungsprozessen an Bedeutung. Für Gewinner wie für Verlierer bleibt der Westen der Maßstab. Es gilt als religiöse Pflicht, ihn auf dem eigenen Territorium zu bekämpfen und bei Gelegenheit zu erobern. Die Behauptung, der Islamismus habe nichts mit dem Islam zu tun, ist ähnlich sinnvoll wie die, dass der Stalinismus nichts mit Marxismus zu tun habe. Sie verhindert eine kritische Auseinandersetzung mit den religiösen Wurzeln der politischen Ansprüche.
Die Demokratisierung Afghanistans und des Irak sowie die Zerstörung Libyens haben zwar Despotien beseitigt, zugleich aber Anarchie und inneren Kriegen den Weg geebnet. Im Syrienkrieg offenbarte sich die ganze strategische Ratlosigkeit des Westens als dieser nicht einmal mehr wusste, ob er vorrangig die säkulare Despotie Assads oder den noch schrecklicheren ›Islamischen Staat‹ in der Levante bekämpfen sollte. In der Türkei dienten gerade freie Wahlen dem lange verdeckt operierenden Muslimbruder Erdogan dazu, die autoritär durchgesetzte Laizität des Kemalismus Schritt für Schritt rückgängig zu machen. Da er seine Machtergreifung mit formaldemokratischen Mitteln betrieb, mussten ihm die Bündnispartner aus der NATO-Wertegemeinschaft dabei auch noch zustimmen.
Im weltweiten Wettbewerb schneidet die islamische Kultur schlecht ab. Die Schuld wird in der Bosheit des ungläubigen, aber zugleich technisch und ökonomisch überlegenen Westens gesucht. Die Regression in die eigene Vergangenheit ist eine Fortsetzung dieser Realitätsflucht. Der Islamismus wird als Trostideologie der Verlierer bedeutsam bleiben. Sein Terror fordert jährlich 20 000 bis 30 000 Tote, die meisten in der islamischen Welt.
Der Islam hat als Religion ein autoritäres, hierarchisches und patriarchales Weltverständnis. Mit dem westlichen Fortschrittsdenken ist die Kismet-Lehre von der Vorherbestimmtheit des Menschen nicht vereinbar. Ein göttlicher Schöpfungsauftrag an den Menschen ist dem Islam fremd und die Wortgläubigkeit des Korans steht dem aufklärerischen Impetus des Selbstdenkens entgegen.
Islam bedeutet ›Hingabe, Unterwerfung‹. Der Mensch hat sich der Allmacht und damit der Freiheit Gottes zu fügen. Menschenrechte sind von Gott gewährt, während sie im westlichen Verständnis dem Menschen Kraft seiner Humanität und von Natur aus zustehen. Vom staatlichen Gewaltmonopol und von der Teilung der Gewalten weiß der Islam wenig. Anders als im Christentum ist die Religion im Islam nicht Teil des Lebens, sondern das Leben selbst. Schon der Gedanke einer Trennung von Staat und Kirche ist im Islam sinnlos, weil es keine zwei Größen gibt, die sich dergestalt trennen ließen.
Mohammeds Auszug aus Mekka nach Medina war mit der Entscheidung verknüpft, neben der Religion auch einen Staat zu gründen. Mit der Hidschra wurde der Islam neben einer religiös-geistlichen zugleich zur politischen Gemeinschaft. Jeder Mensch hat das Recht, den Islam anzunehmen oder nicht. Doch wer einmal Muslim ist, der muss es für immer bleiben. Religiöse Abtrünnigkeit wird mit politischem Verrat gleichgesetzt. Rechtfertigung dafür liefert die theologische Vorstellung, dass die Einheit und Unteilbarkeit Gottes in der Einheit und Unteilbarkeit der Umma Ausdruck findet.
Mohammed hatte es seinen Anhängern freigestellt, ob sie ihren Glauben mit dem Herzen, mit Worten oder mit Taten verteidigen wollen. Radikale Muslime greifen zu den Waffen, diejenigen, die sich mit dem Herzen oder mit Worten anstrengen, haben allenfalls taktische Argumente, den militanten Kriegern einen Missbrauch des Islam vorzuwerfen und so wehrt sich die schweigende Mehrheit auch heute nicht gegen religiös motivierte Gewalt.
Chaim Noll erklärt den Islam aus den nomadischen Lebensbedingungen der arabischen Wüste. Hier sei nicht das Verhältnis zu Land und Landschaft entscheidend, wie bei Sesshaften, sondern die sich darin bewegenden Größen, seien es Menschen oder Tiere. Das Lebensgefühl der Nomaden sei ein Gefühl ständigen Mangels, welches eine Überlebensstrategie der schnellen kämpferischen Aktion erfordere.
Oft sei nur eine vorübergehende Aneignung von fremden Land möglich. Die ständigen Kämpfe um Wasserstellen und Weideflächen erzeugten eine ständig gefühlte Bedürftigkeit. Die Pflicht zur Blutrache komme hinzu. Sie werde überliefert im Brauch der Väter: genannt Sunna. Freiheit meine nicht die Freiheit des Einzelnen, sondern die Bewegungsfreiheit des Stammes in der Wüste.
Afghanistan als finales west-östliches Desaster
Die auch in Afghanistan vorausgesetzte Universalisierbarkeit von Säkularität, Nationalstaatlichkeit, Demokratie und ausdifferenzierten Gesellschaften hätte nicht weltfremder sein können. Wie wenig säkulare und integristische Kulturen miteinander kompatibel sind, zeigte sich schlaglichtartig als 2002 – nach der Befreiung von den Taliban – das frei gewählte Parlament Afghanistans die Scharia zur Grundlage jeder weiteren Gesetzgebung erhob.
Im Nahen Osten hat der Westen – schon seit der gescheiterten Invasion Napoleons – allenfalls wirtschaftlich, aber weder politisch noch kulturell viel zu gewinnen gehabt. Die Implantation des Nationalstaates trug in den Stammeskulturen der Levante keine guten Früchte. Mit den Versuchen im 21. Jahrhundert, in dieses Haifischbecken auch noch demokratische Strukturen zu implantieren, wurden die inneren Konflikte erst recht entfesselt.
Die militärischen Interventionen des Westens zu Beginn des 21. Jahrhunderts haben die Instabilitäten des Orients nicht beenden können, sondern vorangetrieben. Die Beseitigung blutrünstiger Diktatoren wie Saddam Hussein rief die Anarchie und danach den totalitären Islamismus herbei.
Selbstverständlich sind wirtschaftliche Interessen mit religiösen Bruchlinien verstrickt. Auch im Orient lebt der Mensch nicht vom Glauben allein. Die Kulturkämpfe potenzieren sich mit politischen Machtansprüchen und wirtschaftlichen Interessen. Selbst wenn die Religion nicht das wirkliche Hauptmotiv sein mag, lassen sich die Massen entlang ihrer Bruchlinien mobilisieren. Mit den religiösen Versprechen für todesmutige Krieger kann keine politische Ideologie konkurrieren.
Je mehr der Westen sich in Afghanistan engagierte, desto mehr – ähnlich übrigens wie in Südvietnam – meinten korrupte Warlords und auch andere Afghanen ihren Geschäften nachgehen zu können, nicht zuletzt dem Drogenanbau und Drogenhandel. Sie identifizierten sich nicht mit dem neuen System, sondern nahmen westliche Hilfe wie eine Art Besatzungssteuer entgegen. Statt für ihre Freiheit und Entwicklung zu kämpfen, flohen junge Männer nach Europa in die Länder, die ihre Soldaten und Soldatinnen für Afghanistan in den Krieg schickten.
Nach dem Zusammenbruch dieser seltsamen, ans Absurde grenzenden Arbeitsteilung werden noch mehr Afghanen nach Europa strömen und um Asyl in Demokratien nachsuchen. Demokratie, für die sie im eigenen Staat nicht zu kämpfen bereit waren.
Heute muss sich der Westen vor dem islamischen Universalismus schützen
Der Koran steht mit seinen Kriegsgeboten gegenüber Ungläubigen dem universellen Liebesgebot des Neuen Testaments diametral entgegen. Da er in seiner Substanz nicht ausgelegt werden darf, steht er auch freiem Denken entgegen. Der sich radikalisierende Islam steht der Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Funktionssysteme und dem radikalen Pluralismus der postmodernen westlichen Kultur stärker entgegen denn je. Ihre kriminellen Ränder tragen bereits an entlegenen Ecken der Welt, weit jenseits des west-östlichen Nukleus des Konflikts – in Neuseeland und Sri Lanka – den Kampf für die Universalität ihres Glaubens voran.
Der islamische Universalismus unterteilt die Welt nach dem Islam und den Ungläubigen. Die Geschichte habe die völlige Bekehrung der Menschheit zum Ziel, für eine Eigenständigkeit Europas lässt diese Wahrnehmung keinen Raum. Die Übergänge von Islam und Islamismus sind fließend. Die Verschränkung von Religion und Politik schreitet weiter voran. In den meisten der 47 Staaten mit islamischer Mehrheitsbevölkerung gilt die Scharia und selbst, wo sie keine offizielle Rechtsquelle ist, treten Mehrheiten für die Scharia als geltendem Recht ein.
In den Betrachtungen über die Dekadenz des Westens taucht zunehmend die Frage auf, ob dieser sich denn zumindest selbst noch verteidigen könne und wolle. Beispiele wie der in diesen Tagen innerhalb kürzester Zeit erfolgte Zusammenbruch des afghanischen Staates (der seinen Feinden militärisch überlegen war) oder auch der Zusammenbruch des kommunistischen Herrschaftsbereichs 1989 zeigen, wie rasch sich gesellschaftliche Zusammenbrüche vollziehen können, wenn nicht mehr hinreichend Menschen vorhanden sind, die dazu bereit sind, ein Gemeinwesen und seine Ordnung zu verteidigen oder an ihnen unter Druck festzuhalten. Henrik Broder hat einmal geunkt, dass Europa entweder als Kolonie Chinas oder als Kalifat enden werde. Nach dem Sturz des Westens aus Afghanistan sieht es eher nach letzterem aus.
Wer könnte uns denn noch verteidigen? Zunächst einmal ein Bürgertum, welches überhaupt dazu bereit ist und sich nicht sich in lächerlichen Problemchen wie Gendersternen ergeht. Nach Afghanistan ist klar, dass wir uns nicht länger auf die USA allein verlassen sollten. Sowohl die Nationalstaaten als auch die EU werden zeigen müssen, dass sie selbst zur Verteidigung der Freiheit nach außen und noch aktueller und drängender, nach innen bereit sind.
Angesichts all der gescheiterten supranationalen und interkulturellen Utopien sind die Bestrebungen des Rückzugs auf den überschaubaren Nationalstaat verständlich, aber gleichwohl wäre er als alleiniger Akteur völlig überfordert. Zwischen utopischer Globalität und regressiver Nationalität sind über ihn hinaus vielmehr die mittleren Ebenen der westlichen Bündnisse, sind EU und Nato gefordert.
Ein ›Europas, das schützt‹ (E. Macron) würde sich nicht in nationale Wagenburgen verschanzen. Die USA, China und Russland sind zu imperialem Handeln und damit zur nationalen Selbstbehauptung in der Lage, Dänemark und Deutschland sind es nicht. Auch könnte das in Nebenthemen geistig heruntergewirtschaftete Deutschland von seinen Nachbarländern nur noch profitieren. In Frankreich und Schweden haben auch liberale Regierungen bemerkt, dass es sich beim Islam um eine Erobererreligion handelt.
Der Nationalstaat bleibt aber der wichtigste Baustein zur Problembewältigung, auch in den internationalen oder globalen Organisationen. Aber Bausteine bilden noch keine Gebäude. In der neuen Strategie der ›Selbstbehauptung durch Selbstbegrenzung‹ müsste es zu einer abgestuften und sich ergänzenden Zusammenarbeit zwischen Nationalstaat, EU und Nato kommen. Denn nur mittels dieser sich gegenseitig ergänzenden Abstufungen kann noch dem islamischem Revanchismus, dem Bevölkerungsdruck Afrikas und dem chinesischen Dominanzstreben erfolgreich entgegengetreten werden.
Die Skepsis gegenüber der derzeitigen Europäischen Union ist berechtigt, vor allem wenn sie wie bei Migration und Grenze auch noch den Selbstschutz der Nationalstaaten unterminiert, ohne selbst ausreichenden Schutz zu bieten. Eine neu konzipierte konföderierte Union würde hingegen der inneren Vielfalt und nationalstaatlichen Souveränität besser gerecht und könnte sich auf die defensive Selbstbehauptung gegenüber äußeren und inneren Feinden konzentrieren. Die Strukturen der Schweiz wären hier vorbildlicher als der Zentralismus Frankreichs.
Europas Vorfeldsicherung beginnt in Zukunft nicht am Hindukusch oder auf der Krim, sondern im Mittelmeerraum und auf dem Balkan. Der Strategiewechsel sollte mit der Auswechslung der Begriffe einsetzen. Statt Universalität, Globalität, Integration und Interkulturalität helfen die Begriffe des Kalten Krieges besser zu begreifen, worum es heute zwischen den Kulturen und Mächten geht: um Abgrenzung, Zurückdrängung, Eindämmung und Koexistenz. Ökonomische Kooperation könnte sich dann in diesem gesetzten Rahmen entwickeln, ohne ihn – wie in den entgrenzenden Globalisierungsprozessen – zu zerstören.