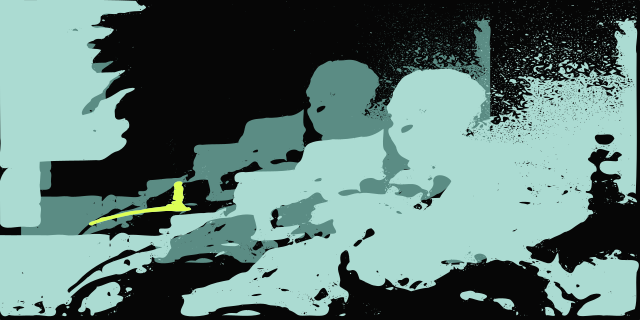Globalismus und Protektionismus, Links und Rechts, Nationalstaat und Europäische Union müssen sich ergänzen
von Heinz Theisen
Der Liberalismus blickt in den letzten fünf Jahrhunderten und die liberale Demokratie in den letzten Jahrzehnten auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte in der westlichen Welt zurück. Die dem Mauerfall folgenden globalen Entgrenzungsprozesse haben die Karten für die liberalen Demokratien aber ganz neu gemischt.
Niemand sollte hinter das Erreichte zurückwollen. Im Gegenteil – in unterentwickelten Regionen kann auf Dauer nur die Ausweitung individueller Freiheiten aus den Sackgassen kollektiver Verstrickungen herausführen. Insbesondere im Nahen Osten hat der Liberalismus noch seine Zukunft vor sich. Dort müsste ein Paradigmenwandel vom Kollektivismus zu individuellen Interessen – wie in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg und in Osteuropa nach 1990 – eine Aufhebung der religiös-konfessionellen oder ethnischen Verstrickungen voranbringen. Zugleich fordern Russland, China, Islamisten und mittlere Mächte wie die Türkei die Universalität der Demokratie und die Vorherrschaft des Westens heraus.
Migranten wollen – nur zu verständlich – an ihrem Wohlstand teilhaben, verständlich aber auch die Ängste derjenigen, die selbst zu wenig haben, um Millionen Zuwanderern abgeben zu können. Schwer verständlich, dass in diesem Dilemma nicht offen über Kompromisse debattiert wird.
In der multipolaren Welt geht es längst nicht mehr um Universalität, sondern um die Selbstbehauptung des Westens. In dieser Situation sind die offenen Gesellschaften polarisiert und zerstritten, vor allem über den neuen Kernkonflikt zwischen Offenheit und Abgrenzung.
Mit dem »Kampf gegen Rechts« fällt den etablierten Parteien nichts anderes ein als Symptome zu bekämpfen. Deren Ursachen geraten solange nicht ins Blickfeld wie grundlegende Fragen nach den Grenzen der offenen Gesellschaft ausgeklammert bleiben. Der Kampf gegen Andersdenkende destabilisiert die Demokratien, weil er nicht einmal zwischen denjenigen differenziert, die als Konservative die Demokratie bewahren und denjenigen, die als Rechtsextreme die Demokratie bekämpfen wollen.
Globalisten und Protektionisten
Die Konflikte zwischen Links und Rechts werden deshalb mit solcher Bitterkeit ausgetragen, weil sie den neuen Großkonflikt zwischen Globalisten und Protektionisten nicht auf den Begriff zu bringen verstehen. Die Flucht aus der Utopie einer ideologisierten »Weltoffenheit« in den Nationalstaat oder sogar im Separatismus in die Regionen ist verständlich, aber oft auch nur eine romantisch-nostalgische Antithese. Kleinstaaten wie Singapur können Nischen finden. Mittleren Nationalstaaten ist keine Selbstbehauptung gegenüber faktischen Imperien wie China, USA oder auch Russland möglich. Der Brexit verkommt zur Farce von »America First«.
Die Diffamierungen dieses im Kern defensiven Anliegens als »Nazismus, Rassismus oder Faschismus« sind jedoch begrifflicher Unsinn und spalten nur die Gesellschaften immer tiefer. Bei den neuen politischen Rändern handelt es sich in der Regel nicht um Extremisten, aber ihre Einseitigkeiten versprechen wenig Problemlösungsfähigkeit. Während die alte Linke einer utopischen Global Governance das Wort redet, drohen sich neue Rechte in regressiver Abwehr einzumauern.
Gegenseitige Diffamierungen verhindern eine Suche nach den dritten glokalen Wegen. Moralisch aufgeladene Ängste treiben apokalyptische Bewegungen hervor, deren einseitige Fixierung auf den Klimawandel die Hauptaufgabe der Politik verkennt, nämlich ökologische, ökonomische, soziale, kulturelle und auch noch psychologische Perspektiven gleichzeitig im Blick zu haben, um dann den Ausgleich zwischen ihnen anzustreben.
Im zeitgenössischen Globalismus wurde die Behauptung des Eigenen missachtet – etwa indem die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf dem Altar der »Menschheitsherausforderung Klimawandel« (Angela Merkel) geopfert werden soll. Eine Art postmoderner Kulturmarxismus gibt mit der Selbstverleugnung des Eigenen und einer behaupteten Gleichwertigkeit aller Kulturen die eigene Kultur und damit nicht weniger als Säkularität und Liberalität der Beliebigkeit preis.
Rinks und Lechts auf dem Weg zur Ausdifferenzierung
Dem Verlust der Mitte ging der Verlust einer offenen Debattenkultur voraus, womit sich die offenen Gesellschaften ihrer größten Stärke beraubten. Sie gilt es von neuem aufzubauen, um dann auch neue Kompromisse und Synthesen zu finden. So könnte eine liberale Mitte die Bejahung multikultureller Vielfalt mit der Ablehnung eines Multikulturalismus verbinden, der die Unterschiede verstärkt und den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Freiheit des Einzelnen gefährdet.
Auch andere Scheingegensätze rufen nach neuen Gegenseitigkeiten. Dies begänne mit einer differenzierteren Nutzung der Funktionssysteme. Der wesensmäßigen Globalität von Wissenschaft und Technik steht umgekehrt die für die Bewahrung von Identität und Zusammenhalt gebotene Begrenzung von Kulturen gegenüber.
Eine »antiimperialistische« und linke Selbstbegrenzung nach außen ermöglicht umso mehr rechte Selbstbehauptung nach innen. Der globale Wettbewerb erfordert lokale Schonräume – nicht zuletzt zur Vorbereitung künftiger Wettbewerbsfähigkeit. Der Widerspruch von Schutz und Offenheit löst sich in zeitlicher Reihenfolge auf.
Die neue Mitte zwischen irrealer globaler Gemeinsamkeit und regressivem Partikularismus müsste zugleich auf linke und rechte, auf ökologische, liberale und konservative Ideen zurückgreifen. Der jeweilige Vorrang ergäbe sich aus der Logik der Funktionssysteme. Kultureller Konservatismus, wirtschaftlicher Liberalismus, Autorität im Rechtsstaat und eine fördernde und fordernde Sozialstaatlichkeit sind falsche Gegensätze, die sich zu Gegenseitigkeiten entwickeln sollten. Über ihre Ausgestaltung erhielten Volksparteien wieder Sinn und Zulauf.
Neue Gegenseitigkeiten wären liberal, indem sie die Freiheit zu schätzen und konservativ, indem sie die Freiheit zu schützen weiß. Die Hauptaufgabe der Konservativen läge im Aufbau von kultureller Resilienz, welche »die neurotische Feindschaft gegen das Eigene« (Joachim Gauck) durch eine Kultur der Wertschätzung des Eigenen ablöst.
Eine Strategie der Selbstbehauptung wäre sozial-konservativ, wenn sie den Sozialstaat, liberal-konservativ, wenn sie den Rechtsstaat und ökologisch-konservativ, wenn sie die Natur gegenüber dem entgrenzten Ressourcenverbrauch bewahren will. Sie wäre modern und konservativ, indem sie kulturelle Voraussetzungen der Moderne bewahrt: Individualismus, selbstständiges Denken und selbstverantwortliches Handeln.
Glokalisierung durch die Ergänzung von Nationalstaat und Europäischer Union
Und dann müsste ein »Sozialer Kapitalismus« (Paul Collier) auch noch Globalität mit Nationalstaatlichkeit, Liberalität mit Ordnung, Offenheit mit Begrenzung verbinden. Auch die Weltwirtschaft ist divers. Für die globale Ebene genügte eine dünne Schicht einfacher Verkehrsregeln. Mit der Handlungsfähigkeit von Local Playern würde die Demokratie gestärkt und dem neuen Nationalismus Wind aus den Segeln genommen.
Die Europäische Union wäre idealerweise eine mittlere Ebene. Ihre supranationale Struktur verbietet aber eine irreale Einheitlichkeit. Gefordert wäre hingegen eine Gegenseitigkeit zwischen den jeweils geforderten Handlungsräumen, Ebenen und Akteuren. Die Briten hätten innerhalb der Europäischen Union dazu beitragen sollen, die Supranationalität der Union mit der Souveränität ihrer Nationalstaaten zu versöhnen.
Xi Jinping, Putin und Trump sind keine Globalisten und Multilateralisten, sie verfolgen ihre eigenen Interessen und sind allenfalls bereit, auf Augenhöhe zwischen ihren Mächten notwendige Kompromisse einzugehen. Eine multipolare Mächtewelt hat die Ära der Globalisierung und des Freihandels weitgehend abgelöst.
Angesichts von Deglobalisierung und »strategischem Handel« (Chris Luenen) gehört die Zukunft weder dem Globalismus noch dem Nationalismus, sondern dem koordinierten Handeln in Großräumen. Die wichtigsten Entscheidungen fallen heute zwischen den USA, China und Russland. Kleinere Staaten – wie eben die europäischen – müssen sich zu Allianzen zusammenschließen, wenn sie sich in der multipolaren Welt behaupten wollen.
Die Frage an die Europäer lautet, ob sie in der neuen Weltordnung Objekt oder Subjekt sein wollen? In ihrer gegenwärtigen Konsens- und Handlungsunfähigkeit ist die Europäische Union nur noch ein Objekt der Weltmächte, in der Flüchtlingsfrage sogar nur noch von mittleren Mächten wie der Türkei.
Die Europäische Union ist für eine Politik der Selbstbehauptung solange nicht gerüstet, wie sie in außenpolitischen Fragen nicht vom Einstimmigkeitsprinzip Abschied zu nehmen versteht. Im Gegenteil behindert sie sogar noch die Selbstbehauptung ihrer Nationalstaaten. Das Insistieren auf volle Personenfreizügigkeit hatte den Brexitern die entscheidenden Stimmen verschafft.
Angesichts der Corona-Pandemie wurde dann allerdings unübersehbar, dass wir im Ernstfall auf die Handlungsfähigkeit des Nationalstaates nicht verzichten können. Solange die europäischen Grenzen keinen ausreichenden Schutz bieten, fällt der Schutz des Menschen als zentraler Funktion jeder Staatlichkeit wieder in die Hände des Nationalstaates.
Gegenüber äußeren Bedrohungen durch andere Mächte ist der Nationalstaat aber wiederum unzureichend. Weder die inter- und supranationalen Organe der EU noch die Nationalstaaten sind Selbstzwecke, sie bleiben beide dem übergreifenden Ziel der Selbstbehauptung verpflichtet. EU und Nationalstaaten sollten sich daher nicht gegenseitig ersetzen, sondern sich gegenseitig ergänzen. Sie müssen mehr Vielfalt nach innen und mehr Einheit nach außen zulassen. Gerade die Vereinheitlichung der Währung und von Asyl- und Migrationspolitik droht die EU auseinanderzusprengen, weil sie die Selbstbehauptung der Nationalstaaten schwächt.
Die europäischen Armeen sind heute mit Ausnahme Frankreichs jeweils alleine kaum einsatzfähig. Wir sollten Macrons strategisches Angebot einer eigenständigen europäischen Verteidigungspolitik annehmen. Anders als nach dem auf innere Einheit ausgerichteten Modell des Nationalstaates, dem die EU folgt, würde ein eher locker gefügtes imperiales Modell den gemeinsamen Schutz gegenüber Dritten in den Vordergrund stellen. Neu an diesem Imperium wäre seine defensive Ausrichtung, die ihr Heil nicht in der Ausweitung des Territoriums, sondern in der Bewahrung der Territorialität sucht.
Grenzen und Gegenseitigkeiten
Im vorglobalistischen linken Lager galten gegenüber dem entgrenzten Wettbewerb selbst nationalökonomische Grenzen einmal als »antiimperialistische« Notwendigkeit. Durch ihre humanitär motivierte Koalition mit dem entgrenzenden Neoliberalismus hat die Linke in ihrer Stammwählerschaft dramatisch an Zulauf verloren. Diese fordert im Zeitalter der Globalisierung – mehr als innergesellschaftliche Umverteilung – den Schutz vor der weltweiten Konkurrenz der Produkte, vor billiger Arbeitskonkurrenz und vor der Teilhabe allzu vieler am nationalen Sozialstaat.
Immerhin ist in Österreich und Frankreich eine neue Politikergeneration an der Macht, die nach Wegen jenseits von Links und Rechts sucht. Auch die dänischen Sozialdemokraten haben bemerkt, dass den Wählern nur eine Balance zwischen eigenen Interessen und humanitärer Offenheit zu vermitteln ist. Auch das ökologische Denken beruht im Kern auf der Annahme von den »Grenzen des Wachstums« und könnte im Zeitalter der Deglobalisierung dieser Tradition gegenüber der bloßen Weltoffenheit wieder den Vorzug geben.
Für eine künftige Glokalisierung muss die ideologisierte Entgrenzungspolitik der letzten Jahrzehnte der Einsicht in die Notwendigkeit von Begrenzungen weichen. Ohne eine realistische Vorstellung sowohl unserer individuellen als auch der politischen Grenzen drohen Überdehnung und Auflösung. Der Mensch ist – so Josef Isensee – ein grenzbedürftiges Wesen. In den Bedrängnissen der Corona-Pandemie war sogar Angela Merkel gezwungen, ihre staatsnegierende Behauptung, dass wir unsere Grenzen nicht schützen können, selbst zu widerlegen.
Kontrollfähige Grenzen sind sowohl für eine größere Vielfalt nach innen als auch für mehr Einheit nach außen erforderlich. Statt offener Tore oder abschottender Mauern würde die Türmetapher verstehen helfen, dass – wie bei jedem Haus – auch jede Form von Staatlichkeit mal offen und mal geschlossen ist. Die Türwächter der Politik entscheiden dann über das Verhältnis von Offenheit und Kontrolle, von Dynamik und Steuerung und von globaler Veränderung und lokaler Bewahrung.
Auf die Frage, ob diese Umwandlung von Gegensätzen zu Gegenseitigkeiten einmal möglich sein wird, hätte Goethe geantwortet: »Dem harten Muß bequemt sich Will und Grille«. Dem harten Muß der Selbstbehauptung werden sich der ideologische Wille der Globalisten und die romantischen Grillen neuer Nationalisten beugen müssen.
(Der Aufsatz geht auf eine Reihe von Artikeln zurück, die zuerst in der NZZ erschienen sind.)