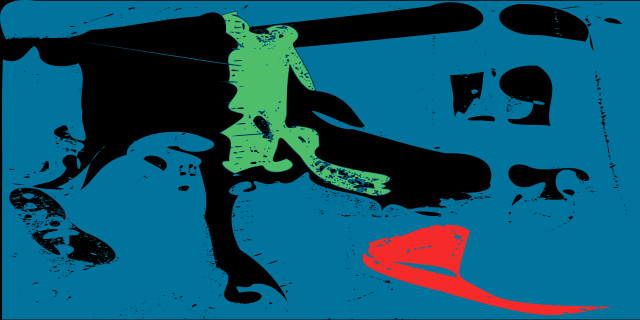von Jens-U. Hettmann
Dass Afrikas Frauen – quer über den ganzen Kontinent – auch dort, wo sie laut Verfassung ›gleichberechtigt‹ sein sollen, dies in ihrer überwältigenden Mehrheit im realen Leben aber genau nicht sind, dass ihre Lebenslage selbst hinter die ›Standards‹ etwa des zeitgenössischen Europa um ›Lichtjahre‹ abfiel, wurde mir nach wenigen Jahren vor Ort – ab der Mitte der 1980er Jahre etwa – immer klarer. Ebenso klar wurde, dass diese Verhältnisse nicht frisch vom Himmel gefallen waren und dass sie in ihren Ursprüngen deutlich vor die Kolonialzeit (die aktuell vielfach als die einzige Ursache der weithin äußerst schwierigen Lebensverhältnisse der Menschen in Afrika angesehen wird, was allerdings nur bedingt richtig ist) zurückreichen. Frauen und Mädchen waren – und sind – in ihren Rechten weit davon entfernt, gleichberechtigt mit den Männern bzw. Jungen zu sein, und zwar in so ziemlich sämtlichen Lebensbereichen: angefangen bei der Bildung, über wirtschaftliche Autonomie bis hin zu politischer Partizipation bei der Gestaltung der ›polity‹, zu der sie alle gemeinsam gehör(t)en. In Mali mussten damals Frauen sogar noch schriftliche Genehmigungen ihrer Ehemänner beibringen, wenn sie ein Visum für eine Auslandsreise beantragten. Mädchen gingen – das ist wohl leider bis heute verbreitet so – im Durchschnitt weit weniger lange zur Schule als Jungen. Die Wirtschaftstätigkeit der ›Durchschnittsfrau‹ (selbst wenn die genauso berühmten wie seltenen ›Mama Benz‹ durch ihre Erfolge im Bereich ›Handel‹ immer wieder für Gesprächsstoff und Bewunderung sorgten) beschränkte sich im Normalfall auf die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des ›foyers‹, und zwar fast ausschließlich mit den in aller Regel sehr bescheidenen Mitteln, die das Familienoberhaupt ›Mann‹ mehr oder weniger widerwillig zur Verfügung stellte. Zwar begegnete man immer mal wieder auch in höheren Funktionen des Staatsdienstes Frauen, aber diese waren eher die Ausnahme, die die Regel bestätigten, dass die Frauen zwar sehr viel arbeiteten, vielfach schufteten, im Gegenzug aber dafür alles andere als gerecht entlohnt wurden bzw. am politischen Leben partizipierten.
Für den jungen, idealistischen Vertreter einer deutschen Organisation, die sich Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und über allem ›Demokratie‹ auf die Flagge geschrieben hatte, war schnell klar, dass jedes von ihm geleitete Projekt lokale Partnerorganisationen, genauer: Frauenorganisationen bei der Erreichung ihrer – mit den unseren völlig kompatiblen – Zielen unterstützen und so versuchen sollte, einen Beitrag ›von außen‹ zur Verbesserung der Lebenslage von Frauen zu leisten. So etwas entscheidet sich nicht ›stehend freihändig‹ vor Ort, aber in meiner Organisation rannte ich mit solchen Ideen offenen Türen ein, zumal auch aus anderen Regionen derartige Anregungen gekommen waren. Und so bauten wir in immer mehr Projekten entsprechende ›Arbeitslinien‹ auf, wie das im Fachchinesisch heißt. Natürlich war die Motivation groß, sicherlich auch dem wirklich großartigen Ziel geschuldet. Wie schwierig es allerdings wurde und wie mager letztlich ›die Erträge‹ waren und sind, möchte ich in diesem Beitrag anhand von vier verfolgten Ansätzen darzustellen versuchen.
1. Der Ur-Ansatz: Wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen.
Ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre erweiterten wir unsere Arbeitspalette um das Thema ›Frauenförderung‹. In der ersten Phase ging es dabei um die Unterstützung von Frauenorganisationen mit dem Ziel einer größeren wirtschaftlichen und sozialen Autonomisierung der weithin entweder von der eigenen Familie oder von den Ehemännern abhängigen Frauen. Konkret konnten sich dahinter verschiedene Ansätze verbergen, verbreitet waren die Unterstützung von Schneiderinnen, die sich in Genossenschaften zusammenschlossen, wie etwa in der Casamance im Senegal oder aber die Bereitstellung von Getreidemühlen an Frauengruppen in Tansania. Dadurch sollte sich zum einen die harte physische Arbeit verringern und gleichzeitig die durch die große Zeitersparnis beim Getreidemahlen frei werdenden Kapazitäten den Frauen selbst zugutekommen, etwa für andere Aktivitäten. Gängig wurden etwa: Seifenproduktion auf Sansibar oder Gemüseanbau und die damit verbundene Hoffnung, überschüssige Produktion auf den lokalen Märkten zu vermarkten und so finanziell autonomer zu werden. Beide Ansätze funktionierten anfänglich beeindruckend gut und zeitigten recht schnell für die beteiligten Frauen spürbare Erfolge. Allerdings stellte sich nach einiger Zeit auf Sansibar das berüchtigte ›Schweinezyklus-Phänomen‹ ein, weil die erfolgreichen Seifengenossenschaften Interesse weit jenseits der Projektreichweite weckten und sich so große Teile der weiblichen Bevölkerung an die Seifenproduktion machten, dass schließlich viel mehr Seife produziert wurde als lokal vermarktet werden konnte. Schnell wurde die Produktion zurückgefahren, Seife wurde knapp. Dann wurde die Produktion wieder aufgenommen, und der alles andere als erstrebenswerte Zyklus ging von vorne los. Dafür konnte das Projekt nie wirklich eine Lösung finden, es gab keine Möglichkeit, irgendjemandem die Seifenproduktion zu untersagen. Schließlich fiel die Seifenproduktion wieder zurück auf das Subsistenzniveau, der erhoffte Zugewinn konnte nicht verstetigt werden. – Den erhofften Erfolg zeitigten anfangs auch die Getreidenmühlenprojekte in Tansania-Mainland, allerdings war auch dieser Erfolg nicht nachhaltig. Der Ansatz wurde nach relativ kurzer Zeit dadurch kompromittiert, dass die Männer, kaum dass sie den wirklich bemerkenswerten Erfolg der Frauen erkannten, vielfach höchst negativ bis destruktiv darauf reagierten: Sie zogen sich unilateral aus ihren traditionellen Verpflichtungen zurück und halsten diese den Frauen zusätzlich auf. Damit war klar, dass eine Frauenförderung, die die Männer nicht mit einbezog, schnell kontraproduktiv wurde und die beabsichtigen Wirkungen sehr schnell konterkariert wurden. Das Projekt versuchte daraufhin sofort seinen Ansatz durch mehr Einbeziehung von Männern in der Hoffnung, zumindest eine ›Duldung‹ ohne weitere ›Sanktionen‹ zu erreichen. Dies gelang jedoch nur marginal, die ursprünglichen Ziele wurden nie mehr im erhofften und möglichen Ausmaß erreicht.
2. Das Spektrum der Ansätze von Frauenförderung erfuhr sukzessive eine Ausweitung.
So kam die Förderung der ›politischen Partizipation‹ bis hin zur Förderung von Frauenkandidaturen bei Wahlen hinzu. Dies war – und ist vermutlich immer noch – ein politisch hoch brisanter Ansatz: Während in etlichen Ländern Frauen entscheidende Rollen beim Kampf für die Unabhängigkeit spielten, wurden sie hinterher entweder fast völlig aus der Politik gedrängt oder aber wie in Tansania zu einer der fünf Massenorganisationen der Einheitspartei CCM gemacht: Als UWT mit sehr begrenzter Reichweite erfüllten sie letztlich mehr eine Alibifunktion als dass sie wirklich spürbar die Politik des Landes beeinflussten. Entsprechend begrenzt waren auch die ›Erfolge‹ unserer Unterstützung. Ähnliches war ab Ende der 1990er Jahre in der Projektarbeit in Guinea zu verzeichnen. Zum Projektprofil gehörte dort mittlerweile selbstverständlich die Unterstützung von Frauengruppen, die sich gesellschaftspolitisch engagierten. Auch hier zeigten sich recht schnell massive Herausforderungen und negative Auswirkungen. Zunächst lief die Mitarbeit von Frauen in verschiedenen gemischtgeschlechtlichen Organisationen ohne nennenswerte Friktionen: Frauen waren willkommen und durften mitreden. Das sollte sich aber besonders in der Zusammenarbeit mit politischen Organisationen/Parteien bald ändern. Das Projekt verfolgte einen pluralistischen Ansatz, d.h. es unterstützte Foren von Frauen, die verschiedenen Parteien angehörten, um ihnen einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und daraus Strategien abzuleiten bzw. zu entwickeln, die darauf abzielten, die Repräsentanz von Frauen in Wahlgremien, kommunal, regional und national zu vergrößern. Zum ›Knackpunkt‹ wurde nach anfänglich positiven Rückmeldungen der an den vom Projekt begleiteten Foren beteiligten Frauen die Vorbereitung von Frauen-Kandidaturen für die nächsten anstehenden Wahlen. Obwohl die Männer auf der deklaratorischen Ebene weiterhin treuherzig behaupteten, mehr Frauenkandidaturen zu begrüßen und folgerichtig auch unterstützen zu wollen, häuften sich mit dem näher kommendem Wahltermin zunehmend die Klagen der Frauen, dass es damit in Wirklichkeit nicht sonderlich weit her wäre. Insbesondere zwei Hindernisse bestanden bzw. wurden errichtet: Zum einen wurden die Sitzungstermine der zuständigen Gremien auf Zeiten verlegt, zu denen – im Unterschied zu den Männern – die Frauen anderweitig durch Termine oder Verpflichtungen gebunden waren, denen sie sich kaum entziehen konnten und zum anderen gelang es den Frauen nicht, die – auch in unseren Breiten bekannte – Hinterzimmerkungelei auszuhebeln. Sie wurden gern bei öffentlichen Veranstaltungen eingespannt, sollten ›Stimmen ziehen‹, aber wenn Wahlkreiskandidaturen oder Listenplätze verhandelt wurden, gingen sie aus den Kungeleien fast ausnahmslos als Verliererinnen hervor. Obwohl viele gesellschaftspolitische Projekte – im Prinzip aller in diesem Politikfeld tätigen politischen Stiftungen – weiterhin sehr engagiert daran arbeiten und in den Frauen auch motivierte und fähige Partnerinnen haben, tut sich in der Realität zu wenig: Gemessen an der Entwicklung der Sitzzahlen für Frauen sind die Erwartungen hier nur sehr bedingt erfüllt worden. Immerhin hat das guineische Parlament kürzlich Aufsehen erregende Beschlüsse zur Verbesserung von Frauenrechten gefasst, darunter auch das der baldigen Erreichung der Sitz-Parität. Ob und wie die Umsetzung erfolgen wird, muss abgewartet werden. Vorläufig ist zu konstatieren, dass die Anzahl weiblicher Abgeordneter, Bürgermeisterinnen etc. weithin stagniert, mitunter sogar zurückgeht. Die Erringung von Wahlämtern bleibt schwierig. Einen besonders krassen Fall erinnere ich aus der Côte d’Ivoire: einer ›Grande Dame‹ von einer der großen politischen Parteien, die sich vorab als Rechtsprofessorin, dann auch als Ministerin landesweit und über Parteigrenzen hinaus einen Namen gemacht hatte, wurden ihre Ambitionen in Sachen Präsidentschaftskandidatur innerhalb von ihrer eigenen Partei derart ›erschwert‹, dass sie gezwungen war, als ›unabhängige‹ Kandidatin anzutreten, wodurch sie nicht mehr auf Ressourcen, die von Parteien getragenen Kandidaten (Kandidatinnen gab es auf dieser Ebene meines Wissens bisher immer noch nicht) zur Verfügung stehen, zurückgreifen konnte. Sie scheiterte in der ersten Wahlrunde entsprechend sang- und klanglos. Von außen kann (und sollte) in diese Verhältnisse natürlich nicht eingegriffen werden, dennoch hatte ich mich damals dazu entschlossen, eine Abendveranstaltung für diese Professorin zu organisieren. Sie war bereit – sicherlich keine einfache Entscheidung für sie – ihre Erfahrungen zu präsentieren, die Veranstaltung stieß auf großes Interesse und öffnete einer ungewöhnlich großen Teilnehmerzahl die Augen zum Thema ›besondere Herausforderungen für kandidaturwillige Frauen‹. Bewirkt hat es letztlich nicht viel, bei der nächsten Präsidentschaftswahl trat erst gar keine Frau an. Aber: Mehr kann man ›von außen‹ kaum machen. Es darf im Gastland und bei Partnern niemals der Eindruck entstehen, dass man sich in deren innere Verhältnisse einmischen wolle, schon gar nicht zugunsten einer Partei oder einer Person. – Um das Wahlrecht als solches für Frauen mussten wir uns übrigens in keinem der Projektländer, in denen wir tätig waren bzw. sind, kümmern, es ist überall verbrieft und muss nicht mehr erkämpft werden. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass Frauen ihr Wahlrecht auch ausüben können, besonders nicht unabhängig vom Willen des ›Familienoberhaupts‹. Familienoberhaupt ist immer noch in aller Regel – auch wenn dies durch moderne Gesetzgebungen wie etwa in der Côte d’Ivoire vor einigen Jahren abgeschafft wurde – der Mann. Und so kam es, dass ich – in diesem Fall in Guinea – ohnmächtig zur Kenntnis nehmen musste, dass die Männer, nachdem die Frauen der Familie ihre Wahlausweise erhalten hatten, diese einsammelten und damit für die ganze Familie abstimmten. Die Wahlbüros scheinen das durchgängig akzeptiert zu haben. Thematisiert wurde das in der Öffentlichkeit nicht.
3. ›Gewalt gegen Frauen und sexueller Missbrauch von Abhängigen, besonders im Bildungsbereich‹
Hier konnte Unterstützung besonders in der Côte d’Ivoire angeboten werden, zumal dort eine ganz wichtige Voraussetzung bereits erfüllt war: es gab einschlägige Frauenorganisationen, die sich bereits engagierten. (Exkurs: Die Erfahrung zeigt, dass der gelegentlich vertretene Ansatz, mangels existierender Organisationen für angestrebte gesellschaftliche Ziele solche quasi selbst zu schaffen, fehlgeht.) Besonders erwähnenswert erscheint mir dabei das Ergebnis einer wirklich außerordentlich positiven Zusammenarbeit mit einer nationalen Juristinnenorganisation. Wir erarbeiteten und publizierten einen ›code de bonne conduite‹ (Verhaltenskodex) für einen respektvollen Umgang der Geschlechter miteinander. Von besonderer Bedeutung war dabei die Betonung des für einen solchen Umgang förderlichen Verhaltens beider Geschlechter. Breiten Raum nahm das anfangs in der Öffentlichkeit nur schwer zu thematisierende Problem der ›Ausnutzung professoraler Macht gegenüber Studentinnen‹ ein. Obwohl sehr viele Familien davon betroffen waren, bis hin zu ungewollten Schwangerschaften, war es deswegen schwer zu thematisieren, weil es ein ›Tabuthema‹ war. Aus Angst vor einem Scheitern der Universitätsausbildung ihrer Töchter und aus Angst vor öffentlicher Schande wagten betroffene Familien zumeist nicht, den Mut aufzubringen, dagegen in der Öffentlichkeit oder gar vor Gericht vorzugehen. Mit entsprechender Medienbegleitung – politische Absicherung sowieso, die muss immer gegeben sein bei allen Bereichen von Projektarbeit – und unter großer öffentlicher Mitwirkung gelang es unserer Initiative, weite Aufmerksamkeit zu erreichen einen präsentationsfähigen Kodex zu formulieren, damit in verschiedene Radiosendungen und sogar ins staatliche Fernsehen zu gelangen sowie vor allen Dingen das daraus entstandene große Poster in sehr vielen öffentlichen Einrichtungen zum Aushang zu bringen, darunter selbst im ivorischen Parlamentsgebäude. Selbst verschiedene Medien griffen mehrfach das Thema auf, ohne dass das Projekt Lobbyarbeit dafür zu verrichten gehabt hätte. Zusätzlich richtete die Juristinnenorganisation bereits damals (vor rund 15 Jahren) einen Notruf für Opfer sexueller Bedrängung oder gar Gewalt ein, den sie selbst organisierte. Das Projekt war somit recht erfolgreich, wobei aber klar bleibt, dass vor dem Hintergrund der tiefen ›Verankerung‹ dieser inakzeptablen Vorgänge im täglichen Leben kurzfristige und dauerhafte Verbesserungen nicht erwartet werden konnten. Das Projekt hat hier messbare Starthilfe geleistet. Auch wenn damit das Problem bis heute keineswegs völlig beseitigt ist, zeigt das fortbestehende Engagement diverser Organisationen, dass die Arbeit am Thema weiterläuft, ohne dass das Projekt dabei involviert bleiben müsste. – Ein Thema, das hier nicht fehlen darf, ist das der afrikaweit verbreiteten Genitalverstümmelungen, einzig dort, wo das Christentum mittlerweile einigermaßen verwurzelt ist, ist diese – von mir als ›Verbrechen gegen die Menschlichkeit‹ angesehene – Praxis auf dem Rückzug. In meiner Projektverantwortung habe ich aber dieses Thema – obwohl wir es bei jeder sich bietenden Gelegenheit ansprachen – nicht zu einer Arbeitslinie machen können, weil die knappen Ressourcen die Verantwortlichen vor die Herausforderung stellen, aus der Fülle möglicher Optionen nur einige auswählen zu können.
4. ›Rechtliche und faktische Gleichberechtigung‹
Dies ist ein überwältigend großes gesellschaftspolitisches Thema, welches erkennbar – wie in der sogenannten ›entwickelten Welt‹ übrigens auch – dauerhaft, unbefristet und unablässig bearbeitet werden muss, sozusagen eine ›ewige Baustelle‹ ist. Dabei sind wie bereits dargestellt kulturelle Faktoren die am schwierigsten von außen aufzugreifenden. Das gilt übrigens auch dann, wenn den Frauen die Ungerechtigkeit, die Diskriminierung, die faktische und vielfach auch rechtlich verankerte Benachteiligung bewusst ist und sie diese gerne bekämpfen möchten. Häufig entschließen sie sich nicht dazu, weil sie es sich einfach nicht zutrauen oder damit rechnen müssen, mit ihren Vorstellungen nicht durchzudringen, oder weil sie sogar Retourkutschen befürchten müssen. Dennoch: Das Engagement von außen lohnt sich, Unterstützung ›von außen‹ wird geschätzt und sogar nachgefragt. Wichtig ist dabei aber genauso wie in andern Bereichen gesellschaftspolitischer Arbeit, dass ein Projekt mit einer derartigen Arbeitslinie nicht als Akteur oder als ›driving force‹ wahrgenommen wird. Sobald der Eindruck entsteht, dass – insbesondere bei Organisationen, die aus früheren Kolonialmächten gekommen sind, um ›zu helfen‹ – letztlich diese Organisationen ›von außen‹ hinter der Initiative stehen und diese auch weitgehend betreiben, wird es sehr schnell zu dem verbreiteten und sicherlich ein Stück weit nachvollziehbaren Reflex kommen: ›Das machen wir nicht, das ist unafrikanisch, das ist mal wieder so ein Trick der Europäer, uns ihren Willen aufzuzwingen!‹ Aber auch, wenn es gelingt, diesen Eindruck zu vermeiden, ist die Unterstützung lokaler Akteursgruppen, die das Ziel verfolgen, traditionell überlieferte Gegebenheiten zu verändern ein – Max Weber lässt grüßen – ganz langsames Bohren sehr, sehr dicker Bretter. Persönlich hat mich immer besonders die wirklich üble Benachteiligung von Frauen durch das faktische ›Erbrecht‹ betroffen gemacht, was übrigens selbst durch klare, Gleichberechtigung festlegende Kodifizierung selbst in Verfassungen kein Ende zu nehmen scheint. Frauen werden – notfalls mit Gewalt bzw. Androhung von Gewalt – systematisch und verbreitet um das ihnen zustehende Erbe gebracht. Besonders dann, wenn es um Grundbesitz und/oder Immobilien geht. Hier dürfte – so jedenfalls meine Prognose – in absehbarer Zeit auch keine spürbare Bewegung in Richtung Gleichberechtigung zu erwarten sein, die Traditionen sind bislang zu wirkungsmächtig. Allerdings erinnere ich mich auch an einen Fall aus meiner Zeit im Senegal, wo das traditionelle Erbrecht eine Folge zeitigte, die ich niemals erwartet hätte: Eines Morgens kam ein Projektfahrer, den ich ansonsten als durchweg fröhlichen Menschen kannte, ziemlich niedergeschlagen zur Arbeit. Unser Vertrauensverhältnis war bereits so gut, dass ich nicht lange insistieren musste, bis er bereit war, mir sein Leid zu klagen. Sein älterer Bruder war kürzlich verstorben und hinterließ eine Witwe mit mehreren Kindern. Weil die Tradition es so wollte, ›erbte‹ unser Fahrer die Witwe mitsamt Kindern und war vor der Großfamilie ab sofort und vollumfänglich für deren Lebensunterhalt verantwortlich. Da begriff ich, dass Ungerechtigkeiten des traditionellen Erbrechts durchaus nicht nur gegen die Frauen bestehen. Wobei ich diese natürlich mit dieser abschließenden ›Anekdote‹ keineswegs relativieren möchte.
5. Abschließendes Fazit ›aus meiner Zeit‹
Unterstützung ›von außen‹ zur Verbesserung der Lebenslage von Frauen ist und bleibt – dessen bin ich mir sicher, auch wenn ich seit über fünf Jahren nicht mehr dort tätig bin – ein zu jeder ›Projekt-DNA‹ gehörender Bestandteil. Und das für eine absehbar noch sehr lange Zeit. Zwar gibt es in Afrika Traditionen, die schlicht und einfach heute keine Daseinsberechtigung mehr haben, zumal die meisten Staaten die allermeisten globalen Menschenrechtsvereinbarungen unterzeichnet und ratifiziert haben. Dennoch hilft in der täglichen Arbeit diese unerlässliche, im Prinzip hilfreiche, Grundlage noch lange nicht weiter, um in überschaubaren Zeiträumen messbare Wirkungen zu erzielen: die Kultur steht dagegen. Und über diese Themen hinaus, also solche, die in anderen Weltregionen bereits – weitgehend – bearbeitet wurden oder sich in Arbeit befinden, werden Hoffnungen dadurch gedämpft, dass selbst in den OECD-Staaten hier noch viel im Argen liegt. Die Arbeit in Sachen ›wirklicher und umfassender Gleichberechtigung‹ gehört in der ganzen Welt auf den berühmten ›frontburner‹ und muss da auch bleiben. Obwohl klar ist, dass Fortschritte nicht leicht zu erzielen sind und beharrlich in täglicher Arbeit errungen und behauptet werden müssen. Dem müssen wir uns auch ›von außen‹ stellen, dürfen nicht nachlassen, auch wenn – oder gerade weil – in der Summe die Bilanz der bisherigen Anstrengungen recht mager ausfällt. Mein persönlicher Trost besteht darin, dass ich der mittlerweile tätigen jungen Generation die Erfolge wünsche, die wir als Pioniere noch nicht erreichen konnten, damit sich die Lebenslage von Frauen in Afrika endlich spürbar verbessern kann.