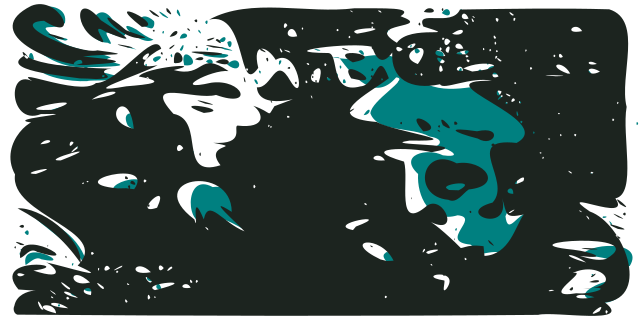von Ulrich Schödlbauer
Eine politische Grenzerwägung
1.
Wann war Delirieren je schöner? Die Titelseite des Stern gibt den Trump mit faschistischem Gruß, sie gibt ihm auch in dieser Pose noch Zucker, wenn sie ihn in die einzige Flagge auf Erden hüllt, die der Deutsche noch respektiert, aber das steht auf einem anderen Blatt. Das andere Blatt, der Spiegel, zwängt den mächtigsten Mann der Welt, zwecks Demaskierung, unter die weiße Maske des Ku Klux Klans, es fehlt nur die liegengebliebene Trump-Maske aus Wahlkampfzeiten und obendrauf eine überdimensionierte Sonnenbrille: die Banalität des Bösen, perfekt! Perfekte Banalität, diesmal des deutschen Wahlkampfs, verströmte, aus welchem Kalkül auch immer, der Kandidat: Spiegel online zufolge nannte er »Typen wie Donald Trump … Vertreter einer Politik, denen jede Niedertracht recht ist«. America first – daran haben, aus nüchterner Einsicht in die geltende Weltordnung, sich seit Hitlers Krieg noch alle deutschen Regierungen gehalten, die von Moskaus Gnaden natürlich ausgenommen. Vielleicht wäre es nützlich, jenem gesegneten Land auch bei der Demontage seines Präsidenten den Vortritt zu lassen. Das schlimme Wort ›Niedertracht‹ jedenfalls, Gegenstück zur beinahe ausgestorbenen, nur noch fachsprachlich virulenten ›Hochtracht‹, mag daran erinnern, dass es in der Politik gelegentlich klug und sogar vernünftig sein kann, sich ›niederer‹ Gedanken und Motive anzunehmen, vor allem wenn sie ums Essen, Auskommen und Lebensgefühl der niederen Klassen kreisen. Die Sozialdemokratie, die davon nichts mehr zu wissen scheint, hat einst auf diese Weise Karriere gemacht. Heute lässt sie sich vor den Karren anderer Kreise spannen und sinkt.
2.
›Vertreter einer Politik, denen‹ mögen über derlei Ausfälle in puncto Anschlussfähigkeit lachen, jedenfalls gönnt man es ihnen, solange das Gelächter sie nicht zerreißt. Wie ein Vertreter wirkte Trump bisher gerade nicht, aber was nicht ist, kann noch werden. Auch die Vertreter von Charlottesville, Virginia, werden die publicity zu gebrauchen wissen, die ihrem Städtchen die Schlacht um das zur Demontage freigegebene Denkmal eines Bürgerkriegsgenerals einbrachte, ohne dass ihnen deshalb die Niedertracht, die sich da austobte, recht sein musste. Jedenfalls hat es ihr Denkmal – auf unselige Weise, wie sonst? – ins Nationalgedächtnis der Vereinigten Staaten geschafft: ein paradoxes Ergebnis, da der progressiv gesinnten Kommune gerade daran gelegen ist, es daraus zu eliminieren. Oder etwa doch nicht? Paradoxie des Banalen, Banalität der Paradoxie – die Effekte überkreuzen sich, manchmal überschlagen sie sich auch und purzeln gerade dort gemeinsam ins Ziel, wo strikte Trennung ethisch geboten wäre. Schlachten sind Merkpunkte der Geschichte. Man braucht nicht zwingend Reiterstatuen, um das zu begreifen, aber wo sie einmal vorhanden sind, bezeugen sie mancherlei, selbst Achtung, zum Beispiel vor dem – einst siegreichen oder besiegten – Feind, jedenfalls gelegentlich, spätestens dann, wenn sie verweigert wird und Purismus das Unterste der Verhältnisse zuoberst kehrt. Unter pseudoreligiös aufgeputschten Gemütern findet man Achtung bekanntlich selten, sie stürzen sich auf das ›Böse‹ wie der besiegte Römer ins eigene Schwert. Höre auf ihre Suada – wo ein Wort das andere gibt, nimmt sich die Gehässigkeit, was sie braucht.
3.
Auch Böses will organisiert sein. Organisatoren sind die Rädchen im Getriebe, manche davon funkeln und wollen ins Guinness-Buch der Rekorde. Ein schwankender Kandidat dafür wäre der Organisator jener angemeldeten Unite-the-Right-Demonstration, die offiziell gar nicht erst stattfand, weil die Gewalt schon vorher bis zum Mord eskalierte. Gestern noch, wie man liest, ein aufrechter Demokrat und Obama-Mann, heute ein Patriot, dem die drohende Entfernung des öffentlichen Artefakts die Zornröte ins Gesicht treibt: So werden Menschen kenntlich. Am Ende liegt ein Toter auf der Straße und ein Polizeihubschrauber fällt vorschriftswidrig vom Himmel. Was lehrt das? Auch Rechte werden gemacht, die Hölle, der sie, folgt man der Suada ihrer Gegner, entsteigen, ist der politische Alltag von Kleinstädten, in dem Sturm aufkommt, sobald jemand an die Geschichtstafeln rührt. Ein bereits existierender Wikipedia-Eintrag für den Herrn soll wieder gelöscht werden und parodiert damit das Schicksal des provinziellen Reiterstandbildes, das ihm den kurzen Anlauf zum Ruhm erst ermöglichte. Deutlich einfacher hat es der Mörder: Er ist ›drin‹ und kommt nicht wieder heraus. Er ›hat sich eingeschrieben‹.
4.
Von den rund 43 000 Einwohnern der Stadt Charlottesville lebten 2010 27,3 Prozent unter der Armutsgrenze, die Verbrechensquote lag deutlich über dem Landesdurchschnitt, bei der letzten Präsidentenwahl kamen die Republikaner auf matte 13,2 Prozent. In die Weltmedien schafften es diese (der englischsprachigen Wikipedia entnommenen) Angaben aus gegebenem Anlass nicht. Warum auch? Immerhin hat Thomas Jefferson, der hier lebte, dem Stadtbild einst architektonisch unter die Arme gegriffen: Die dem römischen Pantheon nachempfundene Rotunda der Universität wurde von ihm entworfen »to represent the ›authority of nature and power of reason‹« (Wikipedia) – ein Fingerzeig in den gegenwärtigen Wirren, aber wer spricht von Göttern. Max Webers ›Kampf der Götter‹ und ihrer diversen Wahrheiten, heruntergebrochen auf die Straßen-Prügeleien von Gesinnungskriegern, deren eine Fraktion für equal rights und diversity streitet, während die andere für glory und race und Arbeitsplätze für Einheimische in den Kampf zieht, lässt der Göttlichkeit wenig Raum, jedenfalls, solange das generöse Benehmen der Olympier den Maßstab liefert. Falls am zwölften August 2017 in Charlottesville etwas aus dem Ruder lief – und nicht gerade so gewollt wurde –, dann hatte der twitternde Präsident nicht so Unrecht, wenn er die auf beiden Seiten geübte Gewalt verurteilte, und die heftige Reaktion der Weltmedien zeigt, dass mittlerweile mehr aus dem Ruder läuft, als die Schultern der üblichen Unbelehrbaren zu tragen vermögen.
5.
Noch immer wirkt es aus deutscher Perspektive atemberaubend, wenn Menschenmengen, ausstaffiert mit Schilden, Schlagstöcken und anderem, gewisse Verletzungsgefahren bergendem Gerät – auch halbautomatische Schusswaffen wurden gesichtet –, unter martialischen Parolen zusammenströmen, um beim ersten Anlass aufeinander loszugehen – die Polizei hingegen steht daneben und wartet ab. Die Präsidentin der University of Virginia hatte bereits am vierten August die Studenten per Email vor der Teilnahme an der angesagten Demonstration und generell vor physischer Gewalt gewarnt: »There is a credible risk of violence at this event, and your safety is my foremost concern«. Dass sich rund um den General zu Pferde etwas zusammenbraute, war den Verantwortlichen, wie es stets danach heißt, klar – sie brauchten nur die Liste der angemeldeten Rechtsaußen-Organisationen durchzugehen und sich daran zu erinnern, dass die Zeichen in Trump-Amerika ohnehin auf Sturm stehen: Was im Vorjahr als Wahlkampf begann, trägt längst die Züge eines erbitterten Kampfs der Kulturen, bei dem, wie gewohnt, die Kultur als erste unter die Räder geriet. Es mutet nur seltsam an, wenn eine Seite in diesem Kräftemessen – nennen wir sie die demokratische – behauptet, die andere, wer immer zu ihr gehört, sei per se gewalttätig und also zu verurteilen, während man selbst … ja was nun? Die Hände in Unschuld wäscht? Ein Recht auf Gegengewalt postuliert, solange es gegen Nazis geht? Seite an Seite mit einer militanten Antifa kämpft? In Charlottesville scheint man sich jedenfalls kräftig untereinander geprügelt zu haben, bevor die Irrsinnsfahrt des James Alex Fields Jr. und der Absturz eines Polizeihubschraubers der Sache ein völlig anderes Ansehen gaben.
6.
Gespalten war das Land unter Obama kaum weniger als heute, gewiss nicht weniger gewalttätig und nicht weniger rassistisch. Dennoch war es dem Durchschnittsamerikaner angenehmer, sich im Glanz der ersten schwarzen Präsidentschaft zu sonnen und die herrlichen Zeiten auf morgen zu vertagen, während in den Hinterzimmern des Internet die Verschwörungstheorien qualmten. Trumps Einzug ins Weiße Haus hat den Kampf ums Heiligste entfacht und da tobt er nun. Beiläufig: es handelte sich nicht um die erste Veranstaltung gegen den Abbruch des Reiterdenkmals. Bereits am dreizehnten Mai hatte es eine »Take-Back Lee Park«-Demonstration gegeben. Die Protestierer organisierten eine Fackelwache am Denkmal, die Gegendemonstranten zündeten Kerzen an. Niemand scheint zu Schaden gekommen zu sein. Was in den Medien ebenfalls unterging: »The Ku Klux Klan held another rally in Charlottesville on July 8. About 50 Klan members and 1,000 counterprotesters gathered at a loud but nonviolent rally; the Klan members left the park after about 45 minutes.« (Wikipedia) Das Wörtchen ›nonviolent‹ lässt aufhorchen. Der Ku Klux Klan! Gegengewalt war angesagt, sobald die Parole Unite the Right der Erwartung Raum gab, dass auch Trump-Anhänger sich unter dem Südstaaten-Banner blicken lassen und die Bilder stimmen würden. Ins Bild gehört, dass, wer dies nüchtern konstatierte, vom Mainstream der Sympathie mit rechts verdächtigt wurde, wobei ›rechts‹, wie seit einiger Zeit gewohnt, für Rassismus und Sklavenhalter-Gesinnung steht. Dass der ›eher rechts‹ positionierte Präsident sich erst im zweiten und dritten Gang explizit von Rassisten und Nazis distanzierte, entsprach der politischen Logik des Geschehens: Erst musste, nach den falschen Freunden von rechtsaußen, der politische Gegner aus der Deckung kommen, damit die Botschaft, selbstverständlich lehne der Präsident der Vereinigten Staaten Nazi-Gewalt und Rassismus ab, die öffentliche Empörung ins Fach der üblichen fake news schieben konnte. Da allerdings war, nachdem einige republikanische Abgeordnete sich dem Protest angeschlossen hatten, das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Der GOP kann es nicht schmecken, wenn Trump rechts von ihr eine eigene Machtbasis zuwächst. Der Protest war ein politisches Warnzeichen, von den Medien, nicht zuletzt den deutschen, zum Einspruch der Anständigen stilisiert – eine Tracht Prügel eher als ein Fanal gegen ›Niedertracht‹.
7.
»Dass die Terroristen im Namen der Religion ›Ungläubige‹ töten, ist unerträglich.« Das schrieb, einer Pressemeldung der Deutschen Bischofskonferenz vom achtzehnten August zufolge, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Präsident der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft ComECE, Kardinal Reinhard Marx, nach den Anschlägen von Barcelona und Cambrils an seinen Amtskollegen, den Erzbischof von Barcelona. Der Kardinal fuhr fort: »Der Zusammenhalt in unseren Gesellschaften ist wichtiger denn je. Wir Christen sind herausgefordert, aufeinander Acht zu geben, destruktiven Ideologien entgegenzutreten und für Menschenwürde und Solidarität einzustehen. Die Staatengemeinschaft muss jetzt weiter intensiv darüber nachdenken, wie mit dieser Form des Terrors umgegangen werden kann.« Als Anmahnung dessen, was jetzt, angesichts des in Europa, im Nahen und Mittleren Osten und andernorts in der Welt grassierenden religiös motivierten Terrors, not tut, sind diese Sätze von schlicht bemerkenswerter – oder bemerkenswert schlichter – Transparenz. »Wichtiger denn je« sei »der Zusammenhalt der Gesellschaften« – das könnte bedeuten: er ist gefährdeter denn je, es sei denn, die lästige Angewohnheit religiöser Sprecher, gerade das momentan Unwichtige als wichtiger denn je herauszustreichen, schlägt selbst im Angesicht des Terrors durch und lässt in Wortnebeln zerstäuben, was eine seriöse Betrachtung wert wäre.
8.
Stehen Europa neue Pogrome ins Haus? Steht es am Vorabend eines Bürgerkriegs? Die Ansichten darüber, qualifiziert oder nicht, gehen weit auseinander, sie werden, das sollte nicht unbemerkt bleiben, mit Vorsatz auseinandergetrieben, nicht zuletzt durch Äußerungen wie die des Kardinals, wenngleich sie unter die moderateren fallen. Dabei zählt die Frage, ob sich die Christen durch »destruktive Ideologien« auseinander dividieren lassen, zu den weniger bedeutenden im Vergleich zu der, ob sich die Gesellschaft im Ganzen entlang ideologischer Grenzen spaltet, ohne befriedigende Regularien, die zuverlässig dafür sorgen, dass man weiterhin miteinander redet und zu pragmatischen Entscheidungen findet, mit denen jeder leben kann und leben will, weil es nun einmal so und nicht anders beschlossen wurde. Sucht man nach derlei Grenzen, so findet man mindestens zwei: erstens die Grenze zwischen dem islamischen Fundamentalismus, der den Weg nach Europa gefunden hat und – verhüllt wie unverhüllt – die Machtfrage stellt, und den eingesessenen Gesellschaften des Kontinents, zweitens die Grenze zwischen den konsenswilligen Mehrheitsgesellschaften und ihren auf Kulturkampf getrimmten Ablegern, die allgemein zur politischen Rechten gezählt werden, auch wenn die Rechnung nicht wirklich aufgeht. Offenbar sind die destruktiven Ideologien, von denen der Kardinal spricht, eher auf dieser Seite des Spektrums zu suchen. Damit erklärt er die zweite Grenze zur ersten, also zu derjenigen, an welcher der politische Kampf um den »Zusammenhalt in unseren Gesellschaften« geführt werden muss – unter tätiger Beihilfe der Christen, versteht sich. Dass es gerade Christen sind, die ob dieser Vertauschung primärer und sekundärer Frontstellungen in Verwirrung und gelegentlich in Panik geraten, kümmert den Kirchenfürsten wenig, solange er sich mit der Macht einig weiß, die den terroristischen Zweig des Islamismus als Gegenstand der Strafverfolgung begreift und sich unter dem Stichwort der Diversität mit dem zivilen ›auf Augenhöhe‹ über die Zukunft Europas unterhält.
9.
Christen mögen Gesellschaften gründen, aber sie sind niemals und nirgends die Gesellschaft. Allenfalls bilden sie, als Gläubige, eine Gemeinschaft, die sich just durch ihren Glauben, wie die der Muslime, von der Gesellschaft absetzt. Gesellschaft existiert dort, wo Menschen mit unterschiedlichen Glaubensbekenntnissen neben einander existieren, ohne dass es ihren Verkehr untereinander beeinträchtigt oder aufhält. Insofern ist, wie der Kardinal richtig anmerkt, die Gesellschaft unter die besondere Obhut der Gemeinschaften gestellt – aber nur, insofern sie sich zu zügeln haben und die Glaubensbereitschaft ihrer Anhänger nicht in den Bereich gesellschaftlicher Grundüberzeugungen hinein strapazieren. Wo dies dennoch geschieht, liegen Terror, Gesinnungsterror und Tyrannei gleich um die Ecke. Die Mobilisierung von Christen als Christen gegen missliebige politische Überzeugungen mag en vogue sein, gesellschaftspolitisch gesehen ist sie ein Fehler – abgesehen davon, dass sie selbst unter Glaubenschristen Unfrieden stiftet. Nichts fällt Demagogen leichter als die Etikettierung gegnerischer Überzeugungen als ›destruktiv‹ – schließlich will man selbst ›etwas aufbauen‹ –, und nichts erleichtert die Feindkennung mehr als das Etikett ›Ideologie‹, vor allem, solange das Gemeinte hinter einem gemurmelten »Haltet den Dieb!« verborgen bleibt. Wenn gesellschaftliche Grundüberzeugungen eine Gemeinschaft formen, dann die der Demokraten, sofern sie willens sind, jeden Glaubensansturm auf das liberale Gemeinwesen abzuwehren, das ihre Lebensart garantiert. Sobald religiöse Grundüberzeugungen eine Gesellschaft zu formen beginnen, ist es früher oder später mit dem ungehinderten Nebeneinander der Bekenntnisse vorbei und ›Gesellschaft‹ degeneriert zur Verfügungsmasse des Staates, der, mangels eines zivilen Widerparts, autoritäre Züge annehmen muss, gleichgültig, wie ›aufgeschlossen‹ sich seine Vertreter gebärden. Solche Veränderungen vollziehen sich schleichend, sie lassen, bei hinreichender Klugheit der Akteure, die staatliche Hülle lange bestehen, bevor eine zweckdienliche kleine Rochade, wie in der Türkei zu besichtigen, sie schließlich dem Umbau preisgibt.
10.
Was bedeutet Augenhöhe? Wie stellt sie sich her? Letzteres kommt, wie bei genuin politischen Begriffen üblich, auf die ›Partner‹ an, die einander von Fall zu Fall gegenüberstehen. Selten sind beide gleich gewachsen, es liegt daher nahe, dass einer von beiden sich bücken muss, dass er sich unwillkürlich zu bücken bereit ist, um dem anderen von gleich zu gleich zu begegnen. Das kann ins Auge gehen. Erfolgversprechender, wenngleich anstrengend, ist es daher, den anderen zu sich emporzuheben oder ihm einen Schemel unterzuschieben, um dort Gleichheit zu simulieren, wo, unter gleichen Bedingungen, von ihr nicht die Rede sein kann. Einen solchen Schemel schiebt der Kardinal den Wortführern des politischen Islam mit dem Satz hin: »Dass die Terroristen im Namen der Religion ›Ungläubige‹ töten, ist unerträglich.« Religiöse Terroristen, jeder weiß das, töten im Namen des Gottes, dessen Tötungsgeheiß sie zu erfüllen glauben, so wie Gerichtsurteile ›im Namen des Volkes‹ ergehen und nicht im Namen der Justiz. Was wie Wortklauberei klingt, ist ›in Wahrheit‹ die Seele des Spiels: Terroristen berufen sich nicht auf die Religion, sondern auf ihre Religion, die einzig legitime in ihren Augen, die einzige überdies, die ihnen, ihrer festen Überzeugung nach, freie Hand gibt, das in allen Religionen, die diesen Namen verdienen, gottgegebene Tötungsverbot für sich selbst gewinnbringend zu übertreten.
11.
Die erste Frage des Religionsvertreters an seine Kollegen vom anderen Glaubensufer müsste also sein, ob die Tötung von ›Ungläubigen‹ in ihrer Gemeinschaft als legitim angesehen wird oder nicht – wo, von wem, wann, von wie vielen, mit welchen praktischen Konsequenzen. Die zweite, nicht minder selbstverständliche, nicht minder brisante, wäre die, zu welchen Maßnahmen religiöse Extremisten – die dann wohl einfach ›Eiferer‹ genannt werden dürften – ihrer Auffassung nach denn greifen könnten, sobald sie aus einem unerklärlichen Großmut heraus auf die Tötung von ›Ungläubigen‹ zu verzichten beschlössen, und welches gemeinsame Ziel dann noch hinter all dem gesellschaftlichen Engagement friedlicher Glaubenskreise erkennbar würde. Man mag es glauben oder nicht, aber diese einfachen Fragen sind offenbar in bestimmten Vertreterzirkeln tabu. Sie stellen hieße, die Karten aufzudecken und einzugestehen, dass der religiös garantierte gesellschaftliche Frieden stets ein erkaufter Frieden und also Unfrieden ist – ein Frieden ohne Substanz, es sei denn der religiösen, die per definitionem an den Grenzen der Gemeinschaft endet und im unverbindlichen Palaver über Religionsgrenzen hinweg, ›interreligiöser Diskurs‹ genannt, in bloße Friedfertigkeit – oder ihren Anschein – übergeht, die, wie in Ländern üblich, die dergleichen Mechanismen vertrauen, jeden Augenblick in Chaos und Gewalt umkippen kann.
12.
Man kann das Gewaltproblem von dem der aufeinanderprallenden, zu Glaubensbekenntnissen hochgeputschten Gesinnungen zu trennen versuchen – Tweet eins des amerikanischen Präsidenten nach den blutigen Ereignissen von Charlottesville –: dann kommt man dem humanen Anliegen des Kardinals ziemlich nahe. Man kann beides untrennbar miteinander verbinden wie die politischen Gegner Trumps, die ihn unverzüglich in die Nähe von nazism und racism rückten, weil er es gewagt hatte, die Gewalttätigkeiten beider Seiten zu kritisieren, ohne ›rechte‹ Gesinnung explizit als per se gewalttätig – und entsprechend die Gegengewalt als eingeschränkt legitim – zu charakterisieren. Dann muss man den Vorwurf gewärtigen, unter der Maske des politischen Anstandes wider besseres Wissen zusammenzubringen, was nur im – allseits geächteten – Ausnahmefall zusammengehört. Wie aber lässt sich vor diesem Hintergrund das Schweigen des Amtschristentums deuten, das sich mit verbalen Kunststückchen über die offen zutage liegende Verbindung von mörderischer Gewalt und Islam in den Taten der Terroristen hinwegmogelt? Wie die Insinuation, Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden erwüchse ausschließlich an jener zweiten, sekundär errichteten Front, während die Ursache – anders als der periphere Anlass – ihrer Entstehung ins nahezu Unsichtbare verschoben wird? Macht sich, wer systematisch verschweigt, beschönigt, kleinredet oder leugnet, was vorgeht, mitschuldig an gewaltsamen Entladungen, denen angeblich seine ganze Sorge gilt? Die letzte Frage wird oft gestellt und selten beantwortet, schon gar nicht von denen, die aufgefordert wären, Rede und Antwort zu stehen. Warum?
13.
Der Vorschlag, Überfremdungs- und Terrorängsten durch Kirchgang und Predigt entgegenzuwirken, um dadurch die gesellschaftlichen Kräfte der Zukunft auszubalancieren, verschiebt die Religionen und ihre Repräsentanzen in den Bereich politischer Entitäten: die Kirche, die jeweils eigene Religionsgemeinschaft schützt und trägt den Einzelnen, den der abzusehende Verlust an kultureller, sozialer und nicht zuletzt politischer Substanz des Gemeinwesens drückt, sie nimmt ihm das Denken ab und beglückt ihn stattdessen mit der differenzlosen Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Gläubigen. Unverkennbar liegt darin eine Absage an die gelebte Verfassung, in der Regierung und Parteien, als Gestalterinnen des politischen Raumes, allein den gleichen und freien Einzelnen Rechenschaft schulden – den Bürgern, die zusammen den Staat ausmachen, ohne darin durch religiöse Rücksichten beengt oder bestimmt zu sein. Es enthält ein bizarres Stück Willkommenskultur, das Staatsverständnis der Bürger geduldig so lange zu verschieben, bis es strukturell dem einwandernden Islam und seinem umfassenden, von keinem Euro-Islam und keinem Islam light auszuhebelnden, in den Fixpunkten Umma und Scharia ruhenden Religionsverständnis kompatibel wird. Das mag, zum gegenwärtigen Zeitpunkt – und noch ein wenig darüber hinaus –, übertrieben klingen, doch die frommen Ergüsse einer aktiven Riege von Politiker*innen lassen nicht viel Gutes erwarten, es sei denn, man erwartet sein Heil von den patentiert Guten und verzichtet darauf, den Kantischen »Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit« in politicis zu praktizieren.
14.
In einer Zeit, in der so weitreichende Verschiebungen im Bereich des Politischen in Gang gesetzt werden, empfiehlt es sich, einen bouc émissaire, einen Sündenbock zur Hand zu haben, der, neben den Sünden der Gemeinschaft, auch die Vernunft der Regierten hinwegnimmt. Dass die Wahl auf Donald Trump, den gewählten Präsidenten der westlichen Führungsnation fiel, wirkt, unter staatsreligiösen Gesichtspunkten, mehr als plausibel. Anders als europäische Politiker der äußersten Rechten drückt Trump nicht die Last ererbter Parteiprogramme – ihm deshalb Narzissmus zu unterstellen, bedeutet indirekt, dem Einzelnen das verfassungsmäßige Recht abzusprechen, in Belangen des eigenen Staates dem eigenen Urteil zu folgen und sich damit dem Urteil des Wahlvolks zu stellen. Amerikanisch gesprochen: Wer selbst reich ist und daher nicht zu Diensten steht, ist eine Gefahr für die Demokratie. Diesem simplen, wenngleich unendlich variierbaren Muster folgen Europas Kommentatoren nur bedingt. In ihren Augen ist Trump die Verkörperung all dessen, was der etablierten Politik im hiesigen Alltag zu schaffen macht – allem voran das unruhige Wahlvolk – populus –, dem die weit geöffnete und sich weiter öffnende Schere zwischen Armut und Reichtum, zwischen Euro-Versprechen und Euro-Risiken, zwischen illegaler, durch EU-Flüchtlingsrecht notdürftig kaschierter Masseneinwanderung und den obligaten Sicherheits- und Sozialversprechen, zwischen friedlicher kultureller Vielfalt und gewaltgeränderten Übernahmephantasien seitens religiös und ethnisch motivierter Minderheiten, zwischen öffentlicher Rede und tatsächlichem Regierungshandeln teils Hören und Sehen blockiert, teils das Gefühl eingibt, Europa habe seine Zukunft bereits verspielt und es gelte, für sich allein zu retten, was davon noch zu retten ist. Trump der Populist ist eine europäische mehr denn eine amerikanische Figur, vor allem eine deutsche – einfach deswegen, weil die Furcht, für die fetten Jahre irgendwann zahlen zu müssen, hier am verbreitetsten ist und daher die meisten Stimmen zu mobilisieren imstande wäre. Als einziger Präsidentschaftsbewerber besaß Trump die Stirn, Amerikas Schuldenlast, das sie unentwegt steigernde Außenhandelsdefizit und die Lage der (nicht-)arbeitenden Klassen im Mutterland des Kapitalismus abseits der Hochglanz-Branchen offen zu benennen und Remedur zu versprechen. Das drang zwar kaum bis zum deutschen ARD-ZDF-Konsumenten durch, aber das Loch in der Berichterstattung blieb groß genug, um das Vertrauen in die routinierten ›Eliten‹ auch diesseits des Atlantik nachhaltig zu untergraben.
15.
Gerecht sein – ja wer wollt’ es nicht. – Lange Zeit hieß gerecht sein nichts weiter, als die Beute im Kreis der Familie, im Kreis der Seinen, im Kreis der Gemeinschaft angemessen zu verteilen. ›Angemessen‹ ist ein dehnbarer Begriff, daran haben der Gang der Jahrtausende und der Wechsel der Systeme wenig geändert. Erst die Gesetzestafeln göttlicher oder menschlicher Provenienz stellten den Begriff der Gerechtigkeit auf eine berufbare Grundlage: Dort, wo nach Recht und Gerechtigkeit, ohne Ansehen der Person, geurteilt wird, herrscht per definitionem Gerechtigkeit, es sei denn, das Gesetz selbst erweist sich als korrumpiert – ein schwieriger, bis heute nicht ausdiskutierter Grenzfall der Juristerei. Hingegen herrscht an der Grenze zweier Rechtssysteme naturgemäß Unklarkeit. An ihr kann es nur Ausgleich statt Gerechtigkeit, Vertragssicherheit statt Rechtssicherheit geben. Gerechtigkeit ohne Rechtssicherheit ist ein hohler Titel, wie die türkische AKP, die ›Partei der Gerechtigkeit‹, gerade erfährt. Da nützt es wenig, die göttliche Weltordnung auf seiner Seite zu wissen – die Opposition, soweit religiös fundiert, ist sich ihrer Sache ebenso sicher und darf es, mangels einer übergeordneten Instanz, auf eigene Rechnung auch sein. Es schickt sich daher nicht, in einem funktionierenden Rechtsstaat ›mehr Gerechtigkeit‹ zu fordern, schon gar nicht zu Wahlkampfzwecken. Es bedeutet entweder, den existierenden Rechtsstaat in Frage zu stellen – etwa durch Anbiederung an religiöse Systeme –, oder überhaupt nichts, was zwar, immer zu Wahlkampfzwecken, das Übliche ist, aber einen schalen Nachgeschmack hinterlässt. Was den Wunsch nach mehr ›sozialer Gerechtigkeit‹ angeht, so kann kein gender gap von der Aufgabe entbinden, das rechtlich Regelbare daran in Zahlen und Rechenexempel zu verwandeln – immer mit der Aussicht, das eigene verflossene Regierungshandeln vorgerechnet zu bekommen und von der Konkurrenz überholt zu werden – zu Wahlkampfzwecken, wozu sonst?
16.
Eine Politik der Niedertracht, wie ließe sie sich skizzieren? Anders als die clownesken Einlagen seiner frühen Wahlkampf-Auftritte und ein weltweit fluktuierendes Zerrbild vermuten lassen, ist Trump als Mann des Ausgleichs gestartet, der den anhaltenden Glaubenskrieg zwischen Demokraten und Republikanern gern zugunsten eines pragmatischen Politikverständnisses beendet hätte. In gewisser Weise denkt er noch immer so – ein weitgehend ideologiefreier ›Entrepreneur‹, dessen erste Sorge dem Geschäft gilt, dem seine große Familie am Herzen liegt und dessen Sicht auf Nation und Welt offenkundig zwischen diesen beiden Polen oszilliert. Dieses Muster, auf die Weltmacht USA und in gewisser Weise auf den Westen projiziert, lässt den bisherigen Zickzackkurs seiner Politik erstaunlich geradlinig erscheinen. Die Funktionsmodelle Geschäft und Familie sind, wenngleich nicht ohne Friktionen, recht gut auf das übertragbar, was man hierzulande Gesellschaft und Gemeinschaft nennt: zwei unterschiedliche Weisen, teils dieselben, teils unterschiedliche Aktionsfelder zu thematisieren und zu bestellen. Während das Geschäft vom Misstrauen lebt, darf die Familie vom angehäuften Vertrauenskapital zehren und bekommt, wann immer es nötig erscheint, einen Extra-Vorschuss. Es ›macht daher Sinn‹, zur Familie zu zählen, will man auf günstige Konditionen, zum Beispiel im bilateralen Handel, hoffen. Wie es scheint, wurde das in den asiatischen Wirtschaftszentren und wohl auch in Frankreich begriffen, nicht jedoch in Deutschland, das auf ungebremste Konkurrenz, vor allem im Ideologischen, setzt. Zwischen konkurrierenden Familien, vor allem religiös aufgerüsteten, herrscht immer Niedertracht. Fromm sein wollen und nicht begriffen haben – diese eigenartig deutsche Mischung verlangt geradezu nach der Ohrfeige, auch wenn sie, zum Vorteil derer, die uns regieren, erst nach der Wahl ansteht.