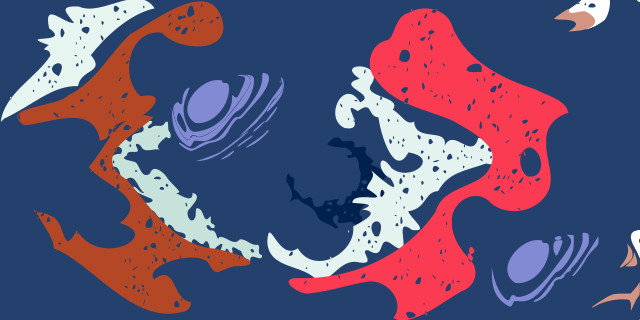von Ulrich Siebgeber
Paul Feyerabend
Der Thomas Mayer zugeschriebene Einfall, den Griechen eine Parallelwährung (womöglich in Anlehnung an den doppelgesichtigen Geusenpfennig der aufständischen Niederlande von 1566 ›Geuro‹ genannt) zu gewähren, ›um ihnen den Verbleib in der Euro-Zone zu ermöglichen‹ – und sie verblieben dort bis ans Ende ihrer Tage –, klingt in seiner klugen Schlichtheit wie die Ansage an Bord eines untergehenden Schiffes, man werde die Fahrt nun unter Wasser fortsetzen, um die Sinkgefahr zu vermindern.
Sicher wurde der Vorschlag unter Währungshütern allerorts durchgerechnet, bevor man ihn der Öffentlichkeit zur Kenntnis brachte. Die Sache ist also machbar. Den ökonomischen Laien wundert das nicht, da ihn in dieser Angelegenheit ohnehin nichts wundert, es sei denn die Langmut des großen Publikums, die vielleicht auch nur gespielt ist. Natürlich: ein Euro der zwei Geschwindigkeiten, dass wir nicht gleich darauf gekommen sind! So geht’s. Oder auch nicht. Wer soll das entscheiden? Im Prinzip ist das Ganze ein Problem der Ökonomen, sollen sie sich darum kümmern. Das Volk ist unmutig, es will nun Taten. Wenn, wie Egon Bahr überzeugt ist, 99 Prozent der Mitmenschen nicht verstehen, mit welchen Methoden ihnen heute und morgen das Geld in der Tasche umgedreht wird, bevor es daraus diffundiert, und aufgehört haben, die Vorgänge etwa um den Euro-Rettungsschirm im Einzelnen zu verfolgen, dann lassen sie sich auch ein wenig von der Botschaft verführen, diese Krise sei alles in allem nicht so schlecht für die hiesige Wirtschaft. Jedenfalls streicht sie den Standort kräftig heraus. Was soll daran schlecht sein? Das Kraftwerk Deutschland ist zu allerlei gut, eine Aufgabe braucht das Land. Das verbliebene eine Prozent ist vielleicht nicht besser im Bilde, dafür verfolgt es die Vorgänge heftig in Wort und Bild, sprich öffentlicher Körpersprache, und hat damit bereits Öffentlichkeitsgeschichte geschrieben.
1.
Schleichend und doch wieder rasend schnell ist aus der Zweidrittelgesellschaft die 99 : 1-Gesellschaft geworden. Will man den Aufgebrachten glauben, sind es die Banken gewesen, die uns in diese Kalamität gestürzt haben. Das Wort ›Bankraub‹ meint heute etwas anderes als noch vor fünf, zehn Jahren, nur die Banker sehen das anders, nicht ganz zu Unrecht. Schließlich leben nicht 99% der Bevölkerung unterhalb der durch soziale Teilhabe definierten Armutsgrenze, das Gros lebt gut und will es dabei bewenden lassen, es mag nur nichts verlieren. Indessen verliert es ununterbrochen, wie die reversible 99 : 1-Formel anschaulich belegt. Es verliert, was es vielleicht niemals hatte, aber haben zu können glaubte – die Fähigkeit zur Mitsprache. Im Vergleich zu dem, was vorgeht, war Stuttgart 21 ein Possenspiel, doch es reichte, um die Machtverhältnisse im Ländle umzustülpen und also war es bedeutsam. Nur: wer glaubt, hier sei eine Schlacht um öffentliche Mitsprache geführt und gewonnen worden, der sollte sich an die Nase fassen und einmal im Kreis herumdrehen. Ich will dieses Rezept nicht patentieren lassen, ich habe es selbst geerbt und plaudere es nur aus. Die Occupy-Bewegung mit ihren diversen Fortsetzungen hat da einen anderen Nerv getroffen. Nur um die europäischen Institutionen bleibt alles ruhig und das ist gut so. Schließlich schlummert in diesen Bienenstöcken das pure Gold, unser aller Zukunft, und will nicht geweckt werden. An die Emsigkeit seiner Verwalter, das ewige Treppab und Treppauf, hat es sich gewöhnt, und nun, nachdem der ESM Europa richtig mit Geld ausstattet, darf es noch friedlicher schlafen, während die Behörden schon einmal auswärts speisen.
2.
99 : 1? Mitnichten. 999 : 1? Vielleicht. Man soll den Bevölkerungen kein vernichtendes Urteil ausstellen, es schickt sich nicht und kehrt sich gegen den Schreiber. Die Bevölkerungen haben ihr Wort lange gesprochen und wiederholen es ununterbrochen bei jedem Urnengang: sie sind überzeugt davon, in Europa zu leben, sie wollen sich, außer in Zeiten nationaler Aufwallung, nicht daraus entfernen lassen, sie wollen Kommerz, Kultur und Verkehr, sie wollen Bewegungsfreiheit, aber sie wollen den großen Zusammenschluss nicht – nicht die Bürokratisierung aller Lebensbereiche, nicht die Ökonomisierung aller Lebensbereiche, nicht die Egalisierung aller Lebensbereiche und schon gar nicht den einen Staat Europa. Nun, sie werden ihn nicht bekommen, nicht zuletzt dank der Hartnäckigkeit der britischen Nachbarn. Unterdessen betrachten die, die es angeht, mit muffigen Gesichtern das ›Euroland‹ genannte Gebilde und vermuten dahinter, wohl nicht zu Unrecht, das alte Europa der zwei Fraktionen: während ein Teil seiner Politiker sich der Naherwartung verschrieben hat und alle Register zieht, will der andere die ökonomische Homogenisierung und sonst nichts. Zu ersterem gehört offenbar der deutsche Finanzminister, der noch im vergangenen Jahr die Finanzkrise öffentlich als Hebel bezeichnet hat, um die institutionelle Einigung, die seit dem Verfassungsdebakel ›Ausbau‹ heißt, voranzubringen und, einmal mehr, ›unumkehrbar‹ zu gestalten. Was nicht unumkehrbar ist, lässt sich hierzulande nicht verkaufen. Das klingt merkwürdig vor der Folie des obligaten Kirchentags-Christentums, das von der Umkehr lebt, weniger merkwürdig natürlich im Wissen um den historischen Doppel-Treibsatz, der die Deutschen noch immer, nun ja, antreibt. Ob der Holocaust-Verweis der öffentlichen Erregungs-Meister das so genau trifft, möge dahingestellt bleiben. Auch die Griechen wollen die Zuwendungen schließlich für sich. Ein Volk, das mittels seiner Repräsentanten die Parole ausgibt: »Haltet mich fest, sonst vergesse ich mich«, bietet, unter Demokraten, schon einen eigentlich unkommentierbaren Anblick.
3.
Europa ist das einzige Nicht-Land auf dem Planeten, das sich ein Parlament hält, aus dem vielleicht heraus vielleicht irgendwann einmal Regierungen gewählt werden, die dann dieses Staat gewordene Nicht-Land, bestehend aus Staaten, deren meist fester Wille es ist, genau diesen Staat zu verhindern, regieren sollen. So tunkt die Hand des Atheisten wie aus Versehen ins Weihwasserbecken. Die Euro-Zone, die da schon weiter ist, besitzt kein Parlament. Sie kann auch keines brauchen, da sonst offenbar würde, in welchem Ausmaß sie seit ihrem Bestehen Kräfte aus Europa abzieht – damit meine ich keine Arbeitskräfte, bewahre, wohl aber intellektuelle Ressourcen. Die Euro-Zone paralysiert das Nachdenken über Europa, sie paralysiert sogar das Nachdenken über sich selbst, weil sie die ganze Aufmerksamkeit und das ganze Misstrauen der Menschen auf die Währungsfrage fokussiert. Das erstaunt, hat man die Versicherung von Ökonomen-Seite im Ohr, der Euro sei schließlich kein ökonomisches, sondern ein politisches Projekt mit teils gewollten, teils ungewollten ökonomischen Folgen. Als politisches Projekt giert es nach transstaatlicher Finanzhoheit und lässt sich, die Krise bezeugt es, von den Märkten gern weiter in diese Richtung drängen. Die Finanzhoheit, man hört es gerade wieder, ist aber die Souveränität selbst, sieht man von der Entscheidung über Krieg und Frieden einmal ab. Dass die Euro-Länder Souveränität abgegeben haben, dass sie mehr Souveränität abgeben müssen, kennt man nicht nur als Gebetsmühle der je amtierenden Bundesregierung. Es ist auch, nach Auskunft von Marktanalytikern, die Quelle der Euro-Krise selbst, da die Staaten nicht mehr die notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von Währungsrisiken auf ihrem eigenen Territorium ergreifen können, während ›Europa‹, Euroland also, es noch nicht vermag. Die Souveränität liegt in diesem Fall nicht auf der Straße, sondern in den Tresoren der EZB und kann nicht heraus, während der demokratische Souverän, das Volk, vor den Banken randaliert oder verhüllten Blicks seines Weges eilt.
4.
Bekanntlich existieren in Europa ein Nicht-Staat, der noch nicht, und eine Reihe von Teilstaaten, die nicht mehr souverän sind. In dieser nach zwei Seiten offenen Schachtel macht das böse Wort von der Postdemokratie die Runde. Genausogut könnte man von der Prä- oder Protodemokratie Europas sprechen. Wirklich reden ein paar Unentwegte noch immer so. Allein es fehlt der Glaube. Im fünften Jahrzehnt der Römischen Verträge ist das Vertrauen in die alleinseligmachende Kraft der europäischen Prozesse auf Null gefallen. Er wird sich daraus ebenso wenig wieder erheben wie der real existierende Glaube an den Sozialismus aus der Schmach des Prag-Einmarsches 1968. Dies anzuerkennen wäre ein erster Schritt – wohin? Zu mehr Europa? Zu noch mehr Europa? Zu einem anderen Europa? Das wird es so schnell nicht geben. Dieses Europa ist auf eine lange Dauer angelegt und die Phraseologie der postnationalen Ära bleibt keinem seiner Bewohner erspart. Dabei ist in der Formel der Denkfehler fast mit Händen zu greifen. Europas Nationalismus ist perdü, seit sich aus ihm keine Großmächte klassischen Zuschnitts mehr zimmern lassen. Nicht aber sind es seine Nationalismen. Einige der frühen Macher Europas hatten gehofft, sie würden sich im Laufe der Zeit zu bloßen Regionalismen verflüchtigen. Das ist ersichtlich nicht der Fall. Alles andere als perdü ist der Nationalismus von Staaten, die ihn sich aus unterschiedlichen Gründen leisten können – also die ganz großen und die ganz kleinen. Die Bundesrepublik, die ihn sich am wenigsten leisten kann, erlebt verwundert an seinen Bildschirmen, wie leicht sie ins Fadenkreuz befreundeter Ressentiments gerät, sobald sich damit Politik machen oder irgendein kurzfristiger Vorteil erbeuten lässt. In den europäischen Nationalismen, mit ihrem Doppelgesicht aus freundlich-einladender Folklore und fratzenhafter Fremdenabwehr, rumort der alte Souverän, das Volk, seit sich die Eliten im postnationalen Machtpoker – der heute vor allem im Finanzbereich spielt – den Märkten verschrieben haben. Er rumort dort, aber er tritt nicht heraus. Ohnmächtig verharrt er in seinen fotogenen Protestformen, in seinen Blogs, seinem Online-Gestammel, seiner intellektuellen Nullität, seiner Unfähigkeit, sich zu überschreiten und, wie es im Jargon so schön heißt, ›neu zu erfinden‹. Lechts und rinks kann man nicht velwechsern, kalauerte Ernst Jandl einst zur Freude einer anderen Republik. Man nicht, die schon.
5.
Euroland existiert als Teil eines Nicht-Staates, Europäische Union genannt. Dessen Institutionen lassen sich von Nationalstaaten für bestimmte Zwecke – die unbestimmt genug sind – ein Geltungsgebiet spendieren. Das Geltungsgebiet des Euro wiederum ist als Teilmenge und sonst nichts konzipiert und rechnet auf Zuwachs aus den anderen EU-Ländern. Es ist also auf Nicht-Identifikation seitens seiner Bewohner angelegt. Dementsprechend zeigen sie ihm die kalte Schulter. Nicht-Identifikation erzeugt Nicht-Solidarität, sprich: das Gegenteil dessen, was finanzpolitisch angesagt ist. Das allein würde begreiflich machen, warum die menschliche Solidarität der Bevölkerungen in diesem Raum, die zweifellos besteht, sich nicht fiskalpolitisch verrechnen lässt. Es lässt auch begreiflich werden, warum der Euro, mit keineswegs nachlassender Tendenz, von so vielen als schwärende Wunde empfunden wird, als falsche Währung, von der es sinnigerweise, die Griechen demonstrieren es, keine Rückkehr zur richtigen gibt. Aber es gibt eben auch kein Vorwärts. Die ganze EU wird diese Währung nicht wollen und die halbe besitzt weder den Willen noch die institutionellen noch die emotionalen Hebel zur Staatsbildung. Das macht die Eurozone zum klassischen ›Block‹ mit einer – in formeller Freundschaft umarmten, subkutan mehr oder minder verhassten – Leitmacht und ängstlich auf ›Augenhöhe‹ bedachten Partnern. Hat dieses Land das gewollt? Haben wir das gewollt? Und wollen es die anderen?
6.
Natürlich haben ›wir‹ es nicht gewollt. Wir, der demos dieses Landes, hatten einmal gedacht, der Kontinent habe seine Doppel-Lektion begriffen und habe sich aufgemacht, in einem fairen Miteinander die Schwellen zwischen den nationalen Gemeinwesen zu senken und sie auf diese Weise gegeneinander zu öffnen – als das ›gemeine Wesen‹, das heißt als die Art, wie Europäer ihre Angelegenheiten organisieren. Ein gemeinsamer Arbeitsmarkt, Angleichung elementarer Lebensverhältnisse, Grenzen ohne Kontrollen, eine Währung für alle, das war auch ein Auftrag an die Politik und es gab Zeiten, in denen die Politik das bestens verstand und wusste, dass sie populär war, solange sie die sich bietenden Gelegenheiten ergriff, um diese Dinge zu realisieren. Den Rest, dachte man, würden die Bevölkerungen untereinander regeln, vorausgesetzt, man brächte ihnen in den Schulen eine gemeinsame Verkehrssprache bei und die Medien nähmen es mit ihren Informationspflichten hinreichend genau. Die Brüsseler ›Regelungswut‹ in allen Ehren, aber ernst nehmen, schon gar als Angriff auf die nationalen Souveräne, wollte sie lange niemand. Die Frage, ob es irgendwann die Vereinigten Staaten von Europa geben werde, ob es sie geben sollte oder doch lieber nicht, taugte für festliche Anlässe oder zu Debatten in jenem wunderlichen Parlament, in dem zu sitzen sicher eine Ehre darstellt, in dem ein ernsthafter Politiker sich aber irgendwie abgeschoben vorkommen muss. Es war eine Horizontfrage, nicht mehr, nicht weniger. Für einen, der es vorzog, am Horizont nichts zu sehen, ging die Reise nichtsdestoweniger weiter. Seit den Europäern das Lachen über genormte Gurken vergangen ist, ist auch dieses Idyll zerstoben. Europa besitzt eine Außenministerin und sie ist ihm peinlich (nicht als Person, die seine Einwohner gar nicht kennen, sondern als Funktionsträgerin), Europa besitzt keine Verfassung, aber einen Lissabon-Vertrag, es besitzt eine Währung, aber keine gemeinsame, ihm wird gerade eine intergouvernementale Fiskalpolitik eingepflanzt, die beim Volk als Teufelswerk gilt, es entbehrt noch immer der gemeinsamen Öffentlichkeit und es fühlt sich geduckt, überrollt, übervorteilt, um nicht zu sagen: getäuscht. Wodurch? Durch die Politik? Was soll das sein? Durch den Gang der Dinge? Das klingt etwas allgemein, aber es trifft einen Nerv. Spätestens seit der Schengen-Vertrag auf offener Straße als Sicherheitsrisiko gehandelt wird, dämmert auch dem letzten der Mohikaner, dass die Reise in die Zukunft einen etwas anderen Verlauf genommen hat und dass der Horizont nicht aus einem Punkt besteht, sondern aus einer 360-Grad-Linie, die alle Möglichkeiten einschließt, vor allem solche, die keiner für möglich hält. Europa hat noch eine Zukunft, aber es ist keine mehr.
7.
Womöglich hätte man besser hinhören sollen, als einst der Außenminister Fischer mit seiner Kursansage in Richtung europäischer Föderation von den restlichen EU-Regierungen zurückgepfiffen wurde, womöglich hätte man genauer zuhören können, als der tschechische Präsident Václav Klaus den gar nicht amüsierten Kollegen seinen vielgerügten Vergleich zwischen der EU und dem Warschauer Pakt hinschob, vielleicht hätte man auch die Sprache des nationalistischen Mobs quer durch alle Länder des Kontinents genauer analysieren müssen, um zu begreifen, in welch gefährliche Lage eine gouvernantenhafte Politik sich hineinmanövrieren musste, die sich kühlen Herzens die Finanzkrise als Chance verschrieb, die europäischen Dinge neu zu ordnen – sub specie der Idee jenes supranationalen Gemeinwesens, das in Europa nun einmal keiner will, obwohl es vermutlich, würde es einmal das Licht der Welt erblicken, rasch akzeptiert werden würde. Ein verschrieenes Deutschland als zwangsintegrierende politische Kraft in der Mitte Europas: das geht nicht, das geht ganz und gar nicht, selbst dann, wenn es funktionieren sollte. Und zwar nicht wegen, sondern trotz seiner Vergangenheit: man nimmt ihm die Dauer-Demut nicht ab, die fortwährende Versicherung, es könne kein Wässerchen trüben, weil es doch seine Lektion gelernt habe. Für etwas zu sein heißt nicht automatisch, es hier und jetzt herbeiführen zu müssen. Die Frage, ob Europa reif sei für Europa, wird nicht in Berlin entschieden (auch nicht in Paris oder Athen oder Madrid). Es ist reif, sobald die Menschen es wollen, das heißt, sobald der neue Souverän sich konstituiert. Ohne Souverän wird es kein souveränes Europa geben, man mag den Leuten die Wahlurnen hinschieben, sooft man will.
8.
Vermutlich sollte, wer der eigenen und fremden Nationen das Aufgehen in einem supranationalen Machtgebilde empfiehlt, zuerst gelernt haben, die eigene als Nation unter Nationen zu sehen, als ganz normale Nation sozusagen, auch wenn eine solche Übung für eingefleischte Über‑, Post‑, Prä‑Nationalisten das Unmögliche streift. Vermutlich sollte, wer seine Lehren aus der Geschichte gezogen hat, auch den Gemeinplatz der Historiker mit in seine Überlegungen einbeziehen, dass es die Geschichte eines Landes, einer Region, eines Kontinents nur als vielstimmige Überlieferung von Gewusstem, Behauptetem, Erschwindeltem und Erträumtem gibt, die als solche in keines Menschen Kopf Platz findet. Natürlich wissen auch die Deutschen, dass sie die Geschichte nicht gepachtet haben. Falls sie gegenwärtig das Gefühl haben, im Falle Griechenlands eine Ausnahme machen zu müssen, wäre es nur gerecht, wenn ihnen die ›Wiege Europas‹ eine angemessene Abfuhr erteilte. Sie haben Olympia ausgegraben, sie deklamieren den Sophokles und bräunen ihren Hintern unter griechischer Sonne, das sollte, könnte man denken, doch reichen. Glaubt man in Griechenland, die deutsche Geschichtskompetenz in aller Nüchternheit expropriieren zu können, dann wäre das hierzulande eine gute Gelegenheit, sich gleichfalls aufs Geschäftliche zu besinnen und nicht länger den Stier zu geben, der auf seinem Rücken Europa nach Europa trägt. Man könnte sich dann auch die Kenntnis der Mentalität des anderen fürs Anekdotische aufbewahren, wo es hingehört, und müsste sie nicht im »Bild«-Ton unter die Leute bringen, die wissen wollen, was der Staat mit ihrem Geld vorhat. Nation building im Schatten der Akropolis? Ganz ohne Nato-Spezialtruppen und Drohneneinsatz? Nun, man kann auch Eulen nach Athen tragen. Solange die Deutschen das Gefühl haben, die anderen müssten von ihnen lernen, wie man ein guter Europäer ist, wird aus der Sache sowieso nichts.
9.
Nach soviel ›womöglich‹ und ›vermutlich‹ tut ein bisschen Grund unter den Füßen gut. Die heutige EU ist zu groß und vielstimmig, um für einen künftigen Staat ›Europa‹ in Betracht zu kommen. Euroland, das der Kern-EU mit ihrem alten Wunsch nach ›vertiefter‹ Integration viel näher liegt, definiert sich über die Währungsunion und sonst nichts – es definiert sich über ihr auseinander, sollte man der Genauigkeit halber sagen. Wichtiger aber bleibt dieses ›und sonst nichts‹, hinter dem der sacro egoismo der europäischen Staatenwelt aufscheint – der Stoff, aus dem Europa gemacht ist, das angeblich alle so lieben, dass sie ihm lieber heute als morgen den Garaus zu machen gedenken. Wollen sie es? Profitiert nicht ganz selbstverständlich das deutsche Staatssäckel von der verfahrenen Währungslage? Registriert nicht jeder im jüngsten Wahlergebnis der Griechen den unbändigen Wunsch, die europäische Kuh zu melken, so lange es geht, wenn es sein muss, auch mit dem absurden Mittel der Staatsinsolvenz? Ist die Allianz mit dem östlichen Nachbarn nicht Frankreichs Hebel, um seine angestammte Rolle in der Welt ein wenig weiter zu spielen? Stellt Großbritannien seine privilegierte Lage am Rande des Kontinents zugunsten eines gemeinsamen Traums von Arbeit und Urlaub hintan? Anders herum: Ist die Türkei ein europäisches Land oder nicht? Teils-teils, sagt Europa. Das sagt es seit den Zeiten des Prinzen Eugen und denkt nicht im Traum daran, irgendwann damit aufzuhören. In diesem Europa weiß jeder, der lesen kann, dass die Ideologien, die es zerstört haben, grenzüberschreitenden Charakter trugen. Die großen Vernichtungen wurden von Menschen geplant und durchgeführt, für die der Nationalstaat in seinen ›engen Grenzen‹ – holla? – eine überholte Größe darstellte. Es sind Europas Staaten, die nach der Kapitulation und Abwicklung der ›überdehnten‹ Imperien wieder hergestellt wurden.
10.
Der gemeinsame Markt war die Antwort (West-)Europas auf die Praxis der Staatszerstörung nach innen und außen, der die Praxis der Menschenvernichtung im großen Stil auf dem Fuße folgte. Er gab eine erste Antwort auf die Frage, worin sich die Länder Europas nach allem, was geschehen war, zur Abwechslung einmal einig sein könnten. Der jüngst noch von Panzern durchfurchte europäische Raum sollte nicht unbesetzt bleiben. Auf die gewaltsamen Raumordnungs-Phantasien sollte eine zivile Praxis folgen, die es den Staaten und ihren Bewohnern erlaubte, ihre – vorrangig ökonomischen – Interessen auszuleben. Der einheitliche Rechtsraum ist die große Geste, mit der das (cum grano salis) nachimperiale Europa den Unrechtsraum der Okkupatoren durchstrich, und seine Botschaft an die Welt. Die Hoffnung der ›guten Europäer‹, dass sich daraus dereinst ein europäischer Staat erhebe, unterschied sich nicht wesentlich von der christlichen Hoffnung, dereinst in den Himmel zu kommen. Man soll darüber nicht lästern, viele, auch ich, haben ihr zeitweise angehangen und schämen sich ihrer nicht. Waren wir gute Europäer? Ganz unberechtigt klingt die Klage mancher Ost(Mittel-)europäer nicht, die EU, die sie bekommen hätten, sei nicht die, in die sie nach dem Bankrott des Ostblocks Aufnahme begehrten. So pflegt es zu gehen, so pflegt es zu sein. Wenn sich in Euroland ein politischer Wille regt, das Einheitswerk zu vollenden, dann richtet sich dieser Wille auf ein dazu reichlich untaugliches Gebilde. Europa heute wirkt wie erstarrt in der Schrecksekunde, bevor die tollkühnen unter seinen Akteuren darangehen, sich den möglicherweise atavistischen Wunsch, noch einmal einen Staat zu gründen, mitten in Europa, hier und jetzt zu genehmigen. Koste es, was es wolle – so heißt das doch? Oder? Wie hoch belaufen sich die wirklichen Kosten einer solchen Retortenstaats-Gründung, wenn einmal die Rechnungen am Finanzmarkt beglichen sind? Denn, unter uns, teuer wird es erst dann. Ein kalter Staat mit als beliebig empfundenen Außengrenzen, mit einem zusammengeschaufelten Wahlvolk als Souverän kann existieren, aber das ist auch schon das Beste, was sich über ihn sagen lässt.
11.
Man wird, kein Zweifel, die gegenwärtige Finanzkrise lösen. Man wird sie schon deswegen lösen, weil die nächste Finanzkrise bereits in der Tür steht und hinter ihr die übernächste sich andeutet. Europa ist nicht der einzige Krisenkandidat dieser Welt und sein Fall nicht der brisanteste. Wie tief er sein wird, hängt nicht allein von den Europäern ab. In gewisser Weise speist sich auch diese Krise aus der verlorengegangenen Deutungshoheit des Westens über die Probleme auf dem Planeten. Die tiefen Bücklinge der europäischen Abgesandten an den asiatischen Höfen haben sich tief in aller Gedächtnis eingegraben. Die westlichen Staaten können ihre Schulden nicht mit einem Federstrich annullieren, wie das manchem Occupy-Enthusiasten vorschwebt. Diese Schulden sind real und sie bleiben es auch dann, wenn man die Mechanismen, die sie erzeugt haben, für dubios und irrational hält. Es ist Attitüde, mit Sätzen wie »Das Volk zerreißt die Verträge, die es fesseln« die Finanzgewaltigen zu brüskieren. Sie haben dafür nur ein müdes Lächeln übrig. Doch sollte man nicht übersehen, aus welchem Fundus derlei Attitüden stammen. Der Voluntarismus des ›Volks‹ und seiner Lautsprecher hat das alte Europa zerstört, er wird kein neues erstehen lassen, nicht von der Mitte und nicht von den Rändern her. Das ist die andere Seite der Medaille.
12.
Deutschland, dieses kraftstrotzende Loch in der Mitte des Kontinents, hat die Leitlinien seiner Politik lange im Blick auf die transatlantisch gedeutete Karte Europas formuliert. Heute, konfrontiert mit dem Aufstieg der BRIC-Staaten und angesichts einer sich ins Desaströse verformenden Ölpolitik der westlichen Partner, sähen seine Regenten wie seine Parteien die europäische Frage aus global-ökonomischen Gründen gern als gelöst an und suchen nach Hebeln, um sie der Lösung näher zu bringen. Einer dieser Hebel ist die Finanzkrise und niemand kann ausschließen, dass sie nicht am Köcheln gehalten wird, solange sie nicht in diesem Sinn ihre Schuldigkeit getan hat. Wenn Griechenland sich heute aus einer Währung, die ihm nicht gut tut, verabschiedet, dann ist das ›der falsche Weg‹ und ›wir‹ können den Gedankengängen, die es dazu bringen, nicht so recht folgen – merkwürdigerweise, da sie nicht so schwer zu verstehen sind. Zum Glück scheint eine Mehrzahl der Griechen in schöner Eintracht mit ihrem Geldadel das genauso zu sehen, wenngleich aus Gründen, die den hiesigen strikt entgegenstehen. Im Politjargon nennt man das eine win-win-Situation. Es ist anzunehmen, dass sie so lange bestehen bleibt, bis alle Seiten genügend Nektar aus ihr gesogen haben. Deutschland wird seinem erklärten Ziel irgendeiner politischen Union in Europa wieder ein Stück näher gekommen und die Unruhe darüber in den anderen Ländern, vielleicht mit Ausnahme Frankreichs, wieder ein klein wenig gewachsen sein.
13.
Frankreich und Deutschland gelten als die beiden ›führenden‹ Staaten Europas, deren Eliten sich mehr oder weniger offen, mehr oder weniger assistiert von den anderen, auf der Suche nach einer größeren Machtbasis für ihr Handeln befinden. Sie wollen mithalten, das ist verständlich, es ist, in der multipolaren Welt, vielleicht überlebensnotwendig – fragt sich natürlich, wie immer, für wen. Aber ist es eine Lehre, die ›wir‹ aus der Geschichte ziehen müssen? Natürlich nicht. Kein seriöser Politiker wäre so unklug, Machtzuwachs als politisches Ziel zu deklarieren. Man behält ihn im Auge – was denn sonst. Man schickt keine Kommissare nach Griechenland, um dort ›nach dem Rechten‹ zu sehen, weil einem das herzliche Einvernehmen der Völker am Herzen liegt. Man schickt sie, um etwas durchzusetzen, wofür man zu zahlen bereit ist. Auch die Macht ist schließlich nur ein Geschäft, wie das Klima, das Fernweh und der Hunger unter den Menschen. Das klassische Vehikel der Machtanhäufung ist der Hunger nach mehr, häufig Gier genannt, und es kennt, wie immer, zwei Seiten: die der Verführung und der Verführten. Der Zertifikate-Handel der Macht an den Terminbörsen des Weltgewissens zeitigt Folgen, die nicht weniger grässlich in das Leben der Menschen einschneiden als die der Währungsspekulation. Doch da er den Gewissensstandort niemals verlässt, segelt er im Windschatten evidenterer Übel. Die Frage heißt demnach nicht: Wozu braucht Deutschland die ›irre Idee‹ eine europäischen Staates? Sie lautet, weniger staatsegoman gestellt: Wozu braucht Europa die ›irre Idee‹ eines übereuropäisierten Deutschland, das sich nur im anderen seiner selbst wiederfindet? Im anderen seiner selbst – das ist die Formel. ›Wir‹ – los, spuckt es aus! – sind die besseren Griechen, Fanzosen, Briten, Italiener, Spanier, Portugiesen, Polen, Slowaken, Tschechen, Portugiesen, Jütländer, Südländer, Hunnen und Alawaren – war da noch jemand? Hallo, war da noch jemand? Alle von Bord? Na Gott sei Dank. Jetzt wird gefeiert.
14.
Euroland ist ein Bundesstaat, seine Flagge wedelt im Wind, seine Strände glänzen weiß wie Taubenkacke, seine Börsen brummen, seine Gesundheit strotzt, von Karies abgesehen, wie… wie… wie… Im Fernsehen plaudert ein Innenminister, den jeder kennt (denn er trägt immer einen blauen Anzug und man erzählt über ihn, was man eben so erzählt), mit einer Moderatorin, die ihre Augen aufreißt, als erscheine sie dadurch irgendwie preiswürdiger – über was? Darüber, wie man all diese im Grunde friedlichen Menschen, diese großartigen Menschen, die jetzt endlich im Land ihrer Sehnsucht angekommen sind und nur hier und da fremdeln, in Schach hält. »Wir haben nicht gewusst, wie es sich anfühlt, dieses Land. Für uns Ältere wird es immer den Geschmack des Ungewöhnlichen besitzen. Aber sehen sie auf diese jungen Menschen. Sie werden diesen ihren Staat wie selbstverständlich in Besitz nehmen. Eigentlich haben sie ihn schon in Besitz genommen. Dieser Staat in der Mitte Europas mit seinen offenen Grenzen ist auf gute Nachbarschaft angewiesen. Ich weiß nicht, was ich Ihren Zuschauern über unsere Vergangenheit sagen soll. Jedenfalls stellte sie eine Gefahr für den Weltfrieden dar und wir sind froh, ihr entronnen zu sein. Ich drücke mich doch verständlich aus, oder? Fragen Sie, was Sie wissen wollen. Ich bin froh über jede Frage. Wie soll ich Ihnen erklären...? Wir werden niemals zulassen, dass das reiche und großartige Erbe Europas... Ja, wir sind weiter, da sind wir in der Tat ein ganzes Stück weiter. Nicht weit genug, aber wir sind weiter. Wir haben den Religionsfrieden in diesem Land erreicht, das ist mehr als jede frühere Bundesregierung... ein hartes Stück Arbeit, ich verspreche Ihnen jetzt... in zehn, zwanzig Jahren wird niemand mehr... Sie hören mir ja gar nicht zu? Ich sagte, in zehn, zwanzig Jahren... – was ist los? Bitte, was ist los? Ist sie eingeschlafen? Nehmen Sie mir das Ding da ab, ich weiß sonst nicht, ob ich mich –«
15.
So plaudert der Gute. Hat er nicht recht? Über einen Staatsdichter verfügen sie auch auch schon, er spuckt klapprige Anapäste wie andere Herzblut und seine über Gebühr ausgedehnte Lebensaufgabe besteht im Bezichtigen, eine holde Schar künstlerischer Talente entquillt Jahr für Jahr den staatlichen Fördereinrichtungen, um der new identity of central europeans, NICE genannt, sowie sich selbst zum Durchbruch zu verhelfen, die e-Journalisten, Flächendecker von Haus aus, erkunden nach dem Flop von copy&paste im Sprachenmix fieberhaft neue tools, am Straßenbild hat sich wenig geändert, außer dass man sich neuerdings alles ein wenig breiter und höher zu denken hat, die Wissenschaft empfindet den Reiz der Segregation wieder stärker, nachdem alle Töpfe eurisiert wurden, aus denen sie ihre Stärkung holt, das europäische Parlament, nach jahrzehntelangem Dämmer rüde ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt, hat sich eine Sitzordnung gegeben, in der die Vertreter von Euroland, über deren ulkigste Bezeichnung noch Debatten geführt werden, auf doppelt so hohen Polstern über den anderen thronen (eine ›erhabene Position einnehmen‹, wie der britische Abgeordnete F. bissig anmerkt) und doppelte Gehälter einstreichen, ihrer Doppelfunktion wegen, die Wirtschaft fürchtet Behinderungen durch staatlichen Interventionismus, sie subventioniert die Talentsuche der Vereinigten unkonventionellen europäischen Linken, damit sie sich durch neue Sponti-Sprüche aus dem letzten Jahrhundert die nächste Wahlschlappe sichert, die staatlich unterwanderte Rechte, in die Jahre gekommen, krächzt, weil sie die neue Identität endlich auch sprachlich zu realisieren gedenkt, das nachhaltsame Schuldenvolumen der öffentlichen Hände hat sich, der Anzahl entsprechend, ebenfalls verdoppelt und rund um die Stadien prügeln die Fans wie zuvor aufeinander ein: sie finden es geil, die Naturgeschichte Europas, diese trübe Abfolge von Raufhändeln, Woche für Woche im Zeitraffer darzustellen, um zu zeigen, was sie gelernt haben, und genießen den Durchbruch an der ideologischen Front. Auch sie sind angekommen. Aber das waren sie längst.
16.
Warum das alles? Weil es sich bisher so ergeben hat und weiter so ergeben wird, vor allem, wenn man nicht aufpasst? Weil alle schon so lange Zeit unterwegs sind? Ist Politik eine Gebirgspartie mit Verweilminute am Gipfelkreuz und Fotos fürs Familienalbum, bevor man wieder hinunter muss, in die Ebene aus Kommerz & Verkehr? Andererseits: wenn man schon unterwegs ist – was spricht eigentlich dagegen? Das Volk, ja gut, die Bevölkerung, dagegen gibt’s Parteibeschlüsse und die Hintergedanken alter Männer, das lässt sich abregeln. Aber das ist nicht wahr, es ist nur Satire, Realsatire wie das ganze Wir, das die Weltkugel auf dem ausgestreckten Zeigefinger rotieren lässt wie weiland eine Chaplin-Figur, wir wollen da nicht missverstanden werden. Niemand will die Europäer in einen Käfig sperren. Sie sollen frei sein, wie die Evolution sie schuf. Die Evolution? So lange schon unterwegs nach Europa? Nie ganz angekommen, immer nur fast –? Schreiben wir darüber: ›Ein deutschsprachiges Bühnenwerk für die Unter- und Mittelstufe‹, und legen wir es zu den Akten.