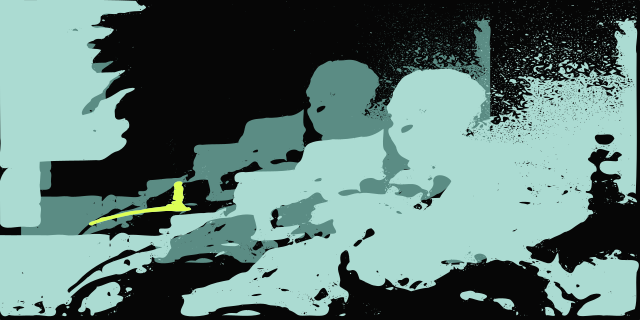von Peter Brandt / Dimitris Th. Tsatsos
Der Gedanke eines engeren Zusammenschlusses Europas, damals als eine Art Fürstenbund und in scharfer Abgrenzung gegen das islamische Osmanische Reich, weniger deutlich auch gegen Russland und die orthodoxe Ostkirche, fand bereits seit dem 15. Jahrhundert seinen Niederschlag in Konföderationsplänen, die teilweise von Herrscherpersönlichkeiten wie Heinrich IV. von Frankreich stammten. Daneben formulierten, meist weniger konkret, herausragende Denker wie Johann Amos Comenius, Jean Jacques Rousseau und Immanuel Kant die Idee der Einigung Europas. Henri de Saint-Simon, zugleich einer der frühen utopischen Sozialisten, fasste ganz Europa bereits als konstitutionelle Monarchie mit einem Zwei-Kammer-Parlament ins Auge. Konservative wie François René de Chateaubriand entwickelten ebenso eigene Vorstellungen wie Vertreter der liberal-demokratischen Nationalbewegungen, so Giuseppe Mazzini – in der Tat ist die Differenzierung des großen Kultur- und Sozialraums westlich des Urals in die modernen Nationen ein typisch europäisches Phänomen –, der bürgerlichen Friedensbewegung und natürlich des Sozialismus in allen seinen Strömungen. Die SPD formulierte etwa in ihrem Heidelberger Programm von 1925 die Parole der »Vereinigten Staaten von Europa«.
Zu diesem Zeitpunkt begann die Idee der europäischen Einigung unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs eine realpolitisch größere Rolle zu spielen. 1930 legte Aristide Briand, derzeit linksliberaler Außenminister Frankreichs, erstmals den anderen Regierungen offiziell den Plan eines europäischen Staatenbundes vor, der von der Paneuropa-Bewegung des Grafen Richard Coudenhove-Calergi inspiriert war. Angesichts der beginnenden Weltwirtschaftskrise und der eher protektionistischen Rettungsversuche der Nationalstaaten einerseits, der ungebrochenen Traditionen nationaler Machtpolitik und entsprechender Perzeptionsmuster bei allen Betroffenen andererseits, kam Briands Europa-Plan über ein Anfangsstadium der Erörterung nicht hinaus.
Einen Einschnitt bildete dann die Periode des Zweiten Weltkriegs mit der Besetzung des größeren Teils des europäischen Kontinents durch Hitler-Deutschland, das ein faschistisches Europa unter seiner Führung zu einigen versprach. In allen Ländern formulierten die Köpfe des Widerstands, vom national-konservativen bis zum sozialdemokratisch-sozialistischen Flügel, doch mit Ausnahme der Kommunisten, die programmatische Forderung der Einigung Europas, die unter Sicherheits- wie unter Wirtschaftsgesichtspunkten notwendig schien. Nur durch die Überwindung der tradierten Machtpolitik und der uneingeschränkten nationalen Souveränitäten zugunsten einer überstaatlichen Bundesautorität könnten Europa und die im großen europäischen Verbund aufgehobenen Nationen sich gegenüber den neuen Weltmächten behaupten.
Das insbesondere bei Sozialdemokraten mehr oder weniger klar mit der Einigungsperspektive verbundene Ziel, Europa als eine, auch gesellschaftspolitisch, ›Dritte Kraft‹ zwischen den USA und der Sowjetunion in Stellung zu bringen, blieb ohne Realisierungschance, als sich die von großen Hoffnungen begleitete britische Labour-Regierung der ihr zugedachten eigenständigen Führungsrolle verweigerte. Angesicht der brutalen Stalinschen Ausbeutungs- und Angleichungspolitik im sowjetischen Machtbereich einerseits und der Entschlossenheit der USA, ihre wirtschaftlichen und strategischen Interessen auf dieser Seite des Atlantik zu wahren andererseits, musste eine spezifisch demokratisch-sozialistische und zugleich auf Unabhängigkeit bedachte Politik für Europa ohnehin mit größten Hindernissen rechnen. Auch die im Juni 1947 gegründete »Sozialistische Bewegung für die Vereinigten Staaten von Europa« vermochte diesen Rahmen nicht auszuweiten.
Schon seit Ende der 1940er Jahre gerieten die Bestrebungen zur Vereinigung Europas, nun eindeutig beschränkt auf das westliche Europa, weitgehend zu einer Funktion des Ost-West-Konflikts und der amerikanischen Hegemonialpolitik, was sich jedoch seit den 1960er Jahren teilweise zu ändern begann. Zunächst sahen die USA in einem engeren Zusammenschluss Westeuropas, sei es mit oder ohne Großbritannien, deutlich mehr Vorteile als Risiken und unterstützten eindeutig und nachdrücklich die frühen Projekte: von der Montan-Union über die (gescheiterte) Europäische Verteidigungsgemeinschaft mit flankierender politischer Einigungsstruktur bis zu der 1957 vereinbarten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft der Sechs.
Deren schrittweise Ausweitung zu einer nun bald annähernd das gesamte nichtrussische Europa umfassenden Union und deren institutioneller Ausbau warfen von Anfang an und stets von neuem diejenigen grundlegenden Fragen auf, mit denen der Einigungsprozess heute noch zu tun hat und die zwangsläufig im Mittelpunkt einer ›Europäischen Verfassung‹ stehen. Faktisch enthielt der Einigungsprozess stets sowohl intergouvernementale als auch supranationale Elemente, wobei Erstere meist überwogen. Aber selbst de Gaulle, der sich bemühte, die Europäischen Gemeinschaften ganz unter die Kontrolle eines von Frankreich geführten Staatenbundes zu bringen, konnte und wollte wohl auch nicht das Supranationale vollkommen eliminieren.
Versuche hingegen, einer Verfassung für Europa wie sie erstmals 1952/53 in einem im Auftrag der Regierungen von einer Adhoc-Versammlung erarbeiteten kompletten Entwurf konzipiert wurde, einen überwiegend bundesstaatlichen Charakter zu geben, kamen wegen des Widerstands der Einzelstaaten bisher nicht zum Zuge und der Verfassungsvertrag vom 29.10.2004 zeichnet sich ja u.a. gerade dadurch aus, dass er die beiden Strukturprinzipien bzw. Ebenen des europäischen Staatenverbundes gleichberechtigt nebeneinander stellt und Aussagen über eine Finalität vermeidet, gleichzeitig aber den Weg für eine Weiterentwicklung der Union, insbesondere bezüglich der seit den 1980er Jahren bereits deutlich ausgeweiteten Kompetenzen des Parlaments, offen hält.
Historische Voraussetzungen des Verfassungsstaats in Europa
Die schrittweise Herausbildung einer ›Europäischen Verfassung‹ ist nicht vorstellbar ohne die spezifisch europäische Tradition des nationalen Verfassungsstaats, die ihrerseits an weit zurückreichende historische Voraussetzungen gebunden ist. Das Grundprinzip der historischen Entwicklung Europas seit dem Mittelalter ist der Pluralismus: sowohl zwischen den vielgestaltigen und relativ kleinräumigen, meist fürstlichen Machtgebilden als auch innerhalb der diversen Gemeinwesen, wo die Machtbildungsprozesse statt einer Autokratie funktional differenzierte Systeme begünstigten. Dieser charakteristische ›Pluralismus‹ äußerte sich meist gewaltsam, in teilweise äußerst blutigen Kriegen und Bürgerkriegen, die die europäische Geschichte durchzogen und nur ausnahmsweise von längeren Friedensperioden unterbrochen wurden. Mehr noch: Militär, Krieg und Machtexpansion bildeten eine der Haupttriebkräfte technologisch-wirtschaftlicher Entwicklung und einzelstaatlicher Formierung Europas bis weit ins 20. Jahrhundert.
Die soziale Herrschaft des Adels auf der Grundlage der rund ein Jahrtausend dominierenden agrarisch-feudalen Produktionsweise und ergänzt um unterschiedlich stark entwickelte genossenschaftliche Elemente in den bäuerlichen Gemeinden schränkte die Monarchien als die Hauptträger der vormodernen europäischen Staatsbildungen ebenso ein, wie das zwecks Konzentration von Handel und Gewerbe in Europa relativ stark verselbständigte Städtewesen. In der Stadt des Mittelalters und der Frühen Neuzeit ergab sich aus der beruflichen und sozialen Differenzierung ein gegenüber der ländlichen Gesellschaft erhöhter Regelungsbedarf, insbesondere hinsichtlich des Rechtssystems, der Verwaltung und des Finanzwesens, der mit der Notwendigkeit einherging, eine beträchtliche Zahl von Menschen an politischen Entscheidungen zu beteiligen.
Die gewohnheitsrechtlich gesicherten Autonomieansprüche des Adels und des Städtebürgertums, kombiniert mit der frühen Fixierung des Eigentumsrechts, bildeten unüberwindbare Hindernisse gegen eine willkürliche und gewaltsame Abschöpfung des Mehrprodukts durch die Monarchen und machten die Partizipation der ›Stände‹ notwendig. Die fast überall vom Adel dominierten politischen Ständeversammlungen begründeten – trotz ihrer sozialen Begrenztheit – eine Tradition der Repräsentation des Landes gegenüber der Herrschaft, die für die spätere Konstitutionalisierung von Bedeutung war. Auch in der Epoche der ›absoluten‹, also nur durch das göttliche und natürliche Recht gebundenen Monarchie und selbst in den am meisten ›absolutistischen‹ Staaten blieben die ständischen Zwischengewalten viel gewichtiger, als man lange angenommen hat. Der Autonomie- und Mitwirkungsanspruch der Stände beinhaltete in deren Selbstverständnis das Recht auf – u. U. sogar gewaltsamen – Widerstand gegen eine rechtsverletzende Obrigkeit. Die modernen Menschenrechtsdeklarationen gründen letztlich auf dem europaweiten Widerstandsdiskurs der Frühen Neuzeit.
Zu den grundlegenden historischen Voraussetzungen des Verfassungsstaats in Europa gehört als Trägerin des wichtigsten einheitsstiftenden Prinzips der alteuropäischen politischen Kultur die christliche, speziell römische Kirche, die das antike Kulturerbe in sich aufgenommen hatte, einschließlich des Römischen Rechts, das nicht zuletzt dazu diente, die seit dem Spätmittelalter entstehende, möglichst unumschränkte monarchische Zentralgewalt zu legitimieren. Aus der auf Rechtsungleichheit beruhenden feudalständischen Gesellschaft mit ihren uneinheitlich zusammengesetzten Territorien und Reichen führte kein direkter Weg in den modernen Verfassungsstaat, der einer zwar faktisch in sozioökonomische Klassen geteilten, aber durch rechtliche Freiheit und Gleichheit definierten Staatsbürgergesellschaft bedurfte. Erst mit der Entstehung des souveränen Staates in Gestalt der absoluten Monarchie während des 17. und 18. Jahrhunderts wurden die ständischen Zwischengewalten so weit zurückgedrängt, dass ein jedenfalls im politischen Sinn nivellierter Untertanenverband entstand, während auf der obrigkeitlichen Seite die exekutiven Funktionen des Herrschers zunehmend ausdifferenziert wurden und in die Hände der Bürokratie übergingen. Das somit gleichermaßen direkter wie abstrakter werdende Verhältnis zwischen der Untertanengesellschaft und der monarchischen Staatsmacht verlangte vor dem Hintergrund einer seit dem mittleren 18. Jahrhundert deutlich beschleunigten wirtschaftlich-sozialen Dynamik nach einem neuen administrativen und juristischen Regelwerk.
In Ergänzung zur ursprünglich vorwiegend medizinischen und geographischen Wortbedeutung von ›Verfassung‹ war es üblich, grundlegende Verträge und Gesetze als ›Verfassungsgesetze‹ zu betrachten, so etwa die britische Magna Charta von 1215 oder die römisch-deutsche Goldene Bulle von 1356. Doch keines dieser ›Verfassungsgesetze‹ der Vormoderne sollte einen umfassenden politischen Ordnungsrahmen liefern; es ging stets um anstehende Einzelfragen, mochte deren Regelung auch weiterreichende Bindewirkungen entfalten. Erst der moderne Verfassungsbegriff, wie er exemplarisch in den constitutions der USA (1787) – mit starker Ausstrahlung auf Europa – und Frankreichs (zuerst 1791, in demselben Jahr auch diejenige Polens, in ihrer Realisierung vereitelt durch die zweite und dritte Teilung) zum Ausdruck kam, machte den in ihrer Form teils revolutionären, teils reformerischen Bruch der politischen Systeme in Europa um 1800 denkbar. Die Anfänge dieses modernen Verfassungsbegriffs reichen in Großbritannien ins frühe 17. Jahrhundert zurück und nahmen im Verlauf des 18. Jahrhunderts in den Debatten der aufgeklärten Geisteselite auch auf dem Kontinent, mehr und mehr normativ aufgeladen und politisiert, Konturen an: Freiheit der Person, Gleichheit vor dem Gesetz, Gewaltenteilung, Pressefreiheit, politische Repräsentation. Speziell zwischen dem späten 18. und dem mittleren 20. Jahrhundert lassen sich große europaweite Verbindungslinien ausmachen, bestimmte Konstitutionalisierungsschübe oder Verfassungswellen und Verfassungsregionen, die das vorherrschende Bild dieses Zeitraums als einer Großepoche nationaler Fragmentierung erheblich relativieren.
Das erste republikanisch-demokratische Verfassungsdokument war bereits in den 1750er Jahren unter den besonderen Bedingungen der Sezession Korsikas von Genua entstanden; das Projekt scheiterte endgültig 1769 mit der Annexion der Insel durch Frankreich. Auch der weit entwickelte Plan von Großherzog Peter Leopold, des späteren Kaisers, zur Konstitutionalisierung der Toskana aus den 1780er Jahren kam nicht zur Ausführung, hauptsächlich wegen der Auflehnung des konservativen Klerus. Er verdient trotzdem Interesse, weil er die Ansätze des aufgeklärten Reformabsolutismus bis zur letzten Konsequenz weitertrieb und zugleich deren gesellschaftliche Hindernisse verdeutlichte. Die genannten Beispiele belegen, dass die Idee des Verfassungsstaats spätestens im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts in der Luft lag. Sie weisen auch darauf hin, dass der lange Weg vom frühen, in der Regel monarchischen Konstitutionalismus bis zur voll ausgebildeten Demokratie keinesfalls glatt und widerspruchsfrei verlief, vielmehr von massiver, auch gewaltsamer Gegenwehr und reaktionären Rückbildungen, in der Zwischenkriegszeit sogar von der zeitweiligen kompletten Änderung der Entwicklungsrichtung gekennzeichnet war.
Der Verfassungsstaat des 19. Jahrhunderts
So gewichtig die teils indirekt katalysatorische, teils direkt – über das napoleonische Hegemonialsystem – eingreifende Rolle des revolutionären Frankreich für den Umbruch Europas um 1800 war, diese Rolle konnte nur zum Tragen kommen, weil seit langem – hier mehr, dort weniger – sowohl gesellschaftlich als auch bewusstseinsmäßig Veränderungen im Gange waren, die es überhaupt möglich machten, dass die Impulse der ›Revolution von außen‹ auf fruchtbaren Boden fielen. Seit dem Beginn des spanischen Unabhängigkeitskriegs (1808) kehrte sich die Idee der Selbstbestimmung der ›Nation‹, nicht zuletzt durch Verfassungsgebung, in einer dialektischen Umkehrung gegen den Empereur. In wie starkem Maß es sich um 1800 um einen gemeineuropäischen grundlegenden politischen Ordnungswandel und Paradigmenwechsel handelte, zeigte sich, als die sogenannte Restauration nach der Besiegung Napoleons nicht nur die wesentlichen Staats- und Gesellschaftsreformen der vorangegangenen Periode, jedenfalls in West-, Mittel- und Nordeuropa, unangetastet ließ, sondern im Anschluss an die Charte constitutionelle (1814) auch eine weitere Welle der Verfassungsgebung zuließ, namentlich in den süddeutschen Staaten, ermöglicht durch den Artikel 13 der Deutschen Bundesakte von 1815. Es war die neue bürgerliche Elite, die ›Gebildeten‹ in Deutschland, die ›notables‹ in Frankreich und die ›middle classes‹ in England (allenfalls diese ansatzweise schon so etwas wie Bourgeoisie), die den Verfassungsstaat als Medium der eigenen Emanzipation und zugleich als Instrument zur Integration der nachrevolutionären Gesellschaft (durchaus im Bündnis mit der Monarchie) verstand. Neben diesem gemäßigten liberalen Konstitutionalismus und teilweise gegen ihn traten, meist in Verbindung mit sozialem Potest, radikalere, eher plebejische Strömungen in Erscheinung, die, wie schon in der Französischen Revolution nach 1789, die uneingeschränkte Souveränität ›des Volkes‹ forderten.
In einem jahrzehntelangen Ringen in den parlamentarischen Körperschaften, in der Publizistik, nicht zuletzt auf der Straße und immer wieder auch im bewaffneten Kampf setzte die liberale »Bewegungspartei« die Konstitutionalisierung der Einzelstaaten Europas flächendeckend durch, wobei die revolutionären Ereignisse der frühen 1830er Jahre und der späten 1840er Kulminationspunkte bildeten. Die Konstituierung neuer Nationalstaaten in Italien (1859/61) und Deutschland (1866/71) als Resultante der bürgerlichen National- und Verfassungsbewegungen einerseits und der diesen Vorgang militärisch dominierenden Einzelstaaten Piemont und Preußen andererseits schloss den Prozess im wesentlichen ab – mit der wichtigen Ausnahme der erst 1906 (im Anschluss an die Revolution des Vorjahrs) von oben oktroyierten Verfassung des zaristischen Russland, die der monarchischen Exekutive eine besonders starke Stellung beließ, aber doch mehr war als ein reiner Scheinkonstitutionalismus. Dass die in der Auflösungsphase des Osmanischen Reiches im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, am Ende des Ersten Weltkriegs dann durch die Zerschlagung Österreich-Ungarns und die Ostverschiebung Russlands in Ostmittel- und Südosteuropa neu entstehenden Nationalstaaten zumindest pro forma als Verfassungsstaaten ins Leben traten, galt bereits als selbstverständlich.
Bekanntlich ging England der Konstitutionalisierung Kontinentaleuropas um mindestens ein Jahrhundert voraus. 1688/89 (»Glorious Revolution«) etablierte sich nach der jahrzehntelangen, auch als Bürgerkrieg geführten Auseinandersetzung zwischen dem Unterhaus des Parlaments und dem König eine de facto konstitutionelle Monarchie heraus, wobei sich die Finanzhoheit des Parlaments wie anderswo auch längerfristig als Hebel sukzessiven weiteren Verfassungswandels erweisen sollte. Obwohl keine umfassende grundgesetzliche politische Rahmensatzung verabschiedet wurde und bis heute nicht existiert, kristallisierte sich ein Begriff von ›Verfassung‹ heraus, der – bis ins Mittelalter zurückreichend – die Dokumente, in denen die wohl erworbenen persönlichen Rechts des Engländers bzw. des Briten, so die Bill of Rights von 1689, fixiert waren, ebenso umfasste wie das Common Law und die ungeschriebenen Regeln der Verfassungspraxis. Das Ergebnis ist ein gewohnheitsrechtlich-evolutionäres Verständnis von Verfassung, das erst in letzter Zeit Elemente der stärker normativen, systematischen und juridischen Konzepte der Länder Kontinentaleuropas (wie auch der USA) aufnimmt.
Die konstitutionelle Monarchie Großbritanniens mit der Tendenz zur Parlamentarisierung war eine aristokratische Herrschaftsform und das in gewisser Weise bis zur weitgehenden Entmachtung des Oberhauses 1911. Doch der englische Adel war durch die strikte Primogenitur zum Handels- und Gewerbebürgertum seit jeher sozial offen und ging mit diesem vielfach schon frühzeitig ökonomisch und politisch enge Bindungen ein. Die politische Zähmung des Hochadels durch die Monarchie und die ökonomische Entfeudalisierung des adeligen Großgrundbesitzes in der Frühen Neuzeit liefern den wichtigsten Schlüssel zum Verständnis der Pionierrolle Englands sowohl bei der Konstitutionalisierung wie bei der kapitalistischen Industrialisierung Europas.
Der gesamteuropäische Prozess der Konstitutionalisierung vollzog sich bis zum Ersten Weltkrieg noch weitgehend im Rahmen des – in sich durchaus differenzierten – Verfassungstyps der nach deutschem Sprachgebrauch im engeren Sinn konstitutionellen, d. h. gesetzlich eingeschränkten Monarchie, in der die Exekutive noch beim Herrscher bzw. bei der von ihm eingesetzten Regierung lag. Auch innerhalb des preußisch-deutschen, weitgehend auch des österreichisch-ungarischen Konstitutionalismus mit dem zunächst charakteristischen Schwergewicht auf der exekutiven Gewalt lässt sich für die Jahrzehnte um 1900 ein schleichender Verfassungswandel ausmachen, der der Reichsregierung gegenüber der Krone eine eigenständigere Stellung verschaffte und zugleich die Position des in Deutschland schon seit 1867/71, in Österreich seit 1907 aus allgemeinen, gleichen Wahlen der männlichen Bevölkerung hervorgegangenen Nationalparlaments gegenüber den exekutiven wie den föderativen Staatsorganen stärkte. Den Durchbruch zur Parlamentarisierung brachte allerdings faktisch erst die Niederlage im Ersten Weltkrieg; sie konnte die revolutionär-demokratische Volkserhebung nicht mehr verhindern.
Im 19. Jahrhundert dominierte in Europa also noch der monarchische Verfassungsstaat unterhalb des Parlamentarismus. Als 1906 auch im russischen Zarenreich die tradierte Autokratie durch eine äußerst bescheidene Version der konstitutionellen Monarchie abgelöst wurde, war Frankreich bereits seit rund drei Jahrzehnten eine parlamentarische Republik mit einem allgemeinen, gleichen Männerwahlrecht. In Nordeuropa stand sogar schon die Einführung des Frauenwahlrechts kurz bevor. Aber selbst Frankreich mit seiner revolutionären Tradition blieb von 1804 bis 1870 mit einer kurzen Unterbrechung Monarchie. Die Schweiz, das einzige durchgehend republikanische Land Europas, wurde erst im Sonderbundkrieg von 1847/48 ein moderner Bundesstaat, und nicht vor 1874 setzte sich eine Kombination von parlamentarischer und Referendumsdemokratie durch. Ansonsten kann von der Etablierung der parlamentarischen Regierungsform (de facto, nicht unbedingt de jure) zu diesem Zeitpunkt für Italien (1861), die Niederlande (1868), Norwegen (1884) und Dänemark (1905), unter Vorbehalt auch für Griechenland (1875) und Serbien (1903) gesprochen werden; lediglich Großbritannien und Belgien waren in den 1830er und frühen 1840er Jahren, also erheblich früher, vorangegangen, wenn man von dem Sonderfall einer zeitweiligen quasi-parlamentarischen Regierung durch die französischen Ultra-Konservativen unter der 1814 restaurierten Bourbonen-Monarchie absieht.
Der europäische Verfassungsstaat im 19. Jahrhundert und darüber hinaus organisierte bekanntlich eine auf krasser Ungleichheit beruhende kapitalistische Klassengesellschaft, die überdies vielfach von vorbürgerlichen und klientelistischen Elementen durchmischt war. Die Volksvertretungen selbst bereits parlamentarisierter Staaten wie Großbritannien wurden aufgrund von (anfangs extrem) eingeschränkten und ungleichen Wahlrechten gewählt. Darüber hinaus ist der grundlegend manipulative Charakter der europäischen Verfassungsentwicklung zu unterstreichen. Das gilt nicht nur für die südliche und südöstliche Peripherie des Kontinents, sondern auch für den plebiszitär-populistischen Bonapartismus der beiden Napoleon, ferner für den spezifischen Lobbyismus der Verbandsinteressen im Deutschen Kaiserreich. Dem spanischen »Turno pacífico«, bei dem der Regierungswechsel als Absprache zwischen Konservativen und Liberalen erfolgte und erst im Nachhinein durch systematische Wahlbeeinflussung und -fälschung scheindemokratisch legitimiert wurde, entsprach der italienischen »Trasformismo«, ein regelrechtes System oligarchischer Herrschaftssicherung der liberalen Regierungselite, bei dem lokale Clanchefs und Leiter von Provinzverwaltungen für die gewünschten Ergebnisse sorgten. In Italien wie in Spanien, das mit der Verfassung von Cadiz (1812) eine der frühen, relativ progressiven Leitverfassungen hervorgebracht hatte, führten solche Praktiken zur nachhaltigen Diskreditierung des Parlamentarismus; ähnliches gilt für die der dortigen Verfassungswirklichkeit immanente Korruption und den Klientelismus der Balkanstaaten.
Vom liberalen Konstitutionalismus zur sozialen Demokratie
Die in den Jahrzehnten um 1900 in vielen Staaten Europas verstärkt auftretende Demokratisierungsbewegung hatte, neben der Stärkung der Parlamente, vor allem die Verbesserung des Wahlrechts zum Inhalt. Über dessen zum Teil mehrfache Ausweitung – in Großbritannien 1832, 1868, 1884, 1918, 1928 – wurde das allgemeine und gleiche Stimmrecht zuerst für Männer und später auch für Frauen durchgesetzt. Die demokratische Wahlrechtsforderung, für die erbittert gekämpft wurde, auch mit Massendemonstrationen und -streiks, war ein zentrales Anliegen der jungen sozialistischen Arbeiterbewegung, die die parlamentarische Demokratie, möglichst als Republik, als günstigste Staats- und Regierungsform im Rahmen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, zugleich aber auch als deren Ablösungsform ansah. Neben der Arbeiterbewegung und teilweise im Bündnis mit ihr waren es entschieden liberale Strömungen bürgerlicher bzw. kleinbürgerlicher, auch bäuerlicher Provenienz, die die Demokratisierung gegen die tradierten aristokratisch-großbürgerlichen Führungsschichten durchzusetzen halfen.
Diese Phase der Demokratisierung des Wahlrechts und der, sofern noch ausstehenden, Parlamentarisierung der Regierungsform entsprach zugleich dem Zeitraum, da die gesetzliche Regelung der Sozialpolitik zum Gegenstand politischer Auseinandersetzung wurde, auch hier mit Initiativen bürgerlicher Politiker, die die Notwendigkeit erkannten, die Existenzrisiken namentlich der Arbeiterbevölkerung (Unfall, Krankheit, Alter, später auch Erwerbslosigkeit) abzusichern. Vorreiter und Vorbild war das in den 1880er Jahren unter der Kanzlerschaft des Konservativen Otto von Bismarck für das Deutsche Reich eingeleitete Sozialversicherungssystem. Auch wenn Bismarcks Engagement patriarchalische und antisozialistische Motive zugrunde lagen und die materiellen Leistungen anfangs sehr bescheiden blieben, bildete sich mit der sozialen Sicherung und der Verbesserung des Arbeitsrechts nach und nach ein konstitutives Element des europäischen Verfassungs- bzw. Demokratiemodells heraus. Dabei ist der Unterschied der Finanzierung – aus Steuern oder Beiträgen – zweitrangig.
Zur Expansion der sozialen Sicherungssysteme hinsichtlich ihrer Gegenstände, der Aufwendungen, der Leistungen und der Quantität der Versicherten, zum ›Sozialstaat‹ oder ›Wohlfahrtsstaat‹, kam es dann nach dem Zweiten Weltkrieg, ermöglicht durch die langanhaltende Rekonstruktions- und Prosperitätsphase, den Ost-West-Konflikt und die zeitweilig, in manchen Ländern auch längerfristig, dominierende Rolle der Sozialdemokratie und keynesianisch inspirierter Wirtschaftsrezepte. Man kann vereinfachend, aber ohne Übertreibung sagen, dass – von Großbritannien abgesehen – die Demokratie im westlichen Europa nicht vor den 1950er Jahren jene Stabilität erlangte, auf der der europäische Einigungsprozess aufbauen konnte. Neben der Diskreditierung des Faschismus und seiner Kollaborateure als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs muss die sozialstaatliche Ausweitung der politischen Ordnung dabei als höchst bedeutend eingeschätzt werden.
Schon nach dem Ersten Weltkrieg, in der Weimarer Republik, hatten Staats- und Verfassungsrechtler sowie politische Theoretiker aus den Reihen der deutschen Sozialdemokratie, namentlich Hermann Heller, die Auffassung vertreten, der ›materielle‹ oder ›soziale Rechtsstaat‹, wie er in den die Arbeits- und Sozialordnung betreffenden Artikeln der Weimarer Verfassung, ihrerseits Ausdruck eines Basiskompromisses zwischen republikloyalem Bürgertum und reformerischer Arbeiterbewegung, umrissen war, erweitere den tradierten liberalen Rechts- und Verfassungsstaat qualitativ um eine neue soziale Dimension. Diese suchten die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften durch ihre sozialpolitischen und ›wirtschaftsdemokratischen‹ Ansätze graduell zu konkretisieren und zu erweitern. Juristisch gesehen wäre es, so meinte man, sogar denkbar, ohne jede Änderung des Verfassungstextes und voll auf dem Boden der repräsentativen Demokratie, den Kapitalismus zu überwinden und den Sozialismus zu verwirklichen. Das zentrale Argument lautete: Ohne ein Mindestmaß an ›sozialer Homogenität‹ – und das beinhalte auch unter marktkapitalistischen Bedingungen die Fähigkeit zum Interessenausgleich auf der Basis konsensualer Gerechtigkeitsvorstellungen – könnten die breiten Massen nicht instand gesetzt werden, die Selbstbestimmung des Volkes im politischen Handeln faktisch zu vollziehen und könnte somit die staatsbürgerliche Integration nicht gelingen.
Diese weiterhin aktuellen verfassungspolitischen Überlegungen richteten sich nicht nur gegen die altliberale Vorstellung, es genüge formale Freiheit und Rechtsgleichheit. Sie enthielten zugleich eine deutliche Abgrenzung gegen den kommunistischen Etatismus mit politischer Diktatur, Aufhebung der Gewaltenteilung und voll verstaatlichter Kommandowirtschaft, wie er sich in Russland etabliert hatte und später auf weitere Teile Europas und Asiens übertragen werden sollte. Die Theorie und Praxis eines radikal-demokratischen Rätesystems als politische Form des Sozialismus, wie sie in verschiedenen Varianten aus dem revolutionären proletarischen Aufbruch der Jahre 1917-1920 hervorgingen, wurde in Russland von Anbeginn durch die Erziehungsdiktatur der bolschewistischen Parteielite überlagert, die sich dann auch sozial verselbständigte und in den Marasmus der Nomenklatura mündete, bevor dieser sein Ende in den osteuropäischen, durchaus als Verfassungsrevolutionen zu verstehenden Volkserhebungen von 1989/91 fand.
Der historische Hintergrund der europäischen Verfassung
Der zuvor dargestellte historische Prozess, d.h. der Weg den der Konstitutionalisierungsprozess in Europa beschreitet, prägt den Kurs in Richtung einer Europäischen Grundordnung mit Verfassungsqualität. Der historische Prozess einer europäischen Konstitutionalisierung im weiteren Sinne, nimmt nun durch die Gründung der europäischen Gemeinschaft 1952 konkrete Formen an und erreicht seinen ersten Höhepunkt mit der Unterzeichnung des Vertrages über eine Verfassung für Europa am 29. Oktober 2004. Das Scheitern des konkreten Verfassungsvertrages bedeutet kein Scheitern der Verfassungsentwicklung und deshalb vermag es nicht den Institutionalisierungsprozess aufzuhalten. Die Geschichte der Idee einer europäischen Verfassung, welche begrifflich an das Konzept einer Verfassung für den Nationalstaat anknüpft, wird zum Gedanken einer transnationalen, letztendlich supranationalen und zur selben Zeit auch multi-nationalen europäischen Staatenordnung entwickelt.
Der Begriff ›Verfassung‹ – ungeachtet der Genauigkeit mit der dieser Begriff im europäischen Verfassungsvertrag angewandt wird – bezieht sich in seiner geschichtspolitischen Symbolik auch auf den politischen Willen, eine einheitliche gesetzliche Ordnung zu gründen, einen gemeinsamen rechtlichen Kompetenzrahmen der Freiräume zu schaffen und den Bürger und die Mitgliedstaaten gegenüber der Unionsgewalt zu schützen.
Diese drei eben erwähnten Elemente stehen am Beginn ihrer Entwicklung und konstituieren historische und logische Bedingungen des Verlaufs des Einigungsprozesses von der anfänglichen Logik des reinen Völkerrechts bis hin zu einer institutionellen Kondensation und schließlich zu dem Ergebnis einer europäischen Unionsgrundordnung mit Verfassungsqualität. Die Geschichte des Konzepts einer wie immer zu definierenden Verfassung in Europa zeichnet letztlich eine konstitutionelle Romantik auf, welche in der Europäischen Union vorherrschte und den damit zusammenhängenden Willen und die Dynamik, die hinter jenem Prozess steht. Die völkerrechtliche Logik, die die Anfänge der Gemeinschaften bestimmte, erwies sich als immer weniger tauglich. Die Normgestalt und die politische Konzeption der Europäischen Unionsgrundordnung zeigte immer mehr Verfassungsqualität.
Die Entwicklung der Europäischen Integration zu einem politischen Prozess
Die zeitgenössische Geschichte der europäischen Integration hat einen symbolischen Anfangspunkt: den 9. Mai 1950, welcher heute als »Tag Europas« gefeiert wird. An diesem Tag beantragte der französische Außenminister Robert Schumann die Etablierung einer supranationalen Organisation für die gemeinsame Verwaltung zweier wichtiger wirtschaftspolitischer Bereiche, Kohle und Stahl. Sein Ziel war schließlich, durch solide kooperative Verbindungen zwischen den europäischen Staaten, vor allem zwischen Deutschland und Frankreich, den Frieden und das Wirtschaftswachstum im Nachkriegseuropa zu sichern. Im Jahre 1952 wurde die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) gegründet, an der sechs europäische Staaten beteiligt waren: Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg. Das Unterfangen der EGKS stellte sich als so erfolgreich heraus, dass die sechs Staaten – einige Jahre später – entschieden, ihre Zusammenarbeit auf weitere Bereiche auszudehnen. Im Jahre 1958 wurden durch die Verträge von Rom, welche 1957 unterzeichnet wurden, zwei zusätzliche Gemeinschaften gegründet: die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Gemeinschaft für Atomenergie.
Den europäischen Gemeinschaften lag von Anfang an ein neuartiges Prinzip transnationaler Zusammenarbeit zu Grunde, welches über das Konzept einer traditionellen völkerrechtlich konzipierten internationalen Organisation hinausging. Der Kern dieses Einigungsprozesses lag sowohl in der sogenannten ›Gemeinschaftsmethode‹, welche auf der Übertragung von Hoheitsrechten der Mitgliedsstaaten an die Gemeinschaften beruhte, als auch auf ihrer gemeinschaftlichen Ausübung auf europäischer Ebene. Schematisch bedeutet dies: der Rat in dem die Repräsentanten der Mitgliedsstaaten sitzen entscheidet, die Kommission stellt Anträge an den Rat und setzt seine Entscheidungen in die Tat um, während die Versammlung, welche zu dieser Zeit aus Repräsentanten der Nationalparlamente bestand, eine beratende Rolle innehatte.
Die europäischen Gemeinschaften entwickelten sich schnell zu einem Anziehungszentrum für alle anderen Staaten Westeuropas. 1972 traten Großbritannien, Dänemark und Irland bei, 1981 Griechenland, 1986 Spanien und Portugal. Die letzte Erweiterung wurde im Zuge der Einheitlichen Europäischen Akte im Jahre 1986 von der ersten Überarbeitung der Gründungsverträge begleitet. Dieser historische Moment markiert den offenkundigen Beginn der Politisierung der Union. Auf der Grundlage der Einheitlichen Europäischen Akte wurde die Entscheidung getroffen, einen einheitlichen Binnenmarkt zu schaffen. Gleichzeitig wurde der erste Schritt in Richtung einer – über den ökonomischen Bereich hinausgehenden – politischen Einigung Europas gemacht, und zwar durch die Schaffung eines Mechanismus von lockerer Kooperation der Mitgliedsstaaten auf außenpolitischer Ebene, der europäischen politischen Zusammenarbeit.
Die erste institutionelle Vertiefung des europäischen Einigungsprozesses
Gegen Ende der 1980er Jahre, als der Zusammenbruch des Ostblocks erfolgte und die Wiedervereinigung Deutschlands Realität wurde, fand das Ziel einer politischen Einigung Europas zur Überwindung der bisherigen Spaltung des Kontinents breitere Anerkennung. Dieses Ziel erforderte nicht nur die ökonomische, sondern auch die politisch-institutionelle Vertiefung des bisher Geschaffenen. Die Vollendung des Binnenmarktes im Jahre 1992 und seine Stellung im Weltmarkt begründeten die Forderung nach und – nach Meinung vieler – die Notwendigkeit einer einheitlichen Währung. 1991 wurde der Vertrag von Maastricht unterzeichnet, der als die Wurzel der heutigen Europäischen Union gesehen werden kann.
Die Europäische Union fußte auf drei Säulen. Die erste Säule bestand aus den Europäischen Gemeinschaften, die mit der so genannten ›Gemeinschaftsmethode‹ arbeiteten. In ihrem Rahmen war die Schaffung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) eine grundlegende Neuentwicklung. Sie wurde am 1. Januar 2002 mit der Einführung des Euro abgeschlossen. Die zweite Säule bestand aus der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), innerhalb derer die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Bereich der Außenpolitik auf Regierungsebene vorgesehen war. Die dritte Säule schließlich bestand aus der Zusammenarbeit in Rechtsangelegenheiten und in innenpolitischen Fragen (z.B. Asyl- und Migrationspolitik). In diesem Bereich arbeiten die Mitgliedsstaaten ebenfalls auf Regierungsebene zusammen, d.h. ohne die ›Gemeinschaftsmethode‹ anzuwenden.
Der Vertrag von Amsterdam
Nach der nächsten Erweiterung der Europäischen Union im Jahre 1995 (Schweden, Finnland und Österreich, fand im Rahmen des Vertrages von Amsterdam im Jahre 1997 eine dritte Überarbeitung der Verträge statt. Der Amsterdamer Vertrag erweiterte die ›Gemeinschaftsmethode‹ durch die Möglichkeit der »verstärkten Zusammenarbeit« und bereicherte die institutionellen Rahmenbedingungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Dennoch bestand weiterhin das Problem, dass die Union – und insbesondere ihre Institutionen – noch nicht auf die bereits vorhersehbare Erweiterung nach Osteuropa vorbereitet waren. Diese Aufgabe wurde im Jahre 2000 bei der nächsten Regierungskonferenz zur Überarbeitung der Verträge angegangen, welche den Vertrag von Nizza hervorbrachte.
Der Vertrag von Nizza
Mit dem Vertrag von Nizza (2000) versuchte die Union die Problematik der ›leftover‹ des Vertrages von Amsterdam zu lösen und die Union zur Aufnahme von zwölf Mitgliedsstaaten zu befähigen, mit denen Beitrittsverhandlungen aufgenommen worden waren. Zu den Errungenschaften des Vertrages von Nizza zählen die Stärkung der ›Gemeinschaftsmethode‹ in neuen politischen Bereichen, die Stärkung des Europäischen Parlamentes und die Erleichterung der Anwendung der Institution der »verstärkten Zusammenarbeit«. Da die »verstärkte Zusammenarbeit« bisher nicht in Anspruch genommen wurde, bleibt abzuwarten ob sie – sobald sie angewandt wird – der Flexibilität der Union dient oder ob sie in der Zukunft eine Gefahr für die Einheit der Europäischen Union bedeuten würde. Parallel dazu wurde ein Kompromiss bezüglich der institutionellen Architektur der erweiterten Union erreicht: die Zusammenstellung der Kommission und des Parlamentes in einer Union von siebenundzwanzig Mitgliedstaaten und der Entscheidungskanon wurden vereinfacht, um im Rat Entscheidungen möglich zu machen. Im Gegensatz dazu wurde die Grundrechtecharta, die von einem eigens zu diesem Zweck einberufenen Konvent ausgearbeitet worden war, trotz aller Bemühungen des Parlamentes nicht als ein rechtsverbindlicher Teil in den Vertrag aufgenommen, sondern lediglich als politische Erklärung verkündet. Der Vertrag von Nizza trat am 1. Februar 2003 in Kraft und ebnete den Weg für die Erweiterung der Europäischen Union. Am 1. Mai 2004 wurden Estland, Zypern, Malta, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, die Slowakei, Slowenien und die Tschechische Republik Mitglieder der Europäischen Union.
Der Vertrag von Nizza stellte einen schwierigen Kompromiss dar, welcher als Grundlage für die Zukunft der erweiterten Union nicht überzeugend war. Besonders die Lösung, die man für den Entscheidungsprozess des Rates im Falle des Mitentscheidungsverfahrens vorgesehen hatte, war kompliziert und entsprach nicht einer gerechten Berücksichtigung der bevölkerungsreichen Mitgliedstaaten. Die Kompetenzverteilung zwischen den Mitgliedsstaaten und der Union, die Rolle der nationalen Parlamente, die rechtsverbindliche Aufnahme der Charta in den Vertrag sowie die Rationalisierung und Vereinfachung der Verträge, konnten in Nizza nicht erreicht werden.
Die Notwendigkeit einer Verfassung wird immer mehr sichtbar
Die Regierungskonferenz von Nizza legte in einer Erklärung, die dem Vertrag beigefügt worden war, ausdrücklich die Grenzen der diplomatischen Regierungskonferenzen als Methode für die Überarbeitung von Verträgen fest: Ein Mangel an Transparenz und Öffentlichkeit schaffe eine intensive Abgrenzung der europäischen Bürger vom Prozess der europäischen Integration. Demzufolge entschieden sich die Mitgliedsstaaten während des Nizza-Gipfels im Dezember 2000 für einen neuen Versuch des globalen Dialogs über die Zukunft Europas. Ein Jahr später, während des Laeken-Gipfels (Dezember 2001), entschied der europäische Rat ein neues inoffizielles Organ einzuberufen: den »Europäischen Konvent für die Zukunft Europas«. Damit folgte man dem erfolgreichen Beispiel des Konvents, der die Grundrechtecharta erarbeitet hatte. Das Ziel des Konvents war, die nachfolgende Regierungskonferenz vorzubereiten.
Der Verfassungskonvent
Der Auftrag des Europäischen Rates gegenüber dem Konvent war, in drei Richtungen Vorschläge auszuarbeiten. Erstens, wie man den Bürgern das Bestreben nach europäischer Vereinigung und die europäischen Institutionen näher bringen kann. Zweitens, wie die erweiterte Europäische Union politisch organisiert sein muss, um effizient arbeiten zu können und drittens, wie die Rolle der Union in der Welt gestärkt werden kann. Zur selben Zeit hatte der Konvent zu untersuchen, ob das Ziel, die Verträge zu vereinfachen, durch die Aufnahme eines Verfassungstextes erreicht werden könnte. Der Konvent setzte sich aus sechzehn Vertretern des Europäischen Parlamentes, jeweils einem Vertreter jedes Mitgliedsstaates sowie jeweils zwei Vertretern jedes nationalen Parlamentes, zusammen. Die Repräsentanten der zehn Beitrittsländer hatten einen gleichberechtigten Status, während den damals noch kandidierenden Ländern Rumänien, Bulgarien und der Türkei ein Beobachter-Status eingeräumt wurde. Zwei Mitglieder der Kommission und – mit Beobachterstatus – Repräsentanten des Wirtschafts- und Sozialausschusses, des Ausschusses der Regionen, des europäischen Ombudsmanns und des Gerichtshofs der Europäischen Union nahmen ebenfalls an den Beratungen teil.
Die Arbeit des Konvents wurde unter dem Vorsitz von Valery Giscard d'Estaing im Februar 2002 eingeleitet und im Juni 2003 abgeschlossen. Sie fand, für europäische Verhältnisse, mit ungewöhnlicher Öffentlichkeit und Transparenz statt. Innerhalb der Grenzen des Möglichen schuf der Konvent die Bedingungen für Ausdrucksmöglichkeiten und die Teilnahme der Zivilgesellschaft und erarbeitete Ideen für fast alle Bereiche der europäischen Verträge. Während seines Einsatzes erreichte der Konvent ein Wiedererstarken der politischen Dynamik. Dies veranlasste die Regierungen vieler Mitgliedsstaaten dazu, Repräsentanten auf dem Niveau eines Außenministers einzusetzen. Unter der Koordinationsarbeit des Präsidiums gelang es dem Konvent schließlich, sein anfängliches – beschränktes – Mandat vom Europäischen Rat zu übertreffen. Statt durch seine Vorlagen der Regierungskonferenz verschiedene Alternativen anzubieten, entwarf der Konvent einen globalen, in großem Ausmaße neuen, verständlichen Entwurf eines Vertrages über eine Verfassung für Europa, welcher am 13. Juni 2003 in allgemeiner Übereinstimmung angenommen wurde. Der Entwurf des Vertrages wurde trotz der Einwände mehrerer Mitgliedsstaaten am 20. Juni 2003 beim Thessaloniki-Gipfel vorgelegt und als solide Basis für die Arbeit der nächsten Regierungskonferenz akzeptiert.
Die Europäische Verfassung ante portas:
Die mit dem Konventsentwurf befasste Regierungskonferenz wurde im Oktober 2003 in Rom eröffnet und von der italienischen Präsidentschaft koordiniert. Es war das hauptsächlich durch Deutschland und Frankreich unterstützte Ziel der Präsidentschaft, das Spektrum der zu diskutierenden Angelegenheiten einzuschränken. So bildeten sich zwei Tendenzen heraus: die erste war die Position jener Länder, welche den Entwurf des Konvents unterstützten oder begrenzte Verbesserungen und Zusätze verfolgten; unter diesen war auch Griechenland. Die zweite Tendenz ging von Ländern aus, die eine kritische Haltung gegenüber dem Entwurf des Konvents einnahmen, weil er weiter ging als die Integrationsbereitschaft dieser Mitgliedstaaten in der gegenwärtigen Lage des Integrationsprozesses zuließ. Besonders Großbritannien aber vertrat die Meinung, der Entwurf würde vitale Interessen von Mitgliedstaaten (insbesondere Spanien und Polen) unberücksichtigt lassen. Die Anstrengungen, die Konferenz im Dezember 2003 zum Abschluss zu bringen waren nicht von Erfolg gekrönt, da es sich als unmöglich erwies, Einstimmigkeit unter den Fünfundzwanzig zu erreichen. An dieser Stelle ist erwähnenswert, dass ein Konsens der zehn Kandidatenstaaten als notwendig angesehen wurde, obwohl diese zu diesem Zeitpunkt noch nicht formell Mitglieder der Europäischen Union waren. Ein ausschlaggebender Grund der Nichtübereinstimmung war die Weigerung Spaniens und Polens, die Vorschläge des Konvents bezüglich Entscheidungsfindung im Rat zu akzeptieren und ihr Beharren auf der Erhaltung des Systems von Nizza, was sie mit den vier größeren Mitgliedsstaaten fast auf eine Stufe stellte.
Unter der Irischen Präsidentschaft wurden die Möglichkeiten, zu einer Einigung zu gelangen, einer neuen Prüfung unterzogen. Die neuen politischen Bedingungen, die durch den Sturz der Regierungen Aznar und Miller in Spanien beziehungsweise Polen entstanden waren, führten dazu, dass die Regierungskonferenz im April 2004 wieder einberufen wurde. Die irische Präsidentschaft basierte auf den Errungenschaften der ersten Phase der Regierungskonferenz und versuchte, durch Verhandlungen die Probleme zu reduzieren – trotz der Bemühungen einiger Mitgliedsstaaten (speziell Großbritannien), einige Themen wieder aufzunehmen.
Auf der Grundlage eines komplexen Kompromisses zu den kritischen Punkten wurde der Vertrag über eine Verfassung für Europa letztendlich bei der Tagung des Europäischen Rates am 17. und 18. Juni 2004 in Brüssel von den Vertretern aller Mitgliedsstaaten gebilligt und die Regierungskonferenz damit abgeschlossen. Dem folgte die nötige technische Ausarbeitung des endgültigen Textes, sowie dessen Übersetzung in alle offiziellen Sprachen der Union. Der Vertrag über eine Verfassung für Europa wurde schließlich am 29. Oktober 2004 von den bevollmächtigten Vertretern der Regierungen der Mitgliedsstaaten in Rom unterzeichnet.
Das große Ereignis im Konstitutionalisierungsprozess der Union war ohne Zweifel die Erweiterung, welche nicht mit den vorherigen verglichen werden kann – weder quantitativ noch qualitativ. Das sprunghafte Anwachsen der Union von den fünfzehn Staaten des europäischen Westens (und Südens) auf siebenundzwanzig Staaten des wiedervereinigten Kontinents war der Katalysator, welcher Evolutionen beschleunigte und die bestehenden Einwände beseitigte, aber auch neue aufkommen ließ.
Die intergouvernementale Methode war für den Integrationsprozess in einer Union der sechs, der zwölf, vielleicht auch der fünfzehn Mitgliedstaaten noch nützlich. Aber sie erreichte ihre Grenze mit fünfundzwanzig Mitgliedern. Es wurde deutlich, dass bei dieser Zahl der Mitglieder die intergouvernementale Methode auf keinen Fall als ausschließliches Verfahren würde fortbestehen können. Es wurde deutlich, dass dies eine Union mit siebenundzwanzig Mitgliedsstaaten zur Lähmung verdammen würde. Schematisch gesprochen: das historische Jahr 1989 machte die Erweiterung politisch gesehen notwendig. Die Erweiterung wiederum erforderte die Verfassung.
Die nächsten Schritte
Der nächste Schritt bis zu dem – seinerzeit erhofften – Inkrafttreten der Europäischen Verfassung war die Ratifizierung durch jeden Mitgliedsstaat. Nach Unterzeichnung des Verfassungsvertrags beginnt in jedem Mitgliedsstaat separat ein Ratifizierungsprozess in Anwendung des jeweiligen nationalen Verfassungsrechts. In diesem Fall gab es zwei Möglichkeiten: die Ratifizierung durch das Parlament eines Mitgliedsstaates oder durch ein Referendum. Mehrere Mitgliedsstaaten hatten zu Referenda für die Europäische Verfassung aufgerufen. Das Verfahren der Ratifizierung der Europäischen Verfassung durch die fünfundzwanzig Mitgliedsstaaten war damit einer Gefahr ausgesetzt, denn Volksabstimmungen können sich als extrem problematisch herausstellen, wie es die historische Erfahrung bestätigt. 1992 musste Dänemark und 2001 Irland jeweils ein zweites Referendum abhalten, nachdem die ersten Resultate in Bezug auf die Verträge von Maastricht und Nizza negativ gewesen waren. Dies verzögerte seinerzeit das Inkrafttreten dieser zwei Verträge, im Falle des Vertrages von Nizza sogar um fast zweieinhalb Jahre!
Um extreme Verzögerungen beim Inkrafttreten der Europäischen Verfassung zu vermeiden, nahm die Regierungskonferenz eine Erklärung auf, der zu Folge die Angelegenheit dem Europäischen Rat vorgelegt wird, wenn in den zwei folgenden Jahren nach der Unterzeichnung des Vertrages durch die Mitgliedsstaaten mindestens vier fünftel derselben die Europäische Verfassung ratifiziert und zwei oder mehr dies nicht getan haben. Natürlich ist diese Vorkehrung rein politischer Natur, da die Anerkennung durch alle Staaten nach wie vor völkerrechtlich zwingend ist. Es ist durchaus einer Erwähnung wert, dass sowohl während des Konvents als auch während der Regierungskonferenz betont wurde, dass das Inkrafttreten der Verfassung vereinfacht werden müsse. Nach diesen Auffassungen sollten im Falle einer Ablehnung der Verfassung durch einen oder mehrere Staaten die übrigen Staaten die Möglichkeit haben, mit der Ratifizierung fortzufahren. Das heißt, dass die Union niemals Geisel eines der Mitgliedsstaaten werden sollte. Es sind zur Lösung des Problems mehrere prozessuale Vorschläge präsentiert worden, wie z. B. die simultane Anerkennung der Verfassung in allen Mitgliedsländern entweder durch Referenda oder durch die Parlamente. Dies zielt darauf ab eine Dynamik zu schaffen, die einerseits das Bewusstsein der Bevölkerung fördert und andererseits das Inkrafttreten der Verfassung erleichtert. Es wurde erwartet, dass die Europäische Verfassung am 1. November 2006 in Kraft tritt. Für den Fall von Verzögerungen oder des Ausbleibens der Entscheidung in irgendeinem der Verfahren tritt die Verfassung dann in Kraft, wenn der letzte Mitgliedsstaat die Ratifizierung durchgeführt hat.
Verfassung oder Verfassungsvertrag?
Der Begriff ›Verfassung‹ hat in Kontinentaleuropa eine spezifische Geschichte und somit auch einen spezifischen Inhalt. Erstens setzt die Verfassung Verfahren voraus, die eine gesteigerte Legitimierung herstellen. Zweitens hat die Verfassung durch die Entwicklung einer europäischen institutionellen Kultur einen spezifischen Inhalt gewonnen, was eine spezifische Natur ihrer Bestimmungen impliziert. Die erste Voraussetzung – das Verfassungsgebende Verfahren – wurde im Falle des Vertrags über eine Verfassung für Europa nicht verwirklicht, da der Ursprung seiner Legitimierung ein internationaler Vertrag ist, der von den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union abgeschlossen wurde. Die Tatsache, dass der Konvent ins Leben gerufen wurde, schafft eine gewisse Konstitutionalisierung des Verfahrens, welche allerdings nicht ausreichend ist. Der Inhalt der Europäischen ›Verfassung‹ hat zweifelsohne Elemente konstitutioneller Qualität. Aus den zuvor erwähnten Gründen ist der Ausdruck ›Europäischer Verfassungsvertrag‹ die präzisere Bezeichnung.
Schlussbemerkung: Die Ablehnung des Verfassungsvertrages durch einen beträchtlichen Teil der europäischen Linken versteht sich als Opposition zu neo-liberaler Ideologie und kapitalistischer Globalisierung. Was an dieser Stelle kritisiert werden muss, ist nicht die grundsätzliche politische Haltung, sondern die Schlussfolgerung, die daraus entsteht, d.h. das Scheitern des Verfassungsvertrages und damit die Bewahrung des Status quo als das weniger Schlechte in Betracht zu ziehen. Der Verfassungsvertrag ist ein möglicher Schritt, um die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union auf fortschrittliche Weise auszubauen und somit die institutionellen Rahmenbedingungen zur Verteidigung des Sozialstaatsmodels und zur Reform der kapitalistischen Wirtschaft zu schaffen. Ob dies erreicht werden kann oder nicht, wird durch politische Konflikte entschieden werden.
* Erstveröffentlichung in englischer Sprache: »From the Constitutionalisation of Europe to a European Constitution«, in: Social Europe, Issue 1, London 2005, p. 13-20. Anlässlich der Übersetzung ins Deutsche wurde eine leichte Überarbeitung vorgenommen.