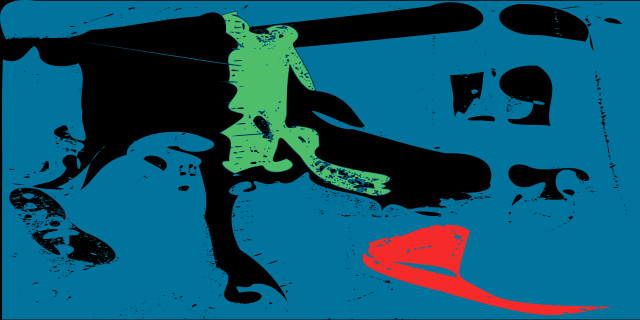von Peter Brandt
Die bipolare Weltordnung der Jahre 1945-1990 gehört definitiv der Vergangenheit an – eine Welt, in der zwei Hegemonen, zu Recht als ›Supermächte‹ charakterisiert, nicht nur eine, auch geopolitisch bestimmte Mächterivalität austrugen, sondern sie zugleich unterschiedliche, sogar antagonistische wirtschaftliche, soziale und politische Systeme repräsentierten. Dieser Gegensatz war zudem viel stärker ideologisch aufgeladen als bei früheren Mächtekonstellationen und -konflikten, etwa in den Koalitionskriegen gegen das revolutionäre Frankreich um 1800 oder im Ersten Weltkrieg, als die westliche ›Demokratie‹ gegen die mitteleuropäische ›Autokratie‹“ stand, jahrelang im Bündnis mit dem am ehesten autokratischen russischen Zarismus (aus deutscher Perspektive rang die tiefgründige ›Kultur‹ mit der westlich-oberflächlichen ›Zivilisation‹ und der östlichen ›Barbarei‹), sogar stärker als im Krieg der angelsächsischen Mächte und der Sowjetunion gegen den faschistischen Staatenblock in der ersten Hälfte der 1940er Jahre; denn weder das kaiserliche Deutschland noch das ›Dritte Reich‹ und seine Verbündeten erhoben – ungeachtet ihres Vorherrschaftsziels – einen universalistischen Anspruch. Bei den USA und der Sowjetunion hingegen verband sich das Streben nach – notfalls geteilter – Welthegemonie untrennbar mit vermeintlich menschheitsbeglückenden, im jeweiligen System fest verankerten Lehren, die mehr waren als flüchtige Camouflage eines offenkundigen Staatsegoismus. Wenn sich die amerikanische Weltmacht für die ›Freiheit‹ in der Welt zuständig fühlte, dann beinhaltete das die von der Elite des Landes verinnerlichte, weitgehende Identifikation eines liberalen Verfassungsdenkens mit den ökonomischen Interessen des US-Kapitalismus und mit den weltpolitischen Interessen der USA.
Die amerikanische Führungsrolle im westlichen, nicht von der Sowjetunion dominierten Teil Europas setzte sich nicht nur durch aufgrund deren enormer materieller Überlegenheit, sondern auch infolge eines neuen weltwirtschaftlichen Regimes, organisiert durch die bei Ende des Zweiten Weltkriegs geschaffenen, international regulierenden Organisationen wie Weltbank, Weltwährungsfonds und Welthandelsorganisation, die dann dazu beitrugen, dass der Schwung des Wiederaufbaus in einen lang anhaltenden Boom überging. Die Installation eines liberal-kapitalistischen, aber regulierten Weltmarkts war die Lehre, die die Washingtoner policy makers aus der tiefen Weltwirtschaftskrise der Jahre 1929-33 gezogen hatten. Dazu kamen die als Reaktion darauf erfolgenden einschneidenden Wirtschafts- und Sozialreformen der Roosevelt-Jahre, die nach dessen Tod 1945 nicht zurückgenommen, sondern ausgebaut wurden, vielfach nachholend gegenüber dem west-, nord- und mitteleuropäischen Standard. Nur deshalb konnte es gelingen, in Europa die anfangs antikapitalistischen bzw. kapitalismuskritischen Faktoren, namentlich die Sozialdemokratie, für die amerikanisch geführte »Weltdemokratie« (Kurt Schumacher) zu gewinnen.
Zusätzlich beförderte die von Anbeginn spürbare stalinistische Überformung der im östlichen Mitteleuropa und in Südosteuropa entstehenden ›Volksdemokratien‹ mit der pseudoplebiszitär garnierten Diktatur der Spitzenbürokratie, der Repression und, namentlich in Ostdeutschland, den erheblichen Reparationsentnahmen, wodurch die Verbesserung des Lebensstandards auch in den bereits stark industrialisierten Ländern zurückblieb, eine proamerikanische Orientierung des westlichen Europa. Trotz wiederholter, nicht aussichtsloser Ansätze, die wirtschaftliche Effizienz zu erhöhen und den Abstand zu verringern, gelang es dem ›real existierenden Sozialismus‹ letztlich nicht, nachhaltig erfolgreich vom extensiven zum intensiven Wachstum überzugehen, und er scheiterte insbesondere bei der Entwicklung der neuen Technologien, namentlich in der Mikroelektronik. Gegen Ende der 1980er Jahre war das System, so wie es seit siebzig Jahren existiert hatte, am Ende; nur verschärfte Unterdrückung hätte es noch ein oder zwei Jahrzehnte aufrechterhalten können.
In den entwickelten westlichen Staaten hat man nie hinreichend verstanden, warum das sowjetische nichtkapitalistische Modell in der südlichen Hemisphäre lange relativ attraktiv war, bei vielen Entwicklungsländern und bei antikolonialen bzw. antiimperialistischen Befreiungsbewegungen. Etwas vereinfacht gesagt, ging es erstens um Sympathie für den Antagonisten der früheren Kolonialmächte bzw. der als neokolonial wahrgenommenen USA und um die Hoffnung auf sowjetische Unterstützung. Zweitens schienen die Industrialisierung und Modernisierung der UdSSR sowie ihr Aufstieg zur zweiten Weltmacht – trotz der Verheerungen der Jahre 1941-45 – die Perspektive einer schnellen nachholenden und dabei autozentrierten Entwicklung zu eröffnen. Die Ergebnisse in den diversen Ländern sind differenziert zu betrachten, alles in allem aber wenig überzeugend. Inzwischen haben die neoliberale Wende seit den späten 70er Jahren und die Schuldenfalle das Meiste ruiniert, was im globalen Süden von alternativen Ansätzen übrig war.
Der wirtschaftliche Aufstieg einer Reihe früherer Entwicklungsländer, vor allem in Ostasien, hat die überschaubare Landkarte der Nachkriegsjahrzehnte – vereinfacht: Ostblock und Westblock in der nördlichen Hemisphäre sowie ›Dritte Welt‹ im Süden – erheblich differenziert, ebenso die Auflösung des alten Ost-West-Konflikts durch den Systemzusammenbruch des ›real existierenden Sozialismus‹ im östlichen Europa. China, nach wie vor von der Spitze einer Kommunistischen Partei diktatorisch regiert, hat mit seiner charakteristischen Kombination von Staatswirtschaft und Privatkapitalismus nicht nur den Anschluss an die Länder des Westens geschafft, sondern dabei auch Hunderte Millionen Menschen aus bitterer Armut befreit. Es ist die neue Supermacht, die dem zwischenzeitlichen Welthegemon USA (längerfristig absteigend und fast nur noch aufgrund seiner militärischen Macht ökonomisch dominierend) Paroli bietet. Das gigantische, mehrere Kontinente übergreifende Handels- und Infrastrukturprojekt der Neuen Seidenstraße versinnbildlicht diese Herausforderung.
Anders als China, das inzwischen in nahezu allen Bereichen konkurrenzfähig ist, beruht die unter der Präsidentschaft Wladimir Putins partiell wiedergewonnene innere und äußere Stärke Russlands vorwiegend auf seinem Energiereichtum einerseits und seinem von der Sowjetunion geerbten Atomwaffenarsenal andererseits. Die längst erreichte Überlegenheit der NATO auch auf konventionellem Gebiet zwingt Russland beinahe dazu, auf die relativ billigere atomare Rüstung zu setzen, solange nicht ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem die von der Elbe an den Bug und weiter nach Osten verschobene, erneuerte Ost-West-Konfrontation aufzulösen vermag. Auch Mainstream-Politiker im Westen räumen inzwischen ein, dass die mangelnde Berücksichtigung grundlegender geostrategischer Interessen Russlands wie auch dessen psychologischer Situation nach 1990 durch den Westen zur erneuten Zuspitzung der Lage im östlichen Europa zumindest beigetragen hat.
Mit jenem moralischen Imperialismus, wie ihn namentlich in der Bundesrepublik Deutschland parteiübergreifend Politiker und Journalisten vertreten, kommt EU-Europa nicht weiter. Diese Haltung betont die – in der Sache teilweise durchaus berechtigte – Kritik an der Außen- und Innenpolitik Russlands, richtet sich dabei indessen zunehmend auch gegen die missliebigen Regierungen in Polen und Ungarn; besonders haben sich das Europäische Parlament bzw. dessen Fraktionen jüngst dabei hervorgetan. Statt kritisch zu reflektieren, wieso rechtspopulistische Parteien und Politiker mit autoritären Tendenzen in freien Wahlen sei es absolute, sei es relative Mehrheiten gewinnen können (und damit demokratisch übrigens besser legitimiert sind als die EU-Institutionen), hat man sich in selbstgerechten Anklagen und Drohungen überschlagen: Finanziell »aushungern« (Katharina Barley), »schmerzhaft« (Heiko Maas) zu Leibe rücken wollte man den unbotmäßigen EU-Mitgliedern, wenn sie nicht die Rechtsstaatskriterien der EU für Finanzhilfen (wo bislang andere Gesichtspunkte galten) akzeptierten. Erfreulicherweise konnte der akute Konflikt durch einen Kompromiss entschärft werden.
Gewiss brauchen wir das vereinte Europa, eine handlungsfähige, in sinnvoller Abgrenzung zur nationalstaatlichen Ebene besser funktionierende und demokratisierte Union. Wir brauchen sie nicht nur zur simplen Behauptung des Kontinents in einer sich rapide wandelnden Welt mit überwiegend abweichenden politischen und vielfach auch gesellschaftlichen Ordnungen sowie wirtschaftlichen Konkurrenzen. Die Floskel von der ›westlichen Wertegemeinschaft‹ ignoriert dagegen, dass zwischen dem Menschenrechts- und Demokratieverständnis Europas und dem der USA gravierende Unterschiede bestehen, die sich hauptsächlich auf die Anerkennung sozialer Rechte und auf das Prinzip der Sozialstaatlichkeit beziehen. Auch wenn letztere in der finanzmarktgesteuerten Phase des Kapitalismus mit ihrer sozialen Polarisierung auch in Europa angegriffen und eingeschränkt worden ist, ist sie, anders als in Amerika, weiterhin untrennbar mit der europäischen Vorstellung und Wirklichkeit von Demokratie verbunden.
Trotz der erheblichen Schwächung des Sozialstaats und des Modells der 1940er bis 70er Jahre, des Modells einer gelenkten und regulierten Marktwirtschaft, im Zuge der neoliberalen Gegenreform darf von EU-Europa aufgrund seiner geistigen Traditionen, wirtschaftlich-technologischen und politischen Potenzen auch am ehesten erwartet werden, als Großregion ernsthaft nach einem Ausweg aus der ökologischen Existenzkrise der Menschheit sowie den wieder dramatisch zunehmenden militärischen Gefährdungen zu suchen und damit dem Rest der Staatenwelt ein lohnenden Beispiel zu liefern. Der Einwand, dass die Anderen keinesfalls folgen werden, ist gleichbedeutend mit sträflicher Ignoranz gegenüber dem Ernst der Lage oder dem Eingeständnis der Hoffnungslosigkeit in den zentralen Gattungsfragen. Die Kraft, ganz neue Wege zu gehen, altes Denken zu überwinden und die damit verbundenen gesellschaftlichen Kräfte, in erster Linie die des großen Kapitals, zurückzudrängen, wird Europa indessen nicht als Juniorpartner in einer ›Atlantischen Partnerschaft‹ mit den USA aufbringen, jener Gesellschaft, die mehr als jede andere den gegenwärtigen Zustand mitbewirkt und von seiner Fortdauer profitiert. Diese Erkenntnis zu befördern, hätte eine unbewusst nützliche Funktion des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump sein können. Dass er das nicht vermocht hat, geht nun allerdings nicht auf sein Konto. Die Erleichterung über Trumps Abwahl mag in vieler Hinsicht berechtigt sein – jedenfalls was das Ende der Unberechenbarkeit des Mannes im Weißen Haus betrifft –, neue Illusionen und neue Ernüchterung über die Nachfolgeregierung sind jedoch programmiert.